Malakologisches Aus Dem Ostalpenraum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hartmut Boockmann 1934-1998
__________________________________________________ MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN JAHRGANG 8 (1998) NR. 2 MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN JAHRGANG 8 (1998) NR. 2 RESIDENZEN-KOMMISSION ARBEITSSTELLE KIEL ISSN 0941-0937 Herstellung: Vervielfältigungsstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Titelvignette: Blick auf die Neue Burg mit Denkmal Prinz Eugens am Heldenplatz (© Österreich Werbung) INHALT Hartmut Boockmann 1934-1998 ...................................................................................5 Auswahlbibliographie Hartmut Boockmann........................................................9 Aus der Arbeit der Kommission ................................................................................ 15 Schriftenverzeichnis Karl-Heinz SPIESS ............................................................ 19 Die Arbeit der anderen .............................................................................................. 24 Jeroen DUINDAM, Utrecht: The court of the Austrian Habsburgs: locus of a com- posite heritage .................................................................................................. 24 Cordula NOLTE, Greifswald: Studien zum familialen und verwandtschaftlichen Beziehungsnetz der Markgrafen von Brandenburg (Projektskizze).................... 59 Kolloquiumsberichte................................................................................................. 65 6. Symposium der Residenzenkommission -

Leseproben VON SCHLOSS ZU SCHLOSS
Leseproben VON SCHLOSS ZU SCHLOSS Teil 1 – Schlossbeschreibungen (a) SCHLOSSBESCHREIBUNGEN BEZIRK JUDENBURG ( ) Allerheiligen – siehe Tiefenbach / Pölstal 1. Admontbichl 2. Authal 3. Eppenstein 4. Farrach 5. Fohnsdorf 6. Frauenburg 7. Gabelhofen 8. Grubhofen im Feeberggraben 9. Gusterheim 10. Hanfelden 11. Die Burgen in Judenburg 12. Liechtenstein 13. Neuliechtenstein 14. Offenburg 15. Pichlhofen 16. Rattenberg 17. Reifenstein 18. Rosenbach 19. Rothenthurm 20. St. Georgen am Schwarzenbach ( ) Sauerbrunn und die Sternschanze – siehe Thalheim ( ) Steirerschlössl – siehe Thalheim 21. Strettweg 22. Thalheim (Sauerbrunn) und die Sternschanze 23. Thann 24. Tiefenbach - Allerheiligen 25. Thorhof 26. Weissenthurn 27. Weyer 28. Schloss Propstei Zeiring 1. Admontbichl, unbewohntes Schloss Ausgangsort: Judenburg. Entfernung: Judenburg / Obdach = 17 km. Wo es steht: In Obdach, Ortsteil Rötsch, auf einem kleinen Hügel westlich der Durchfahrtsstraße durch Rötsch - trotz der Tafel „nur für Anrainer“, zur Besichtigung problemlos zu befahren. Kombinierbar mit dem Ort Obdach, Schloss Rosenbach, St. Georgen im Obdachegg (Wanderung 37), der Ruine Eppenstein (Wanderung 6), Schloss und Ruine Liechtenstein (Wanderung 27) und den Wanderungen Nr. 16, 22, 29, 40, 54, 57. Das Benediktinerstift Admont war bereits 1160 um Obdach begütert und besaß unter anderem ein Grundstück, auf dem später der „Mereinhof zu Pichl“ entstand. Er wurde 1367 befestigt und ist heute ein einstöckiger Vierkantbau mit Torturm. Ab 1599 war er Sitz der Propsteiverwaltung und diente bei Gefahr als Zuflucht für die Bevölkerung. Um 1617 war hier auch der Sitz des Landgerichts für das Stift Admont. Als Verwalter traten im 15. und 16. Jh. die Kainacher, die Zach und die Gallenberger auf. Sein heutiges Aussehen erhielt Admontbichl unter dem Propst Ritter Daniel von Gallenberg zwischen 1530 und 1587. -

№ Wca № Castles Prefix Name of Castle Oe-00001 Oe-30001
№ WCA № CASTLES PREFIX NAME OF CASTLE LOCATION INFORMATION OE-00001 OE-30001 OE3 BURGRUINE AGGSTEIN SCHONBUHEL-AGGSBACH, AGGSTEIN 48° 18' 52" N 15° 25' 18" O OE-00002 OE-20002 OE2 BURGRUINE WEYER BRAMBERG AM WILDKOGEL 47° 15' 38,8" N 12° 19' 4,7" O OE-00003 OE-40003 OE4 BURG BERNSTEIN BERNSTEIN, SCHLOSSWEG 1 47° 24' 23,5" N 16° 15' 7,1" O OE-00004 OE-40004 OE4 BURG FORCHTENSTEIN FORCHTENSTEIN, MELINDA-ESTERHAZY-PLATZ 1 47° 42' 34" N 16° 19' 51" O OE-00005 OE-40005 OE4 BURG GUSSING GUSSING, BATTHYANY-STRASSE 10 47° 3' 24,5" N 16° 19' 22,5" O OE-00006 OE-40006 OE4 BURGRUINE LANDSEE MARKT SANKT MARTIN, LANDSEE 47° 33' 50" N 16° 20' 54" O OE-00007 OE-40007 OE4 BURG LOCKENHAUS LOCKENHAUS, GUNSERSTRASSE 5 47° 24' 14,5" N 16° 25' 28,5" O OE-00008 OE-40008 OE4 BURG SCHLAINING STADTSCHLAINING 47° 19' 20" N 16° 16' 49" O OE-00009 OE-80009 OE8 BURGRUINE AICHELBURG ST. STEFAN IM GAILTAL, NIESELACH 46° 36' 38,6" N 13° 30' 45,6" O OE-00010 OE-80010 OE8 KLOSTERRUINE ARNOLDSTEIN ARNOLDSTEIN, KLOSTERWEG 3 46° 32' 55" N 13° 42' 34" O OE-00011 OE-80011 OE8 BURG DIETRICHSTEIN FELDKIRCHEN, DIETRICHSTEIN 46° 43' 34" N 14° 7' 45" O OE-00012 OE-80012 OE8 BURG FALKENSTEIN OBERVELLACH-PFAFFENBERG 46° 55' 20,4" N 13° 14' 24,6" E OE-00014 OE-80014 OE8 BURGRUINE FEDERAUN VILLACH, OBERFEDERAUN 46° 34' 12,6" N 13° 48' 34,5" E OE-00015 OE-80015 OE8 BURGRUINE FELDSBERG LURNFELD, ZUR FELDSBERG 46° 50' 28" N 13° 23' 42" E OE-00016 OE-80016 OE8 BURG FINKENSTEIN FINKENSTEIN, ALTFINKENSTEIN 13 46° 37' 47,7" N 13° 54' 11,1" E OE-00017 OE-80017 OE8 BURGRUINE FLASCHBERG OBERDRAUBURG, -

ORBIS LATINUS Online Dr
A | B | C | D | E | F | G | H | I and J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z contents | previous | next A Aara, s. Abrinca 2. Aarhusium, Arusium, Arhusia, Remorum domus, Aarhuus, St., Dänemark (Jütland). Aarhusum, Ahaus, St., Preußen (Westfalen). Aarimous, s. Aurimontium. Aasona, s. Ausa nova [sic -- no such entry]. Aaziacum s. Aciacum. Abacaenum, Tripi, St., Sizilien. Abacantus, Abancay, Fl. u. St., Peru (Südamer.). Abacella, s. Abbatis cella. Abacum, Abuzanum, Abodiacum, Abudiacum, Abbach, Mfl., Bayern (Niederb.). Aballaba, Aballava, eh. Oschf. b. Papcastle, D., England (Cumberland). Aballo, Aballum, Avalo, Avallon, St., Frankr. (Yonne). Aballum, s. Aballo. Abantonium, Albantonium Aubanton, St., Frankr. (Aisne). Abasci, Abassabad, St., Rußand (Kaukasien). Abatereni, s. Obotriti. Abavyvariensis comitatus, d. Komitat v. Abauj-Toma, Ungarn. Abbatia, s. die Beinamen. Abbaticovilla, s. Abbatis villa. Abbatis burgus, Bourg d'Abbé, D., Frankr. (Loiret). Abbatis cella od. zella, Abbacella, Appacella, Appencellense od. Appolitanense monst., Appenzell, St., Schweiz. Abbatis pons, Pont d'Abbé, St., Frankr. (Finistere). Abbatis villa, Abbavilla, Abbaticovilla, 1. Abbeville, St., Frankr. (Somme). ---2. Abbans, D., Frankr. (Doubs). Abbavilla, s. Abbatis villa. Abbefortia, Abbotsford, Schl., Schottland. Abbenhulis, Appelhülsen, D., Preuß. (Westfalen). Abbentonia, Abintonia, Abindonia, Abingdon, St., England (Berks). Abbenwilare, Appenweier, Mfl., Baden (Offenburg). Abcudia, Abcoude, St., Niederlande. (Utrecht). Abdara,Abdera, Abdra, Adra, St., Spanien (Andalusien). Abdera, s. Abdara. Abdiacum, s. Fauces 1. Abdra, s. Abdara. Abdriti, s. Obotriti. Abdua, Addua, Adus, Adda, Nfl. d. Po, Italien (Lombardei). Abella, Abellae, Avella, St., Italien (Avellino). Abellinum, Avellino, St., Italien (Avellino). Abellinum, Marsicum, Marsico Vetere, St., Italien (Potenza). Abenda, s. Powundia. Abensperga, Aventinum, Castrum Rauracense, Abusina, Arusena, Abensberg, St., Bayern (Niederb.). -

Download Publikation
Osterreichisdies Museum für Volkskunde BIBLIOTHEK Nr. fi f& f ,;w............... Standort N - 8 0 LEOPOLD SCHMIDT GESCHICHTE DER ÖSTERREICHISCHEN VOLKSKUNDE '6hOJ^/oz AA& 888 - 06- 3 0 ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERLAG FÜR UNTERRICHT, WISSENSCHAFT UND KUNST WIEN BUCHREIHE DER Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde NEUE SERIE / BAND II Wien 1951 österreichischer Bundes vertag Alle Rechtevorbehalten Druck: Holzwarth & Berger, Wien I Verlagsnummer 7133-2 EDMUND FRIESS in herzlicher Verehrung V orwort österreichische Volkskunde heißt in der Gegenwart eine Wissenschaft, die sich nach langen Jahren des geistigen Ringens zu anerkannter Bedeutung durchgearbeitet hat. Ihre Eigenart läßt sich am besten aus ihrer Geschichte verstehen. Wissenschafts geschichte zu treiben ist hauptsächlich dann begründet, wenn eine Disziplin an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung an gelangt zu sein scheint. Der Historiker seines eigenen Faches wird in den seltensten Fällen nur aus annalistischem Interesse allein die Einzeldaten zu ordnen bestrebt sein; ihn wird vor allem das Gefühl bewegen, an einem besonderen Punkt der Entwicklung zu stehen, ob es sich nun um einen Gipfel oder um ein Wellental handeln mag, ob man vorwärts zu schreiten oder gehemmt zu werden glaubt; das Gefühl, Rechenschaft ablegen und weiter weisen zu müssen, wird ihn vor allem treiben. Aus solchen Erwägungen heraus sind zweifellos auch die bis herigen Darstellungen der Geschichte der Volkskunde entstanden, wie sie in den beiden letzten Jahrzehnten versucht wurden. Die österreichische Volkskunde im besonderen ist noch nie im Zusam menhang betrachtet worden, sie hat sich bisher stets mit einer Seitenstellung im Gefolge der deutschen Volkskunde begnügen müssen. Gustav Jungbauer hat sie jedoch in seiner verdienst vollen „Geschichte der deutschen Volkskunde“ 1931 betont mit- einbezogen, und auch Arthur Haberlandt in seiner „Deutschen Volkskunde“ 1935, die hauptsächlich eine Ideengeschichte darstellt. -

Download Publikation
österreichische Zeitschrift für Volkskunde Herausgegeben vom Verein für Volkskunde in Wien Unter ständiger Mitarbeit von Hanns Koren (G ra z ), Franz Lipp (Linz), Oskar Moser (K lag en furt) und Josef Ringler (Innsbruck) geleitet von Leopold Schmidt Neue Serie Band XXI Gesamtserie Band 70 WIEN 1967 IM SELBSTVERLAG DES VEREINES FÜR VOLKSKUNDE Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht der Burgenländischen Landesregierung - der Niederösterreichischen Landesregierung der Steiermärkischen Landesregierung der Salzburger Landesregierung der Tiroler Landesregierung der Vorarlberger Landesregierung des Magistrates der Stadt Wien und des Notringes der wissenschaftlichen Verbände Österreichs Abhandlungen und Mitteilungen Ernst Schneider, Bergwörterbücher als volkskundliche Quellen 1 W olfgang Haid, Ein bergmännisches Rechtsdenkmal aus Eisenerz 33 Hans-Hagen Hottenroth, Randbeschlagene Spaten im nieder österreichischen V oralpenland ...................................................... 39 Friedrich Waidache r, Zwei Prtigelkrapfenrezepte aus Steier mark ..................................................................................................... 41 Iris Barbara G r a e f e, Hexengeschichten aus Vorarlberg . 43 Melanie W i s s o r, 90 Jahre Stadt Mödling. Eine Rückschau in volkskundlicher Hinsicht mit Einbeziehung einiger umlie gender Ortschaften .......................................................................... 81 Wolfgang Hiad d, Volkskundliches aus der Leobemer Polizeiord nung von 1790 ................................................................................ -

Layout-Band 22
Der Wienerwald Vorwort Mit dem „Europa der Regionen“ hat sich in Mit dem Wienerwald stellen wir Ihnen einen den letzten Jahren ein Begriff etabliert, der auf Landschaftsteil vor, der besonders durch die die Kleinteiligkeit und Unterschiedlichkeit der Natur, durch die Weite und Geschlossenheit europäischen Kulturlandschaft Bezug nimmt. des Waldes geprägt ist. Wie so oft in der öko- Im Unterschied zu manch anderen Ländern logischen Geschichte war auch dieser einmal dieser Erde hat sich bei uns eine Vielfältigkeit vom Abholzen und Verbauen bedroht. Dem entwickelt, die teilweise sehr kleine regionale weit blickenden Bürgermeister Josef Schöffel Besonderheiten hervorgebracht hat. Abhängig aus Mödling ist es zu verdanken, dass die von der Landschaft, von der Besiedelungs- Erhaltung seit mehr als 100 Jahren nun außer struktur, von der klimatischen Besonderheit Zweifel ist und der für seine Zeit sehr moderne und von den wirtschaftlichen Gegebenheiten Regulierungsplan zum Schutze des Wiener- sind sehr dichte, regionale Strukturen entstan- waldes verfasst wurde. Die Überschaubarkeit den. Natürlich hat dies auch in der Kultur von Regionen fördert geradezu das Engage- ihren Niederschlag gefunden und so sind die ment einzelner Bürger für ihre Heimat, für die Bräuche und Gewohnheiten, aber auch die Erhaltung ihrer Besonderheit und ihrer Bauten der Menschen ganz unterschiedlich in Lebensgrundlagen, und ihrer Denkmäler den einzelnen Regionen. Dass dies mit den politischen Grenzen nicht immer einher geht und dass die kulturellen Einflüsse von einer Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll Region zur anderen schon immer Bestandteil der Geschichte waren, zeigt wiederum die Offenheit der Menschen. Auch wenn der Begriff der Heimat, der meist mit der Land- schaft, mit der Region einhergeht, für jeden Menschen im Sinne der Wurzel für sein Leben wichtig ist, so bedeutet dies nicht eine Abgrenz- ung nach Außen. -

Restitutionsbericht Universalmuseum Joanneum, Graz 2010.Pdf
Restitutionsbericht 1999–2010 8 Vorwort Inhalt Wolfgang Muchitsch 10 Einleitung Helmut Konrad 12 Vorwort der Herausgeberinnen Karin Leitner-Ruhe 16 Das Universalmuseum Joanneum und sein Umgang mit Raubkunst von 1938 bis heute 17 Vorgänge während des Krieges – Das Joanneum während der NS-Zeit 17 Organisationsstruktur und personelle Besetzungen im Joanneum 18 Enteignungen und Verteilung von Kunstgegenständen während der Kriegszeit 20 Erwerbungen aus Wiener Sammlungen für das Landesmuseum Joanneum 20 Die Situation in der Steiermark 20 I. Budgetäre Situation – „Judenkredit“ 21 II. Die Rolle des Joanneums bei Enteignungen 25 III. Gegenstände aus den Synagogen – Plünderung 1938 und Rückgabe 1946 26 IV: Bergungen und Luftschutzdepots 27 Zur Restitution am Landesmuseum Joanneum zwischen 1945 und 1955 28 Provenienzforschung am Landesmuseum Joanneum seit 1998 28 Der Arbeitskreis „Erwerbungen und Rückstellungen aus jüdischem Besitz 1938 bis 1955“ 31 Vernetzung und Literatur 32 Rückgaben seit 1998 33 Offene Fragen 36 Forschungsbericht 1999–2010 37 Erklärungen zum Forschungsbericht 1999–2010 38 Restituierte Objekte seit 2000 Karin Leitner-Ruhe 40 Alte Galerie 41 Erklärungen zum Bericht der Alten Galerie 42 Eindeutig bedenkliche Erwerbungen 42 Einbringung Gestapo 43 Einbringung Vugesta 45 Rudolf Gutmann, Wien und Kalwang 47 Robert Spira, Graz 49 Möglicherweise bedenkliche Erwerbungen 49 Auktionshaus Kärntnerstraße, Wien 51 Auktionshaus Weinmüller, Wien 54 Erwerbungen aus dem Grazer Kunsthandel 1938 bis 1945 57 Sammlung Eisler 58 Causa Lion 60 Eindeutig -

Trockenstandort Ruine Rabenstein (Gemeinde Virgen)" 661-706 ©Naturwissenschaftlicher Verein Für Kärnten, Austria, Download Unter
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carinthia II Jahr/Year: 2015 Band/Volume: 205_125 Autor(en)/Author(s): Stöhr Oliver, Deutsch Helmut, Gattermayr Matthias, Angerer Herbert, Weinländer Martin, Benedikt Eva, Gewolf Susanne Artikel/Article: Ergebnisse aus der NAGO-Pilotstudie "Trockenstandort Ruine Rabenstein (Gemeinde Virgen)" 661-706 ©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.zobodat.at Carinthia II n 205./125. Jahrgang n Seiten 661–706 n Klagenfurt 2015 661 Ergebnisse aus der NAGO-Pilotstudie „Trockenstandort Ruine Rabenstein (Gemeinde Virgen)“ Oliver STÖHR, Helmut DEUTSCH, Matthias GATTERMAYR, Herbert ANGERER, Martin WEINLÄNDER, Eva BENEDIKT & Susanne GEwoLF Zusammenfassung Schlüsselwörter Im Zuge des von der Naturkundlichen Arbeitsgemeinschaft Osttirol (NAGO) initi- Inneralpine ierten Projektes „Erfassung der Biodiversität inneralpiner Trockenstandorte in Osttirol Trockenvegetation, und ihrer Bedeutung für den Naturschutz“ wurde ein einjähriges Pilotprojekt am Burg- Ist-Zustand, hügel der Ruine Rabenstein (Gem. Virgen, Osttirol) durchgeführt. In einem definierten Naturschutz, Osttirol, Untersuchungsgebiet von rd. 4,65 ha wurde anhand der vorkommenden Biotoptypen Verbuschung und ausgewählter Indikator-Organismengruppen der Ist-Zustand des als inneralpiner Trockenstandort bekannten Gebietes erfasst. Dazu wurden umfangreiche und auf die Keywords Phänologie der Vegetationsentwicklung bzw. einzelnen -
2021 Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta Zrc Sazu 2021
ACTA HISTORIAE ARTIS SLOVENICA 26|1 2021 UMETNOSTNOZGODOVINSKI INŠTITUT FRANCETA STELETA ZRC SAZU 2021 1 | 26 Vsebina • Contents Janez Balažic, Fragmentarno ohranjene gotske stenske poslikave na zahodnem panonskem robu • Fragmentarily Preserved Gothic Murals on the Western Edge of Pannonia Mija Oter Gorenčič, Die monastischen und kunsthistorischen Beziehungen zwischen Gaming und den Kartausen im heutigen Slowenien unter besonderer Berücksichtigung der Memoria und der Herrschaftsrepräsentation der Habsburger und der Grafen von Cilli • Redovne in umetnostne povezave med Gamingom in kartuzijami v današnji Sloveniji s posebnim ozirom na memorio in likovno reprezentacijo Habsburžanov in grofov Celjskih Samo Štefanac, Ponovno o koprski Pieta` • Di nuovo sulla Pieta` di Capodistria Jože Plečnik: načrt za cerkev sv. Križa v Zagrebu, Alessandro Quinzi, Rodbinske ambicije Sigismunda grofa Attems Petzenstein v luči umetnostnih naročil • varianta s stožčasto streho, detajl fasade, Le ambizioni familiari del conte Sigismondo Attems Petzenstein alla luce delle committenze artistiche © Muzej in galerije mesta Ljubljana Polona Vidmar, Vorfahr oder König? Zur Rezeption der Porträts des 17. Jahrhunderts unter Franz Josef Fürst Dietrichstein (1767–1854) • Prednik ali kralj? Recepcija portretov iz 17. stoletja v času Franca Jožefa kneza Dietrichsteina (1767–1854) Mateja Maučec, Vizualna propaganda Stadlerjevih ekumenskih prizadevanj v freskah Ivane Kobilce • Visual Propaganda of Stadler’s Ecumenic Project in Frescoes by Ivana Kobilca Vaidas Petrulis, Kaunas – a Baltic Garden City? • Kaunas – baltsko vrtno mesto? Damjan Prelovšek, Plečnikovi načrti za cerkev sv. Križa v Zagrebu • Plečnik’s Plans for the Church of the Holy Cross in Zagreb Martina Malešič, Risbe iz stockholmskih arhivov. Poskus rekonstrukcije švedske izkušnje arhitektov Franceta in Marte Ivanšek • Drawings from the Stockholm Archives. -
Unsere Heimat Beiheft 1/2009
Unsere Heimat Beiheft 1/2009 NÖ Bibliographie 2008 Medieninhaber (Verleger) und Herausgeber: Verein für Landeskunde von Niederösterreich, A-3109 Sankt Pölten, Landhausplatz 1 (Generalsekretariat; Tel. 02742/9005/16255). Satz und Layout: C & G König, Mödling © 2009 Verein für Landeskunde von Niederösterreich ISSN 1017-2696 Erstellt mit Unterstützung und Förderung des Bundeslandes Niederösterreich (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Kultur und Wissenschaft) Niederösterreich Bibliographie 2008 mit Nachträgen aus früheren Jahren Aus dem Zuwachs der NÖ Landesbibliothek erstellt von Gebhard K ö n i g 1. AB-Stimmen: kleine Wahlfibel für Jung- und Erstwähler/innen / [Hrsg.: Amt der NÖ Landesregierung]. - Sankt Pölten : NÖ Landtag, 2008. - [10] S. : zahlr. Ill. – (Mitteilungen aus Niederösterreich ; 2008, 1) Deskriptoren: Niederösterreich ; Landtagswahl ; Anleitung Sign.: 40.591 B 2008,1 2. Adelige Macht und Religionsfreiheit: 1608 - 400 Jahre der Horner Bund ; Sonderausstellung Museen der Stadt Horn 2008/2009 / [Katalog: Toni Kurz ...]. - Horn : Stadtgemeinde Horn, Museen der Stadt Horn, 2008. - 304 S. : zahlr. Ill., Kt. Deskriptoren: Habsburger ; Erblande ; Religionskrieg ; Geschichte 1570-1630 ; Ausstellung / Horn <Niederösterreich, 2008> # Horn <Niederösterreich> ; Adel ; Alltag ; Krieg ; Geschichte 1600-1630 ; Ausstellung / Horn <Niederösterreich, 2008> # Horner Bund ; Geschichte ; Ausstellung / Horn <Niederösterreich, 2008> Sign.: 122.431 B 3. "Ah, das dalkete dencken is wircklich was dumms": 1. - 5. Juli 2006 Schwe- chat ; Raimund und Nestroy im Kontext internationaler Lachkultur / [Internatio- nale Nestroy-Gesellschaft]. - Schwechat : Intern. Nestroy-Zentrum, 2006. - [40] Bl. – (Internationale Nestroy-Gespräche ; 32) Deskriptoren: Nestroy, Johann ; Kongress / Schwechat <2006> Sign.: 108.618 C 32 4. Aichinger, Josef: Imago dei: ich bin der Herr, dein Gott ... ; Klangraum Krems Minoritenkirche, 2. März - 24. März 2008 / [Texte: J. Aichinger ; R. -
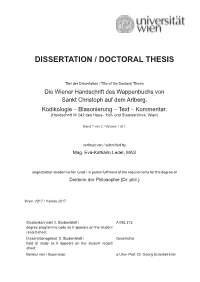
Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation / Title of the Doctoral Thesis Die Wiener Handschrift des Wappenbuchs von Sankt Christoph auf dem Arlberg. Kodikologie – Blasonierung – Text – Kommentar. (Handschrift W 242 des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien) Band 1 von 2 / Volume 1 of 2 verfasst von / submitted by Mag. Eva-Katharin Ledel, MAS angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 092 312 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Geschichte field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: o.Univ.-Prof. Dr. Georg Scheibelreiter Vorwort Vor über zwanzig Jahren wurde der Grundstein für diese Arbeit gelegt. Frau Hon.-Prof. Dr. Chri- stiane Thomas (1938–1997), Archivarin am Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien, hat im Rahmen einer, in den Räumen des Archivs gehaltenen Vorlesung, das „Wappenbuchs von St. Christoph am Arlberg“ gezeigt. Ehrfurchtsvoll standen wir Studenten vor dieser Kostbarkeit. Nach weiteren Gesprächen gab Frau Dr. Thomas die Anregung, diese Handschrift einer genauen Bearbeitung zu unterziehen. Mein Interesse an „Heraldik und Sphragistik“ war seit der Vorlesung von Herrn o.Univ.-Prof. Dr. Georg Scheibelreiter gegeben, und so lagen Thema und Betreuung dankenswer- terweise nah beieinander. Daß Frau Dr. Thomas nur wenig später den Kampf gegen eine schwere Krankheit verlor, war sehr schmerzlich. Ihr enormes Wissen und ihre profunde Kenntnis des Akten- und Urkundenma- terials, gepaart mit ihrer Bereitschaft, dieses Wissen auch weiterzugeben, waren bis zuletzt eine große Bereicherung und Unterstützung.