Restitutionsbericht Universalmuseum Joanneum, Graz 2010.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Modernisierung Kraftwerk Rosenburg Einreichprojekt Zum UVP-Verfahren
evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H. EVN-Platz 2344 Maria Enzersdorf Modernisierung Kraftwerk Rosenburg Einreichprojekt zum UVP-Verfahren DOKUMENTBEZEICHNUNG Umweltverträglichkeitserklärung Zusammenfassung gem. § 6 UVP-G 2000 C B ÄNDERUNG A KOORDINATION BEHÖRDE AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr Abteilung Umwelt- und Energierecht 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 FACHLICHE BEARBEITUNG KONSENSWERBERIN evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H EVN-Platz 2344 Maria Enzersdorf Dokument EINLAGE Erstellt: DI Stefanie Enengel Datum: 19.06.2017 BERICHT D.1.1 Geprüft: DI Thomas Knoll Datum: 18.04.2018 Bericht Umweltverträglichkeitserklärung Modernisierung Kraftwerk Rosenburg Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung ......................................................................................................................................... 6 1.1 Konsenswerberin ................................................................................................................................... 6 1.2 Veranlassung und Zweck ....................................................................................................................... 6 1.3 Struktur der Einreichunterlagen ............................................................................................................. 6 1.4 Abkürzungen, Glossar ............................................................................................................................ 7 2 Beschreibung des Vorhabens .................................................................................................................... -

The University of Chicago Objects of Veneration
THE UNIVERSITY OF CHICAGO OBJECTS OF VENERATION: MUSIC AND MATERIALITY IN THE COMPOSER-CULTS OF GERMANY AND AUSTRIA, 1870-1930 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE HUMANITIES IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF MUSIC BY ABIGAIL FINE CHICAGO, ILLINOIS AUGUST 2017 © Copyright Abigail Fine 2017 All rights reserved ii TABLE OF CONTENTS LIST OF MUSICAL EXAMPLES.................................................................. v LIST OF FIGURES.......................................................................................... vi LIST OF TABLES............................................................................................ ix ACKNOWLEDGEMENTS............................................................................. x ABSTRACT....................................................................................................... xiii INTRODUCTION........................................................................................................ 1 CHAPTER 1: Beethoven’s Death and the Physiognomy of Late Style Introduction..................................................................................................... 41 Part I: Material Reception Beethoven’s (Death) Mask............................................................................. 50 The Cult of the Face........................................................................................ 67 Part II: Musical Reception Musical Physiognomies............................................................................... -

Hartmut Boockmann 1934-1998
__________________________________________________ MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN JAHRGANG 8 (1998) NR. 2 MITTEILUNGEN DER RESIDENZEN-KOMMISSION DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU GÖTTINGEN JAHRGANG 8 (1998) NR. 2 RESIDENZEN-KOMMISSION ARBEITSSTELLE KIEL ISSN 0941-0937 Herstellung: Vervielfältigungsstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Titelvignette: Blick auf die Neue Burg mit Denkmal Prinz Eugens am Heldenplatz (© Österreich Werbung) INHALT Hartmut Boockmann 1934-1998 ...................................................................................5 Auswahlbibliographie Hartmut Boockmann........................................................9 Aus der Arbeit der Kommission ................................................................................ 15 Schriftenverzeichnis Karl-Heinz SPIESS ............................................................ 19 Die Arbeit der anderen .............................................................................................. 24 Jeroen DUINDAM, Utrecht: The court of the Austrian Habsburgs: locus of a com- posite heritage .................................................................................................. 24 Cordula NOLTE, Greifswald: Studien zum familialen und verwandtschaftlichen Beziehungsnetz der Markgrafen von Brandenburg (Projektskizze).................... 59 Kolloquiumsberichte................................................................................................. 65 6. Symposium der Residenzenkommission -

How Republic of Austria V. Altmann and United States V. Portrait of Wally Relay the Past and Forecast the Future of Nazi Looted Art Restitution Litigation Shira T
William Mitchell Law Review Volume 34 | Issue 3 Article 6 2008 How Republic of Austria v. Altmann and United States v. Portrait of Wally Relay the Past and Forecast the Future of Nazi Looted Art Restitution Litigation Shira T. Shapiro Follow this and additional works at: http://open.mitchellhamline.edu/wmlr Recommended Citation Shapiro, Shira T. (2008) "How Republic of Austria v. Altmann and United States v. Portrait of Wally Relay the Past and Forecast the Future of Nazi Looted Art Restitution Litigation," William Mitchell Law Review: Vol. 34: Iss. 3, Article 6. Available at: http://open.mitchellhamline.edu/wmlr/vol34/iss3/6 This Note is brought to you for free and open access by the Law Reviews and Journals at Mitchell Hamline Open Access. It has been accepted for inclusion in William Mitchell Law Review by an authorized administrator of Mitchell Hamline Open Access. For more information, please contact [email protected]. © Mitchell Hamline School of Law Shapiro: How Republic of Austria v. Altmann and United States v. Portrait 5. SHAPIRO - ADC 4/30/2008 3:15:48 PM CASE NOTE: HOW REPUBLIC OF AUSTRIA V. ALTMANN AND UNITED STATES V. PORTRAIT OF WALLY RELAY THE PAST AND FORECAST THE FUTURE OF NAZI LOOTED- ART RESTITUTION LITIGATION Shira T. Shapiro† I. INTRODUCTION....................................................................1148 II. THE BASIS FOR NAZI LOOTED-ART LITIGATION: HITLER’S CULTURAL OBSESSION.........................................................1150 III. THE UNITED STATES V. PORTRAIT OF WALLY, A PAINTING BY EGON SCHIELE LITIGATION ...................................................1154 IV. THE REPUBLIC OF AUSTRIA V. ALTMANN DECISION: RECLAIMING GUSTAV KLIMT................................................1159 A. Initiation of Legal Proceedings........................................ -

Leseproben VON SCHLOSS ZU SCHLOSS
Leseproben VON SCHLOSS ZU SCHLOSS Teil 1 – Schlossbeschreibungen (a) SCHLOSSBESCHREIBUNGEN BEZIRK JUDENBURG ( ) Allerheiligen – siehe Tiefenbach / Pölstal 1. Admontbichl 2. Authal 3. Eppenstein 4. Farrach 5. Fohnsdorf 6. Frauenburg 7. Gabelhofen 8. Grubhofen im Feeberggraben 9. Gusterheim 10. Hanfelden 11. Die Burgen in Judenburg 12. Liechtenstein 13. Neuliechtenstein 14. Offenburg 15. Pichlhofen 16. Rattenberg 17. Reifenstein 18. Rosenbach 19. Rothenthurm 20. St. Georgen am Schwarzenbach ( ) Sauerbrunn und die Sternschanze – siehe Thalheim ( ) Steirerschlössl – siehe Thalheim 21. Strettweg 22. Thalheim (Sauerbrunn) und die Sternschanze 23. Thann 24. Tiefenbach - Allerheiligen 25. Thorhof 26. Weissenthurn 27. Weyer 28. Schloss Propstei Zeiring 1. Admontbichl, unbewohntes Schloss Ausgangsort: Judenburg. Entfernung: Judenburg / Obdach = 17 km. Wo es steht: In Obdach, Ortsteil Rötsch, auf einem kleinen Hügel westlich der Durchfahrtsstraße durch Rötsch - trotz der Tafel „nur für Anrainer“, zur Besichtigung problemlos zu befahren. Kombinierbar mit dem Ort Obdach, Schloss Rosenbach, St. Georgen im Obdachegg (Wanderung 37), der Ruine Eppenstein (Wanderung 6), Schloss und Ruine Liechtenstein (Wanderung 27) und den Wanderungen Nr. 16, 22, 29, 40, 54, 57. Das Benediktinerstift Admont war bereits 1160 um Obdach begütert und besaß unter anderem ein Grundstück, auf dem später der „Mereinhof zu Pichl“ entstand. Er wurde 1367 befestigt und ist heute ein einstöckiger Vierkantbau mit Torturm. Ab 1599 war er Sitz der Propsteiverwaltung und diente bei Gefahr als Zuflucht für die Bevölkerung. Um 1617 war hier auch der Sitz des Landgerichts für das Stift Admont. Als Verwalter traten im 15. und 16. Jh. die Kainacher, die Zach und die Gallenberger auf. Sein heutiges Aussehen erhielt Admontbichl unter dem Propst Ritter Daniel von Gallenberg zwischen 1530 und 1587. -

Download (4Mb)
Inhaltsverzeichnis Abkürzungen 3-4 Einleitung 5-7 1. Die Landherren von *Werde 1.1. Die Anfänge der Herren von *Werde bis 1222 und der Adelssitz *Werde 7-19 1.2. Die zweite Generation : Hadmar I. und Chadold I. (1244 bis 1271) 19-30 1.3. Die dritte Generation : Hadmar II., Chadold II. und Leutwin (1263 bis 1297) 30-39 1.4. Die vierte Generation : Konrad II. und seine Cousins Gundaker I., Heinrich und Chadold III. von Werde (1289 bis 1322) 39-46 1.5. Die fünfte Generation : die Brüder Gundakar II. und Chadold V., ihr Cousin Gundaker III. und ihr zweitgradiger Cousin Konrad III. von Werde 46-52 2. Die Landherren von Winkl 2.1. Anfänge und frühe Geschichte bis 1225 52-60 2.2. Ortlieb IV. von Winkl (1234 bis 1270/71) 60-62 2.3. Die Brüder Ortlieb V. von Winklberg und Hadmar I. von Winkl (1271 bis 1324) 63-75 2.4. Die Brüder Ortlieb VI., Weikhard und Albero und ihre Cousins Ortlieb VII. und Hadmar II. von Winkl 75-79 3. Resumee 79-83 4. Schlussbetrachtung 83-84 5. Anhang zu den Herren von *Werde 5.1. Regesten 85-113 5.2. Genealogische Tafel und Siegel 114-116 6. Anhang zu den Herren von Winkl 6.1. Regesten 117-150 6.2. Genealogische Tafel und Siegel 151-153 7.1. Karte der Besitzungen und Gefolgsleute zwischen 1208 und 1271 154 7.2. Karte der Besitzungen und Gefolgsleute zwischen 1276 und 1316 155 8. Quellenverzeichnis 156-164 9. Literaturverzeichnis 165-170 10.1. Zusammenfassung 171-172 10.2. -

Universalmuseum Joanneum (Graz,11-12 Mar 10)
Ein Museum erfindet sich neu: Universalmuseum Joanneum (Graz,11-12 Mar 10) Schatz Elisabeth Workshop "Ein Museum erfindet sich neu. Die Entwicklung eines Corporate Design am Beispiel des Universalmuseum Joanneum" 11.-12.3.2010 l Heimatsaal, Paulustorgasse 13a, 8010 Graz (A) Voranmeldungen sind schon jetzt per Mail an [email protected], oder per Fax +43 (0)316/8017-9808 möglich! Seit 2003 erneuert sich das Landesmuseum Joanneum in Graz mit einem vorläufigen Höhepunkt der Umbenennung in "Universalmuseum" und der Schaffung eines vollkommen neuen Corporate Design 2009. Gleichzeitig werden mehrere große und zentrale Sammlungen und deren Dauerausstellungen erneuert, an neuen Standorten oder auch in neuen Architekturen gezeigt. Diese 'Neuerfindung' soll exemplarisch für Modernisierungsprozesse von Museen insgesamt dargestellt und untersucht werden. Mit Augenmerk sowohl für die Wechselbeziehung von Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Corporate Identity und Corporate Design einerseits und inhaltlicher Erneuerung andererseits. Es geht in der Veranstaltung aber auch um die praktische Seite, um Produktion und Umsetzung. Am konkreten Beispiel sollen die Entscheidungen, die Produkte und Projekte vorgestellt, erläutert und diskutiert werden, aus denen eine solche 'Rundumerneuerung' zusammengesetzt ist. Die Beteiligten berichten über den Planungs- und Umsetzungsprozess, über die Ergebnisse, über erste Erfahrungen mit den entwickelten Produkten und über den ideellen und strategischen Hintergrund. Mit Dr. Wolfgang Muchitsch Direktor Universalmuseum -
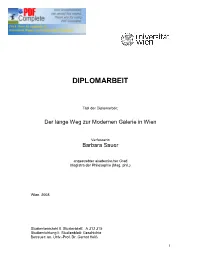
Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit: Der lange Weg zur Modernen Galerie in Wien Verfasserin Barbara Sauer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte Betreuer: ao. Univ.-Prof. Dr. Gernot Heiß 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung.....................................................................................................................5 2 Quellen und Literatur .............................................................................................. 10 3 Österreich: Bildende Kunst und Museen .............................................................. 14 3.1 Die Akademie der Bildenden Künste...................................................................... 15 3.1.1 Gründung und Frühzeit der Akademie ....................................................... 15 3.1.2 Organisation und Kunstbehörde .................................................................. 15 3.1.3 Die Ära Metternich ......................................................................................... 17 3.1.4 1848 und die Folgen ....................................................................................... 20 3.1.5 Neues Statut und Neubau ............................................................................. 22 3.1.6 Die Akademiegalerie ...................................................................................... 23 3.2 Das Unterrichtsministerium ................................................................................. -

Goings Ralph
LOUIS K. MEISEL GALLERY RALPH GOINGS Biography Updated: 2/14/20 BORN 1928 Corning, CA EDUCATION 1965 Sacramento State College, Sacramento, CA; M.F.A. 1953 California College of Arts and Crafts, Oakland, CA; B.F.A. SOLO EXHIBITIONS 2005 Great Goings: Vintage Pick-up Trucks and Diner Paintings, Louis K. Meisel Gallery, New York, NY 2004 Ralph Goings: Four Decades of Realism, The Butler Institute of American Art, Youngstown, OH 2003 Ralph Goings: Paintings & Watercolors, Vintage & Current Works, Bernarducci Meisel Gallery, New York, NY 1997 Ralph Goings: Photorealism, Solomon Dubnick Gallery, Sacramento, CA 1996 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1994 Ralph Goings, A Retrospective View of Watercolors: 1972-1994, Jason McCoy Inc., New York, NY 1991 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1988 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1985 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1983 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1980 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1977 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1973 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 141 Prince Street, New York, NY 10012 | T: 212 677 1340 | F: 212 533 7340 | E: [email protected] LOUIS K. MEISEL GALLERY 1970 O.K. Harris Works of Art, New York, NY 1968 Artists CooperatiVe Gallery, Sacramento, CA 1962 Artists CooperatiVe Gallery, Sacramento, CA 1960 Artists CooperatiVe Gallery, Sacramento, CA GROUP EXHIBITIONS 2019 Reality Check: Photorealist Watercolors, Herbert F. Johnson Museum, Cornell UniVersity, Ithaca, NY, April 27 – July 28 50 Years of Realism, Centro Cultural Center Bank of Brazil, Rio de Janeiro, May 22 – July 29 2017-18 From Lens to Eye to Hand: Photorealism 1969 to Today, traVeling exhibition: Parrish Art Museum, Water Mill, NY August 6, 2017 – Jan. -

Malakologisches Aus Dem Ostalpenraum
© Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 24/2 383-662 31.12.1992 Malakologisches aus dem Ostalpenraum C. FRANK Herrn Hofrat Dir. Dr. Oliver E. PAGET zu seinem 70. Geburtstag im April 1992 herzlich gewidmet. Ab s t r a c t: About Mollusca of the Eastern Alpine Region. This malacological study comprises a large area of the Eastern Alpine Region. At first, it summarizes the most important malacological papers since KLEMMs monography appeared (1974a). Vegetation, geology and hydrography of the investigated area are characterized, and the 146 localities are described, arranged in 23 larger territories, mainly in Austria. 188 species and subspecies of mollusca have been recorded. Their ecology, biology and distribution, particularly in Austria, are discussed. Each local fauna is represented with a species and individual spectrum. The systematic position and zoogeographical patterns of peculiar species are reviewed. Key words: Mollusca (Gastropoda, Bivalvia), Eastern Alpine Region, Ecology, Distribution Inhalt Einleitung 384 Kommentierte bibliographische Übersicht 385 Material und Methoden Untersuchungsgebiet Vegetation und Geologie 398 Hydrographie 403 Fundorte 413 Methoden 423 Ergebnisse Faunistik Cyclophoracea 425 Valvatacea 429 Truncatellacea 429 EUobiacea 435 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at 384 Planorbacea . 435 Lymnaeacea 436 Cochlicopacea 438 Pupillacea 439 Buliminacea 454 Claustliacea 455 Succineacea 466 Achatinacea 468 Punctacea 468 Gastrodontacea 470 Euconulacea 470 Vitrinacea 471 Limacacea 482 Arionacea 485 Helicacea 486 Sphaeriacea 506 Die Molluskengemeinschaften 509 Zoogeographische Gruppen 594 Zusammenfassung und Diskussion 596 Dank 614 Literatur..... 615 Register 635 Anhang 651 Einleitung KLEMM (1974a) gibt neben einer umfassenden Literaturübersicht (S. 486- 492) auch eine Darstellung des damaligen Erforschungsstandes der österrei- chischen Bundesländer (S. -

№ Wca № Castles Prefix Name of Castle Oe-00001 Oe-30001
№ WCA № CASTLES PREFIX NAME OF CASTLE LOCATION INFORMATION OE-00001 OE-30001 OE3 BURGRUINE AGGSTEIN SCHONBUHEL-AGGSBACH, AGGSTEIN 48° 18' 52" N 15° 25' 18" O OE-00002 OE-20002 OE2 BURGRUINE WEYER BRAMBERG AM WILDKOGEL 47° 15' 38,8" N 12° 19' 4,7" O OE-00003 OE-40003 OE4 BURG BERNSTEIN BERNSTEIN, SCHLOSSWEG 1 47° 24' 23,5" N 16° 15' 7,1" O OE-00004 OE-40004 OE4 BURG FORCHTENSTEIN FORCHTENSTEIN, MELINDA-ESTERHAZY-PLATZ 1 47° 42' 34" N 16° 19' 51" O OE-00005 OE-40005 OE4 BURG GUSSING GUSSING, BATTHYANY-STRASSE 10 47° 3' 24,5" N 16° 19' 22,5" O OE-00006 OE-40006 OE4 BURGRUINE LANDSEE MARKT SANKT MARTIN, LANDSEE 47° 33' 50" N 16° 20' 54" O OE-00007 OE-40007 OE4 BURG LOCKENHAUS LOCKENHAUS, GUNSERSTRASSE 5 47° 24' 14,5" N 16° 25' 28,5" O OE-00008 OE-40008 OE4 BURG SCHLAINING STADTSCHLAINING 47° 19' 20" N 16° 16' 49" O OE-00009 OE-80009 OE8 BURGRUINE AICHELBURG ST. STEFAN IM GAILTAL, NIESELACH 46° 36' 38,6" N 13° 30' 45,6" O OE-00010 OE-80010 OE8 KLOSTERRUINE ARNOLDSTEIN ARNOLDSTEIN, KLOSTERWEG 3 46° 32' 55" N 13° 42' 34" O OE-00011 OE-80011 OE8 BURG DIETRICHSTEIN FELDKIRCHEN, DIETRICHSTEIN 46° 43' 34" N 14° 7' 45" O OE-00012 OE-80012 OE8 BURG FALKENSTEIN OBERVELLACH-PFAFFENBERG 46° 55' 20,4" N 13° 14' 24,6" E OE-00014 OE-80014 OE8 BURGRUINE FEDERAUN VILLACH, OBERFEDERAUN 46° 34' 12,6" N 13° 48' 34,5" E OE-00015 OE-80015 OE8 BURGRUINE FELDSBERG LURNFELD, ZUR FELDSBERG 46° 50' 28" N 13° 23' 42" E OE-00016 OE-80016 OE8 BURG FINKENSTEIN FINKENSTEIN, ALTFINKENSTEIN 13 46° 37' 47,7" N 13° 54' 11,1" E OE-00017 OE-80017 OE8 BURGRUINE FLASCHBERG OBERDRAUBURG, -

29Th 2017 in Schloss Eggenberg, Graz Austria
Light & Glass Yearly Meeting April 27th - 29th 2017 in Schloss Eggenberg, Graz Austria Shining a Light, Light – Culture – History Together with our host Paul Schuster, we present our Program of Lectures: STAGING OF LIGHT / INSZENIERUNG. John Smith, formerly Malletts, London GB: "Country House Lighting in the 18th Century Britain - The Ascendency of Glass" Siegrun Appelt, Slow Light etc. Vienna, Austria: „Licht im Zeitalter der Industrialisierung” (Light in the Industrial Age) Indre Uzuotaite, Vilnius, Lithuania: "Servant of the Chandelier - Mirrors as Lighting Device" Tereza Svachova / Peter Rath, “Eliaska Project, Progress to date” RADIATING LIGHT / DAS OBJEKT Käthe Klappenbach, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam, Germany: "Kristall-Kronleuchter für den Preußischen König Friedrich II" Angela Gräfin von Wallwitz, Munich, Germany: "An Outstanding and Important Pair of Large Ormolu Wall Lights" Ingrid Thom-Stricker ,Restauratorin für Kunsthandwerk, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen: "Die Luster in der Residenz Bamberg" Maria Joao Burnay, Glass Collection Curator, Palacio Nacional da Ajuda, Lisbon, Portugal: “Romantic lighting and ambiances. Chandeliers and wall lights in the Palacio da Ajuda.” Susanne Carp + Susanne Conrad, LVR_Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Germany : "Die Laterne im Prunktreppenhaus von Schloss Augustenberg in Brühl" Jan Mergl, Deputy Director Scientific Work, West Bohemian Museum, Pilsen CZ, “Beleuchtungskörper auf der Wiener-Ausstellungen 1900-1918