Rück- Und Ausblick
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

LIST of WORKS in the EXHIBITION Dance of Hands
LIST OF WORKS IN THE EXHIBITION Dance of Hands. Tilly Losch and Hedy Pfundmayr in Photographs 1920 ─1935 November 14, 2014–February 15, 2015 Rupertinum Works are listed in alphabetical order according to artist’s names and in chronological order. Works indicated in italics are authorized titles, otherwise a descriptive title is used. Height proceeds width proceeds depth. Anonymous Salzburg Festival 1926, 1926 Film, 16mm (black and white, silent) transferred to digital video disc 14:25 min. This film is stored at Bundesarchiv-Filmarchiv Berlin Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu—A Symphony of Horror , 1922 Max Schreck as Nosferatu Frame enlargement Silver gelatin print (vintage print) 6.8 x 9 cm Austrian Film Museum, Vienna Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu—A Symphony of Horror , 1922 Wolfgang Heinz as Nosferatu and Max Schreck as Maat Film still Silver gelatin print (vintage print) 10.2 x 12.4 cm Austrian Film Museum, Vienna Robert Wiene The Hands of Orlac , 1924 Conrad Veidt as Paul Orlac and Alexandra Sorina as Yvonne Orlac Film still Silver gelatin print (vintage print) 21.1 x 27 cm Austrian Film Museum, Vienna Robert Wiene The Hands of Orlac , 1924 Conrad Veidt as Paul Orlac and Fritz Kortner as Nera Film still 1/21 Dance of Hands_List of works Silver gelatin print (vintage print) 21.3 x 27.4 cm Austrian Film Museum, Vienna Robert Wiene The Hands of Orlac , 1924 Conrad Veidt as Paul Orlac Silver gelatin print Photo: 17,6 x 23,6 cm Theatermuseum, Vienna Gustav Ucicky Pratermizzi , 1926 Hedy Pfundmayr as double of the dancer Valette -

Reviews of This Artist
Rezension für: Hertha Klust Pilar Lorengar: A portrait in live and studio recordings from 1959-1962 Vincenzo Bellini | Giacomo Puccini | Georg Friedrich Händel | Enrique Granados | Alessandro Scarlatti | Wolfgang Amadeus Mozart | Giuseppe Verdi | Joaquín Rodrigo | Joaquín Nin | Jesús García Leoz | Jesús Guridi | Eduardo Toldrà | _ Anonym | Jacobus de Milarte | Esteban Daza | Juan Bermudo | Luis de Narváez | Juan Vásquez | Alonso Mudarra | Luis de Milán | Diego Pisador | Enríquez de Valderrábano 3CD aud 21.420 operafresh.blogspot.de Tuesday, May 20, 2014 ( - 2014.05.20) Pilar Lorengar Live and Studio Recordings 1959-1962 Berlin In addition to the live opera recordings on this release, is the famous studio recording of songs with guitar featuring Siegfried Behrend available for the first time on CD outside of Japan. Full review text restrained for copyright reasons. Das Opernglas Juni 2014 (J. Gahre - 2014.06.01) CD News Ihre Stimme [strahlt] in diesen um 1960 gemachten Aufnahmen Wärme und Weiblichkeit aus, die den modernen Hörer durchaus gefangen nehmen können. Full review text restrained for copyright reasons. page 1 / 96 »audite« Ludger Böckenhoff • Tel.: +49 (0)5231-870320 • Fax: +49 (0)5231-870321 • [email protected] • www.audite.de http://theaterpur.net Juni 2014 (Christoph Zimmermann - 2014.06.01) Tenorales Gruppenbild mit Damen Pilar Lorengars klares, sonnenhelles Organ lässt nirgends falsche Sentimentalität aufkommen. [...] Neuerlich bezaubert die Natürlichkeit der Darstellung ohne ein demonstratives Ausstellen vokaler Raffinessen. Full review text restrained for copyright reasons. Der Tagesspiegel 22.07.2014 (Frederik Hanssen - 2014.07.22) Klassik-CD der Woche: Pilar Lorengar Spanische Nächte Die Norma wie auch „Piangerò la sorte mia“ aus Händels „Giulio Cesare“ meistert sie mit Eleganz, jugendlicher Strahlkraft und schier endlosem Atem Full review text restrained for copyright reasons. -

Eberhard Waechter“
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Eberhard Waechter“ Verfasserin Mayr Nicoletta angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl: A 317 Studienrichtung: Theater-, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin: Univ.-Prof.Dr. Hilde Haider-Pregler Dank Ich danke vor allem meiner Betreuerin Frau Professor Haider, dass Sie mir mein Thema bewilligt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich danke der Familie Waechter und Frau Anneliese Sch. für die Bereitstellung des Materials. Ich danke meiner Schwester Romy und meiner „Seelenverwandten“ Sheila und all meinen Freunden für ihre emotionale Unterstützung und die zahlreichen motivierenden Gespräche. Ich danke meinem Bruder Florian für die Hilfe im Bereich der Computertechnik. Ein großer Dank gilt meiner Tante Edith, einfach dafür, dass es dich gibt. Außerdem danke ich meinen Großeltern, dass sie meine Liebe zur Musik und zur Oper stets enthusiastisch aufgenommen haben und mit mir Jahr für Jahr die Operettenfestspiele in Bad Ischl besucht haben. Ich widme meine Diplomarbeit meinen lieben Eltern. Sie haben mich in den letzten Jahren immer wieder finanziell unterstützt und mir daher eine schöne Studienzeit ermöglicht haben. Außerdem haben sie meine Liebe und Leidenschaft für die Oper stets unterstützt, mich mit Büchern, Videos und CD-Aufnahmen belohnt. Ich danke euch für eure Geduld und euer Verständnis für eure oft komplizierte und theaterbessene Tochter. Ich bin glücklich und froh, so tolle Eltern zu haben. Inhalt 1 Einleitung .......................................................................................... -
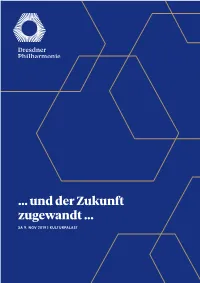
Programmheft (PDF 2.3
… und der Zukunft zugewandt … SA 9. NOV 2019 | KULTURPALAST Spartacus FR 29. NOV 2019 | 19.30 Uhr SA 30. NOV 2019 | 19.30 Uhr KULTURPALAST TSCHAIKOWSKI ›Manfred‹-Sinfonie h-Moll PROKOFJEW Violinkonzert Nr. 2 g-Moll CHATSCHATURJAN Auszüge aus dem Ballett ›Spartacus‹ DMITRIJ KITAJENKO | Dirigent SERGEJ KRYLOV | Violine DRESDNER PHILHARMONIE Tickets 39 | 34 | 29 | 23 | 18 € [email protected] dresdnerphilharmonie.de 9 € Schüler, Studenten © Klaus Rudolph PROGRAMM 17.00 Uhr, Konzertsaal Musik – Demokratie – Europa Harald Muenz (* 1965) [ funda'men de'nit ] per dieci voci, für zehn Stimmen, para diez voces, for ten voices, pour dix voix auf Textauszüge aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (1949) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000), eingerichtet vom Komponisten (2019) Stefan Beyer (* 1981) »Vi« für Vokalensemble und Elektronik (2019) Hakan Ulus (* 1991) »Auslöschung II« für zehn Stimmen (2019) Chatori Shimizu (* 1990) »Rightist Mushrooms« für zehn Stimmen (2019) Fojan Gharibnejad (* 1995) Zachary Seely (* 1988) »hēmi« für zehn Sänger (2019) Olaf Katzer | Leitung AUDITIVVOKAL DRESDEN Die fünf Werke entstanden im Auftrag von AUDITIVVOKAL DRESDEN und erklingen als Urauührungen. PROGRAMM 18.30 Uhr, Konzertsaal I have a dream Kurzeinführung: Zeitzeugen im Gespräch mit Jens Schubbe Friedrich Schenker (1942 – 2013) Sinfonie »In memoriam Martin Luther King« (1969/70) Sehr langsam – Schnell – Ruhige Halbe (in der Art eines Chorals) – Tempo I Schnell und rigoros – Langsam – Ruhig ießend – Tempo I Jonathan -
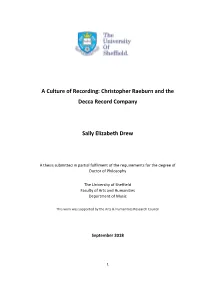
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company Sally Elizabeth Drew A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Sheffield Faculty of Arts and Humanities Department of Music This work was supported by the Arts & Humanities Research Council September 2018 1 2 Abstract This thesis examines the working culture of the Decca Record Company, and how group interaction and individual agency have made an impact on the production of music recordings. Founded in London in 1929, Decca built a global reputation as a pioneer of sound recording with access to the world’s leading musicians. With its roots in manufacturing and experimental wartime engineering, the company developed a peerless classical music catalogue that showcased technological innovation alongside artistic accomplishment. This investigation focuses specifically on the contribution of the recording producer at Decca in creating this legacy, as can be illustrated by the career of Christopher Raeburn, the company’s most prolific producer and specialist in opera and vocal repertoire. It is the first study to examine Raeburn’s archive, and is supported with unpublished memoirs, private papers and recorded interviews with colleagues, collaborators and artists. Using these sources, the thesis considers the history and functions of the staff producer within Decca’s wider operational structure in parallel with the personal aspirations of the individual in exerting control, choice and authority on the process and product of recording. Having been recruited to Decca by John Culshaw in 1957, Raeburn’s fifty-year career spanned seminal moments of the company’s artistic and commercial lifecycle: from assisting in exploiting the dramatic potential of stereo technology in Culshaw’s Ring during the 1960s to his serving as audio producer for the 1990 The Three Tenors Concert international phenomenon. -

Opernverzeichnis
Opernverzeichnis L'abandon d'Ariane 284 Der Bajazzo 230 Christophorus 440 Abend, Nacht und Morgen 92 Die Bajuwaren 229 DerCid 262 Der Abenteurer 53 Der Barbier von Bagdad 97 Circe 129 Das abgebrannte Haus 184 Der Barbier von Sevilla (Paisiello) 353 LaclemenzadiTito 219 Die Abreise 28 Der Barbier von Sevilla (Rossini) 413 Columbus 129 Abstrakte Oper No. 1 63 Der Bärenhäuter 630 II combattimento di Tancredi e Clo- Abu Hassan 632 Die Bassariden 190 rinda 292 Acis und Galathea (Händel) 183 Bastian der Faulpelz 73 Le convenienze 117 Acis und Galathea (Haydn) 185 Bastien und Bastienne 296 Der Corregidor 655 Admetos 180 LaBattaglia 654 Cosifantutte 316 Adone 356 Beatrice Cenci 152 The cry of Clytaemnestra 124 Adriana Lecouvreur 94 Beatrice et Benedict 52 Curlew River 75 Die Afrikanerin 281 Die beiden Foscari 511 Cyrano de Bergerac 30 Agrippina 177 Die beiden Schützen 239 Czinkapanna 222 Die ägyptische Helena 472 Der bekehrte Trunkenbold 162 Aida 548 Belfagor 400 Dafne(Peri) 12 Albert Herring 78 Belsazar 183 Dalibor 443 Alceste 157 Benvenuto Cellini 51 Ladamaboba 661 Alcina 182 Bergsee 53 Dame Kobold 652 Alessandro 179 Das Bergwerk zu Falun 631 Danton und Robespierre 124 Alessandro Stradella 141 Die Bernauerin 348 Dantons Tod 134 Alexander 179 Der Besuch der alten Dame 135 Daphne 479 Alkmene 220 Der betrogene Kadi 162 David 287 Almira 176 Bettler Namenlos 187 DeboraeJaele 362 Die alte Jungfer und der Dieb 271 Die Bettleroper 78 Deidamia 182 Amahl und die nächtlichen Besu- Billy Budd 79 La delivrance de Thesee 284 cher 275 Blackwood & Co. 424 Demetrius (Dvof äk) 120 Amelia geht auf den Ball 271 Das Blut des Volkes 123 Lesdeuxjournees 91 L'amore di tre re 289 Die Bluthochzeit (Castro) 87 Dido und Aeneas 395 An diesem heutigen Tag 191 Bluthochzeit (Fortner) 143 Der Diktator 225 Anacreon 90 Bodas de sangre 87 Dinorah 280 Andre Chenier 150 Le boeuf sur le toit 284 Djamileh 55 Andromeda und Perseus (Ibert) 214 La Boheme (Leoncavallo) 230 Doktor Faust (Busoni) 85 Angelique 214 La Boheme (Puccini) 373 Dr. -

Bernard Coutaz Carlos Sandúa Las Músicas Del Agua La ONE Republicana Natalie Dessay Peter Donohoe Lado Ataneli Gaspard De La N
REVISTA DE MÚSICA Año XXIII - Nº 228 - Marzo 2008 - 6,50 € DOSIER Las músicas del agua ENCUENTROS ROLA Bernard Coutaz ND Carlos Sandúa C O ACTUALIDAD R V E IL Natalie Dessay A L N A Peter Donohoe D ZÓN Lado Ataneli O EM REPORTAJE OCIONES La ONE republicana Año XXIII - Nº 228 Marzo 2008 REFERENCIAS Gaspard de la nuit de Ravel INTERIORPORTADA FILM:SCHERZO 22/2/08 18:37 Página 1 1-16 FILM:SCHERZO 22/2/08 17:36 Página 1 AÑO XXIII - Nº 228 - Marzo 2008 - 6,50 € 2 OPINIÓN DOSIER Las músicas del agua CON NOMBRE José Luis Carles PROPIO y Cristina Palmese 113 6 Natalie Dessay Rafael Banús Irusta ENCUENTROS 8 Peter Donohoe Bernard Coutaz Bruno Serrou Emili Blasco 126 10 Lado Ataneli Carlos Sandúa Pablo J. Vayón Barbara Röder 132 12 AGENDA REPORTAJE La Orquesta Nacional 18 ACTUALIDAD Republicana NACIONAL Enrique Lacomba y Gúzman Urrero Peña 136 46 ACTUALIDAD INTERNACIONAL EDUCACIÓN Pedro Sarmiento 140 60 ENTREVISTA JAZZ Rolando Villazón Pablo Sanz 142 Juan Antonio Llorente LIBROS 144 64 Discos del mes LA GUÍA 146 65 SCHERZO DISCOS CONTRAPUNTO Norman Lebrecht 152 Sumario Colaboran en este número: Javier Alfaya, Julio Andrade Malde, Íñigo Arbiza, Emili Blasco, Alfredo Brotons Muñoz, José Antonio Cantón, José Luis Carles, Jacobo Cortines, Rafael Díaz Gómez, Pierre Élie Mamou, José Luis Fernández, Fernando Fraga, Germán Gan Quesada, Joaquín García, José Antonio García y García, Carmen Dolores García González, Juan García-Rico, José Guerrero Martín, Federico Hernández, Fernando Herrero, Bernd Hoppe, Paul Korenhof, Enrique Lacomba, Antonio Lasierra, Norman -

Central Opera Service Bulletin
CENTRAL OPERA SERVICE BULLETIN WINTER, 1972 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council Central Opera Service • Lincoln Center Plaza • Metropolitan Opera • New York, N.Y. 10023 • 799-3467 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council Central Opera Service • Lincoln Canter Plaza • Metropolitan Opera • New York, NX 10023 • 799.3467 CENTRAL OPERA SERVICE COMMITTEE ROBERT L. B. TOBIN, National Chairman GEORGE HOWERTON, National Co-Chairman National Council Directors MRS. AUGUST BELMONT MRS. FRANK W. BOWMAN MRS. TIMOTHY FISKE E. H. CORRIGAN, JR. CARROLL G. HARPER MRS. NORRIS DARRELL ELIHU M. HYNDMAN Professional Committee JULIUS RUDEL, Chairman New York City Opera KURT HERBERT ADLER MRS. LOUDON MEI.LEN San Francisco Opera Opera Soc. of Wash., D.C. VICTOR ALESSANDRO ELEMER NAGY San Antonio Symphony Ham College of Music ROBERT G. ANDERSON MME. ROSE PALMAI-TENSER Tulsa Opera Mobile Opera Guild WILFRED C. BAIN RUSSELL D. PATTERSON Indiana University Kansas City Lyric Theater ROBERT BAUSTIAN MRS. JOHN DEWITT PELTZ Santa Fe Opera Metropolitan Opera MORITZ BOMHARD JAN POPPER Kentucky Opera University of California, L.A. STANLEY CHAPPLE GLYNN ROSS University of Washington Seattle Opera EUGENE CONLEY GEORGE SCHICK No. Texas State Univ. Manhattan School of Music WALTER DUCLOUX MARK SCHUBART University of Texas Lincoln Center PETER PAUL FUCHS MRS. L. S. STEMMONS Louisiana State University Dallas Civic Opera ROBERT GAY LEONARD TREASH Northwestern University Eastman School of Music BORIS GOLDOVSKY LUCAS UNDERWOOD Goldovsky Opera Theatre University of the Pacific WALTER HERBERT GIDEON WALDKOh Houston & San Diego Opera Juilliard School of Music RICHARD KARP MRS. J. P. WALLACE Pittsburgh Opera Shreveport Civic Opera GLADYS MATHEW LUDWIG ZIRNER Community Opera University of Illinois See COS INSIDE INFORMATION on page seventeen for new officers and members of the Professional Committee. -

Friedrich Goldmann
© Astrid Karger Friedrich Goldmann Contemporary BIOGRAPHY Friedrich Goldmann Born in 1941 in Chemnitz, Friedrich Goldmann first studied at the Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt with Karlheinz Stockhausen in 1959. He went on to study composition in Dresden and Berlin until 1964. While still a student he became an assistant composer at Berliner Ensemble, where he met future collaborators Heiner Müller, Luigi Nono and Ruth Berghaus. Since the early 1970s Goldmann emerged as the leading exponent of a new music avant-garde in East Germany, and soon also became widely performed in West Germany and, subsequently, in Western Europe. His oeuvre includes numerous chamber works, four symphonies, four solo concertos, orchestral works and one opera. Around 1969 Goldmann developed a technique of composing with heterogenous layers, appropriating traditional forms (sonata, symphony etc.) and ‘breaking them open from within’ with new techniques. This allowed for highlighting the friction between divergent layers as a distinct aesthetic parameter, predating developments regarding the use of historical references and ‘multiple coding’. In the 1970s Goldmann developed a method of composition that holistically integrates the full range of formal possibilities of new music. He explored perceptual continuums and amalgamations, such as transitions between noise and tone, or chromatic and microtonal material. With parameter boundaries dissolving, he thus challenged the conventional concept of musical parameters as discrete entities. Goldmann received commissions from Berliner Philharmonie, Staatsoper Berlin, Semperoper Dresden and most radio symphony orchestras in Germany, with Konzerthaus Berlin, Wittener Tage Festival and Ensemble Modern being among his most frequent commissioners. Since 1980 he taught at Berlin’s Akademie der Künste and became professor of composition at Universität der Künste in Berlin in 1991. -

Wolfgang Fortner: a Catalogue of the Orchestral Music
WOLFGANG FORTNER: A CATALOGUE OF THE ORCHESTRAL MUSIC 1930: Suite for orchestra after Sweelinck: 20 minutes Cantata “Grenzen der Menschheit” for baritone, chorus and orchestra: 16 minutes 1932: Concerto for Organ and strings: 19 minutes Concerto for Harpsichord and string orchestra: 19 minutes 1933: Concerto for string orchestra: 22 minutes 1934: Concertino for Viola and chamber orchestra in G minor 1937: Sinfonia Concertante for orchestra: 25 minutes “Nuptiae Catulli” for tenor, chorus and chamber orchestra: 25 minutes 1939: Capriccio and Finale for orchestra: 15 minutes 1943: Piano Concerto 1946: Concerto for Violin and Chamber Orchestra: 23 minutes + (MDG, Andromeda and Audite cds) 1947: “Symphony 1947”: 27 minutes * + (Profil cd) Cantata “An die Nachgeborenen” for speaker, tenor, chorus and orchestra: 20 minutes 1948: “Zwei Exerzitien” for women’s chorus and chamber orchestra: 11 minutes 1949: Ballet “Der weisse Rose”: 45 minutes (and Ballet Suite: 40 minutes) 1950: “Phantasie uber die Tonfolge BACH” for two pianos and orchestra: 18 minutes 1951: Cello Concerto: 25 minutes Aria for mezzo-soprano or contralto, flute and chamber orchestra: 10 minutes 1952: “The Sacrifice of Isaac” for contralto, tenor, bass and forty instruments: 17 minutes Pantomime “Die Witwe von Ephesus”: 20 minutes 1953: “Mouvements” for Piano and orchestra: 25 minutes (also Ballet) 1954: “The Creation” for middle voice and orchestra: 20 minutes Italian Overture after Puccini “La Cecchina”: 10 minutes 1957: Impromptus for orchestra: 12 minutes (and “Klangvaration” -

General Index
Cambridge University Press 0521780098 - The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera Edited by Mervyn Cooke Index More information General index Abbate, Carolyn 282 Bach, Johann Sebastian 105 Adam, Fra Salimbene de 36 Bachelet, Alfred 137 Adami, Giuseppe 36 Baden-Baden 133 Adamo, Mark 204 Bahr, Herrmann 150 Adams, John 55, 204, 246, 260–4, 289–90, Baird, Tadeusz 176 318, 330 Bala´zs, Be´la 67–8, 271 Ade`s, Thomas 228 ballad opera 107 Adlington, Robert 218, 219 Baragwanath, Nicholas 102 Adorno, Theodor 20, 80, 86, 90, 95, 105, 114, Barbaja, Domenico 308 122, 163, 231, 248, 269, 281 Barber, Samuel 57, 206, 331 Aeschylus 22, 52, 163 Barlach, Ernst 159 Albeniz, Isaac 127 Barry, Gerald 285 Aldeburgh Festival 213, 218 Barto´k, Be´la 67–72, 74, 168 Alfano, Franco 34, 139 The Wooden Prince 68 alienation technique: see Verfremdungse¤ekt Baudelaire, Charles 62, 64 Anderson, Laurie 207 Baylis, Lilian 326 Anderson, Marian 310 Bayreuth 14, 18, 21, 49, 61–2, 63, 125, 140, 212, Andriessen, Louis 233, 234–5 312, 316, 335, 337, 338 Matthew Passion 234 Bazin, Andre´ 271 Orpheus 234 Beaumarchais, Pierre-Augustin Angerer, Paul 285 Caron de 134 Annesley, Charles 322 Nozze di Figaro, Le 134 Ansermet, Ernest 80 Beck, Julian 244 Antheil, George 202–3 Beckett, Samuel 144 ‘anti-opera’ 182–6, 195, 241, 255, 257 Krapp’s Last Tape 144 Antoine, Andre´ 81 Play 245 Apollinaire, Guillaume 113, 141 Beeson, Jack 204, 206 Appia, Adolphe 22, 62, 336 Beethoven, Ludwig van 87, 96 Aquila, Serafino dall’ 41 Eroica Symphony 178 Aragon, Louis 250 Beineix, Jean-Jacques 282 Argento, Dominick 204, 207 Bekker, Paul 109 Aristotle 226 Bel Geddes, Norman 202 Arnold, Malcolm 285 Belcari, Feo 42 Artaud, Antonin 246, 251, 255 Bellini, Vincenzo 27–8, 107 Ashby, Arved 96 Benco, Silvio 33–4 Astaire, Adele 296, 299 Benda, Georg 90 Astaire, Fred 296 Benelli, Sem 35, 36 Astruc, Gabriel 125 Benjamin, Arthur 285 Auden, W. -

Claudia Maurer Zenck
Claudia Maurer Zenck Publikationsliste A: Bücher Verfolgungsgrund: „Zigeuner“. Unbekannte Musiker und ihr Schicksal im „Dritten Reich“ (= Antifaschistische Literatur und Exilliteratur – Studien und Texte, Bd. 25, hg. v. Verein zur Förderung und Erforschung der antifaschistischen Literatur), Wien: Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, 2016 Mozarts Così fan tutte: dramma giocoso und deutsches Singspiel. Frühe Abschriften und frühe Aufführungen, Schliengen: edition argus, 2007 Vom Takt. Untersuchungen zur Theorie und kompositorischen Praxis im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2001 Ernst Krenek – ein Komponist im Exil, Wien: Lafite, 1980 Versuch über die wahre Art, Debussy zu analysieren (= Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten 8), München / Salzburg: Katzbichler, 1974 B: Editionen Ernst Krenek. Frühe Lieder für Gesang und Klavier, 3 Hefte, Wien: Universal Edition, 2015 (mit Einleitung, Textteil, Kritischem Bericht) Ernst Krenek - Briefwechsel mit der Universal Edition (1921-1941), 2 Teile, Köln / Weimar / Wien: Böhlau, 2010 „'...la di Ella inaudita finezza'. Zur Entstehung der Varianti. Briefwechsel Luigi Nono – Rudolf Kolisch 1954–1957/58“, in: Schönberg & Nono. A Birthday Offering to Nuria on May 7, 2002, hg. v. Anna Maria Morazzoni, Florenz: Olschki, 2002, S. 267–315 Ernst Krenek: Die amerikanischen Tagebücher 1937–1942. Dokumente aus dem Exil (Hg. u. Übers.), Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 1992 Der hoffnungslose Radikalismus der Mitte. Briefwechsel Ernst Krenek – Friedrich T. Gubler 1928–1939 (Hg.), Wien / Köln: Böhlau, 1989 C: Herausgabe Younghi Pagh-Paan. Auf dem Weg zur musikalischen Symbiose, Mainz: Schott, 2020 (wird im Mai/Juni 2020 erscheinen) (zus. mit Gernot Gruber u. Matthias Schmidt:) Ernst Krenek – nicht nur Komponist (= Ernst Krenek Studien 7), Schliengen: edition argus, 2018 Musik, Bühne und Publikum.