Die Idee Der Verbindung Von Musik Und Poesie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Early Fifteenth Century
CONTENTS CHAPTER I ORIENTAL AND GREEK MUSIC Section Item Number Page Number ORIENTAL MUSIC Ι-6 ... 3 Chinese; Japanese; Siamese; Hindu; Arabian; Jewish GREEK MUSIC 7-8 .... 9 Greek; Byzantine CHAPTER II EARLY MEDIEVAL MUSIC (400-1300) LITURGICAL MONOPHONY 9-16 .... 10 Ambrosian Hymns; Ambrosian Chant; Gregorian Chant; Sequences RELIGIOUS AND SECULAR MONOPHONY 17-24 .... 14 Latin Lyrics; Troubadours; Trouvères; Minnesingers; Laude; Can- tigas; English Songs; Mastersingers EARLY POLYPHONY 25-29 .... 21 Parallel Organum; Free Organum; Melismatic Organum; Benedica- mus Domino: Plainsong, Organa, Clausulae, Motets; Organum THIRTEENTH-CENTURY POLYPHONY . 30-39 .... 30 Clausulae; Organum; Motets; Petrus de Cruce; Adam de la Halle; Trope; Conductus THIRTEENTH-CENTURY DANCES 40-41 .... 42 CHAPTER III LATE MEDIEVAL MUSIC (1300-1400) ENGLISH 42 .... 44 Sumer Is Icumen In FRENCH 43-48,56 . 45,60 Roman de Fauvel; Guillaume de Machaut; Jacopin Selesses; Baude Cordier; Guillaume Legrant ITALIAN 49-55,59 · • · 52.63 Jacopo da Bologna; Giovanni da Florentia; Ghirardello da Firenze; Francesco Landini; Johannes Ciconia; Dances χ Section Item Number Page Number ENGLISH 57-58 .... 61 School o£ Worcester; Organ Estampie GERMAN 60 .... 64 Oswald von Wolkenstein CHAPTER IV EARLY FIFTEENTH CENTURY ENGLISH 61-64 .... 65 John Dunstable; Lionel Power; Damett FRENCH 65-72 .... 70 Guillaume Dufay; Gilles Binchois; Arnold de Lantins; Hugo de Lantins CHAPTER V LATE FIFTEENTH CENTURY FLEMISH 73-78 .... 76 Johannes Ockeghem; Jacob Obrecht FRENCH 79 .... 83 Loyset Compère GERMAN 80-84 . ... 84 Heinrich Finck; Conrad Paumann; Glogauer Liederbuch; Adam Ile- borgh; Buxheim Organ Book; Leonhard Kleber; Hans Kotter ENGLISH 85-86 .... 89 Song; Robert Cornysh; Cooper CHAPTER VI EARLY SIXTEENTH CENTURY VOCAL COMPOSITIONS 87,89-98 ... -

Radio 3 Listings for 12 – 18 June 2010 Page 1
Radio 3 Listings for 12 – 18 June 2010 Page 1 of 11 SATURDAY 12 JUNE 2010 Symphony No.22 in E flat, 'The Philosopher' Tom Service meets conductor Jonathan Nott, principal Amsterdam Bach Soloists conductor of the Bamberg Symphony Orchestra, and talks to SAT 01:00 Through the Night (b00smvg2) tenor Ian Bostridge and director David Alden about performing Jonathan Swain presents rarities, archive and concert recordings 4:35 AM Janacek. Robin Holloway talks about the appeal for from Europe's leading broadcasters Abel, Carl Friedrich (1723-1787) contemporary composers of Schumann's music, plus a report on Sonata No.6 in G major (Op.6 No.6) classical club nights. 1:01 AM Karl Kaiser (transverse flute), Susanne Kaiser (harpsichord) Wagner, Richard (1813-1883) Wie Lachend sie mir Lieder singen ( Tristan und Isolde, Act 1) 4:45 AM SAT 13:00 The Early Music Show (b00sq42f) Brigit Nilsson (Isolde), Irene Dalis (Brangäne), Metropolitan Rore, Cipriano de (c1515-1565) Ghostwriter: The Story of Henri Desmarest Opera Orchestra, Karl Böhm (conductor) Fera gentil The Consort of Musicke, Anthony Rooley (director) Henry Desmarest was obviously a talented musican and 1:10 AM composer, first boy page and then musician in Louis XIV's Wagner, Richard (1813-1883) 4:51 AM court, he began ghost-writing Grands Motets for one of the Amfortas! Die Wunde! (Parsifal, Act 1) Berlioz, Hector (1803-1869) chapel directors Nicholas Goupillet when he was in his early Jon Vickers (Parsifal), Christa Ludwig (Kundry), Metropolitan Le Carnaval romain - overture (Op.9) twenties. -

Les Pseaumes De David (Vol
CONVIVIUMchoir for renaissance·MUSICUM music Scott Metcalfe, music director Les pseaumes de David (vol. II) Les pseaumes mis en rimes francoise, par Clément Marot, & Théodore de Bèze (Geneva, 1562) Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621) Claude Le Jeune (c. 1530–1600) Claude Goudimel (c. 1520–1572) Ps. 114 Quand Israel hors d’Egypte sortit 1. Clément Marot (poem) & Loys Bourgeois (tune), Les pseaumes mis en rimes francoise (Geneva, 1562) 2. Jan Pieterszoon Sweelinck, Livre second des pseaumes de David (Amsterdam, 1613) Ps. 127 On a beau sa maison bâtir 1. Théodore de Bèze (poem) & Loys Bourgeois (tune),Les pseaumes mis en rimes francoise 2. Sweelinck, Livre second des pseaumes de David Ps. 130 Du fonds de ma pensée 1. Marot & Bourgeois, Les pseaumes mis en rimes francoise 2. Claude Goudimel, Les 150 pseaumes de David (Paris, 1564) 3. Goudimel, Les cent cinquante pseaumes de David (Paris, 1568) 4. Sweelinck, Livre second des pseaumes de David Sweelinck: Motets from Cantiones sacrae (Antwerp, 1619) De profundis clamavi (Ps. 130) O domine Jesu Christe Ps. 23 Mon Dieu me paist sous sa puissance haute 1. Marot & Bourgeois, Les pseaumes mis en rimes francoise 2. Claude Le Jeune, Les cent cinquante pseaumes de David (Paris, 1601) 3. Le Jeune, Dodecachorde, contenant douze pseaumes de David (La Rochelle, 1598) intermission Ps. 104 Sus sus, mon ame, il te faut dire bien 1. Marot, Les pseaumes mis en rimes francoise 2. Claude Goudimel, Les 150 pseaumes de David 3. Goudimel, Les cent cinquante pseaumes de David 4. Sweelinck, Livre quatriesme et conclusionnal de pseaumes de David (Haarlem, 1621) Le Jeune: Two psalms from Pseaumes en vers mesurez mis en musique (1606) Ps. -

Album Booklet
Calvin Psalter Calvin Psalter Mon Dieu me paist Verses 1 & 3 harm. Claude Goudimel (c. 1505–1572) harm. Claude Goudimel Psalms by Verse 2 harm. Claude Le Jeune (1528–1600) 14. C’est un Judée (Psalm 76) [0:55] Claude Le Jeune (1528/30–1600) 1. Or sus serviteurs du Seigneur (Psalm 134) [2:20] Claude Le Jeune C’est un Judée (Psalm 76) Calvin Psalter Du dixiesme mode harm. Claude Goudimel 15. C’est un Judée proprement [2:30] 2. Mon Dieu me paist (Psalm 23) [1:10] 16. La void-on par lui fracassez [1:27] The Choir of St Catharine’s College, Cambridge 17. On a pillé comme endormis [1:53] Claude Le Jeune 18. Tu es terrible et plein d’effroi [1:28] Mon Dieu me paist (Psalm 23) 19. Alors ô Dieu! [2:09] Edward Wickham conductor Du quatriesme mode 20. Quelque jour tu viendras trouser [1:58] 3. Mon Dieu me paist [2:21] 21. Offrez vos dons à lui [1:28] 4. Si seurement, que quand au val viendroye [2:57] Calvin Psalter 5. Tu oins mon chef d’huiles [1:46] harm. Claude Goudimel 22. Dés qu’adversité (Psalm 46) [0:59] Calvin Psalter 6. Propos exquis (Psalm 45) [1:01] Claude Le Jeune Dés qu’adversité (Psalm 46) Claude Le Jeune Du neufiesme mode Propos exquis (Psalm 45) 23. Dés qu’adversité nous offense [2:22] Du troisieme mode 24. Voire deusent les eaux profondes [2:00] 7. Propos exquis [2:16] 25. Il est certain qu’au milieu d’elle [2:44] 8. -

Un Recueil Parisien De Psaumes, De Chansons Spirituelles Et De Motets (Ca
Un recueil parisien de psaumes, de chansons spirituelles et de motets (ca. 1565) : Genève BGE Ms. Mus. 572. Laurent Guillo, Jean-Michel Noailly, Pierre Pidoux To cite this version: Laurent Guillo, Jean-Michel Noailly, Pierre Pidoux. Un recueil parisien de psaumes, de chansons spirituelles et de motets (ca. 1565) : Genève BGE Ms. Mus. 572.. Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, 2012, p. 199-233. hal-01216880 HAL Id: hal-01216880 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01216880 Submitted on 22 Oct 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Laurent Guillo, Jean-Michel Noailly et Pierre Pidoux † Un recueil parisien de psaumes, de chansons spirituelles et de motets (ca. 1565) : Genève BGE Ms. Mus. 572. La Bibliothèque de Genève a acquis en 1993 un manuscrit musical du milieu du XVIe siècle, cou- vert d’une remarquable reliure à décor, proposé par la librairie ancienne Thomas-Scheler à Paris et dont l’origine peut être retracée à partir de 1827. Il est maintenant conservé sous la cote Ms. Mus. 572. Outre la description du volume et de son contenu, assez inhabituel, cette contribu- tion s’attachera à identifier quelle a pu être sa provenance 1. -

Une Jeune Pucelle 3’43 Se Chante Sur « Une Jeune Fillette »
menu tracklist texte en français text in english textes chantés / lyrics AU SAINCT NAU 1 Procession Conditor alme syderum 2’40 2 Procession Conditor le jour de Noel 1’20 Se chante sur « Conditor alme syderum » 3 Eustache Du Caurroy Fantaisie n°4 sur Conditor alme syderum 1’48 (Orgue seul) 4 Jean Mouton - Noe noe psallite noe 3’21 5 Jacques Arcadelt - Missa Noe noe, Kyrie 8’06 Alterné avec le Kyrie « le jour de noël », qui se chante sur Kyrie fons bonitatis 6 Clément Janequin - Il estoyt une fillette 3’01 Se chante sur « Il estoit une fillette » 7 Anonyme/Christianus de Hollande Plaisir n’ay plus que vivre en desconfort 4’03 Se chante sur « Plaisir n’ay plus » 8 Claudin de Sermizy Dison Nau à pleine teste 3’27 Se chante sur « Il est jour, dist l’alouette » 9 Claudin de Sermizy - Au bois de deuil 3’49 Se chante sur « Au joly boys » 10 Eustache Du Caurroy Fantaisie n°31 sur Une jeune fillette 1’48 (Orgue seul) 3 11 Loyset Pieton O beata infantia 8’20 12 Eustache Du Caurroy Fantaisie n°30 sur Une jeune fillette 1’37 (Orgue seul) 13 Eustache Du Caurroy Une jeune pucelle 3’43 Se chante sur « Une jeune fillette » 14 Guillaume Costeley - Allons gay bergiere 1’37 15 Claudin de Sermizy L’on sonne une cloche 3’35 Se chante sur « Harri bourriquet » 16 Anonyme - O gras tondus 1’42 17 Claudin de Sermizy Vous perdez temps heretiques infames 2’16 Se chante sur « Vous perdez temps de me dire mal d’elle » 18 Claude Goudimel Esprit divins, chantons dans la nuit sainte 2’16 Se chante sur « Estans assis aux rives aquatiques » (Ps. -

Diamm Facsimiles 6
DIAMM FACSIMILES 6 DI MM DIGITAL IMAGE ACHIVE OF MEDIEVAL MUSIC DIAMM COMMITTEE MICHAEL BUDEN (Faculty Board Chair) JULIA CAIG-McFEELY (Diamm Administrator) MATIN HOLMES (Alfred Brendel Music Librarian, Bodleian Library) EMMA JONES (Finance Director) NICOLAS BELL HELEN DEEMING CHISTIAN LEITMEIR OWEN EES THOMAS SCHMIDT diamm facsimile series general editor JULIA CAIG-McFEELY volume editors ICHAD WISTEICH JOSHUA IFKIN The ANNE BOLEYN MUSIC BOOK (Royal College of Music MS 1070) Facsimile with introduction BY THOMAS SCHMIDT and DAVID SKINNER with KATJA AIAKSINEN-MONIER DI MM facsimiles © COPYIGHT 2017 UNIVERSITY OF OXFORD PUBLISHED BY DIAMM PUBLICATIONS FACULTY OF MUSIC, ST ALDATES, OXFORD OX1 1DB ISSN 2043-8273 ISBN 978-1-907647-06-2 SERIES ISBN 978-1-907647-01-7 All rights reserved. This work is fully protected by The UK Copyright, Designs and Patents Act 1988. No part of the work may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise without the prior permission of DIAMM Publications. Thomas Schmidt, David Skinner and Katja Airaksinen-Monier assert the right to be identified as the authors of the introductory text. Rights to all images are the property of the Royal College of Music, London. Images of MS 1070 are reproduced by kind permission of the Royal College of Music. Digital imaging by DIAMM, University of Oxford Image preparation, typesetting, image preparation and page make-up by Julia Craig-McFeely Typeset in Bembo Supported by The Cayzer Trust Company Limited The Hon. Mrs Gilmour Printed and bound in Great Britain by Short Run Press Exeter CONTENTS Preface ii INTODUCTION 1. -

Copyright by Gary Dean Beckman 2007
Copyright by Gary Dean Beckman 2007 The Dissertation Committee for Gary Dean Beckman Certifies that this is the approved version of the following dissertation: The Sacred Lute: Intabulated Chorales from Luther’s Age to the beginnings of Pietism Committee: ____________________________________ Andrew Dell’ Antonio, Supervisor ____________________________________ Susan Jackson ____________________________________ Rebecca Baltzer ____________________________________ Elliot Antokoletz ____________________________________ Susan R. Boettcher The Sacred Lute: Intabulated Chorales from Luther’s Age to the beginnings of Pietism by Gary Dean Beckman, B.A.; M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December 2007 Acknowledgments I would like to acknowledge Dr. Douglas Dempster, interim Dean, College of Fine Arts, Dr. David Hunter, Fine Arts Music Librarian and Dr. Richard Cherwitz, Professor, Department of Communication Studies Coordinator from The University of Texas at Austin for their help in completing this work. Emeritus Professor, Dr. Keith Polk from the University of New Hampshire, who mentored me during my master’s studies, deserves a special acknowledgement for his belief in my capabilities. Olav Chris Henriksen receives my deepest gratitude for his kindness and generosity during my Boston lute studies; his quite enthusiasm for the lute and its repertoire ignited my interest in German lute music. My sincere and deepest thanks are extended to the members of my dissertation committee. Drs. Rebecca Baltzer, Susan Boettcher and Elliot Antokoletz offered critical assistance with this effort. All three have shaped the way I view music. -

Aj. Orlando Di Lasso's Missa Ad Imitationem Moduli Doulce
379 A/8/J /AJ. ORLANDO DI LASSO'S MISSA AD IMITATIONEM MODULI DOULCE MEMOIRE: AN EXAMINATION OF THE MASS AND ITS MODEL DISSERTATION Presented to the Graduate Council of the North Texas State University in Partial Fulfilment of the Requirements For the Degree of Doctor of Musical Arts By Jan Hanson Denton, Texas August, 1986 d • i Hanson, Jan L., Orlando di Lasso's Missa Doulce Memoire: An Examination of the Mass and Its Model, Doctor of Musical Arts (Conducting), August, 19b6, pp. 33, 3 figures, 10 examples, bibliography, 37 titles. Orlando di Lasso is regarded as one of the great polyphonic masters of the Renaissance. An international composer of both sacred and secular music, his sacred works have always held an important place in the choral repertory. Especially significant are Lasso's Parody Masses, which comprise the majority of settings in this genre. The Missa Ad Imitatiomem Moduli Doulce Memoire and its model, the chanson Doulce Memoire by Sandrin, have been selected as the subject of this lecture recital. In the course of this study, the two works have been compared and analyzed, focusing on the exact material which has been borrowed from the chanson. In addition to the borrowed material, the longer movements, especially the Gloria and the Credo, exhibit considerable free material. This will be considered in light of its relation to the parody sections. Chapter One gives an introduction to the subject of musical parody with definitions of parody by several contemporary authors. In addition, several writers of the sixteenth century, including Vicentino, Zarlino, Ponzio, and Cerone are mentioned. -

Introduction
INTRODUCTION. Nicola Vicentino dei Vicentini was born in Vicenza in 1511 and died around 1576-77 in Milan. His name and birthplace are recorded in a document concerning his appointment as chapel master in Vicenza in 1563.1 His date of birth can be assumed from two references in his trea- tise Ancient Music Adapted to Modern Practice (Rome, 1555): the wood- cut giving his age as forty-four and his assertion that he was thirty-nine in 1550. The year of his death, shortly after the plague that ravaged north- ern Italy in 1575 and again in 1576, is given by Ercole Bottrigari in // Desiderio (Venice, 1599).2 Vicentino studied in Venice under Adrian Willaert sometime during the 1530s. His first book of five-voice madrigals (Venice, 1546) proudly announces his indebtedness to his "unique" and "divine" master.3 Given the unexceptional music in this collection, Vicentino's comments about his new or rediscovered styles of composing, allegedly influenced by Willaert, amount to little more than the customary platitudes. Vicentino styled himself "Don" on the title-page, indicating that he should be considered a distinguished priest. Several other documents corroborate his vocation.4 Possibly this title of respect was accorded to Vicentino when he entered the service of Ippolito II d'Este, cardinal of Ferrara. Just as we cannot ascertain when Vicentino began and ended his studies with Willaert, so we cannot say when he joined and quit the retinue of the cardinal. It is possible, however, to suggest some reason- able hypotheses. For the years of study under Willaert, the mid- to late 1530s are plausible. -

AMS Program & Abstracts
A MS Program & Abstracts MS Program Essential new scholarship from Ashgate... AMS Program & Abstracts The Music and Art WASHINGTON, D.C., OCTOBER 27–30 2005 of Radiohead Edited by Joseph Tate,ate,ate, Oregon State University ASHGATE POPULAR AND FOLK MUSIC SERIES May 2005 232 pages Perspectives Hardback 0 7546 3979 7 on Gustav Mahler Paperback 0 7546 3980 0 Edited by Jeremy Barham, University of Surrey, UK ‘Speak to Me’: August 2005 628 pages Hardback 0 7546 0709 7 The Legacy of Pink Floyd’s The Dark Side Thomas Tomkins: of the Moon Edited by RRRussellussell RRussell eising,eising,eising, The Last Elizabethan University of Toledo Edited by Anthony Boden,,, with Denis Stevens, David R.A. Evans,Evans,.A. ASHGATE POPULAR AND FOLK MUSIC SERIES September 2005 246 pages PPPetereter James and Bernard RRBernard oseoseose Hardback 0 7546 4018 3 June 2005 387 pages Paperback 0 7546 4019 1 Hardback 0 7546 5118 5 From Renaissance Giacomo Meyerbeer to Baroque and Music Drama in Change in Instruments Nineteenth-Century Paris and Instrumental Music Mark Everist, University in the Seventeenth Century of Southampton, UK Edited by Jonathan Wainwright,ainwright,ainwright, VARIORUM COLLECTED STUDIES SERIES: CS805 University of York, UK and July 2005 460 pages Hardback 0 86078 915 2 PPPetereter Holman,,, University of Leeds, UK July 2005 342 pages Timba: The Sound Hardback 0 7546 0403 9 of the Cuban Crisis VVVincenzoincenzo PPincenzo ernaernaerna D.C. 2005 Washington, Musical Voices of Early SOAS MUSICOLOGY SERIES Modern Women April 2005 370 pages Many-Headed Melodies Hardback 0 7546 3941 X Edited by Thomasin LaMay,,, Goucher College A Briefe Introduction WOMEN AND GENDER IN THE EARLY to the Skill of Song MODERN WORLD April 2005 470 pages by William Bathe Hardback 0 7546 3742 5 Edited by Kevin C. -
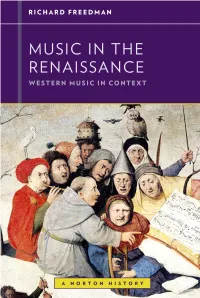
MUSIC in the RENAISSANCE Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor
MUSIC IN THE RENAISSANCE Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE RENAISSANCE Richard Freedman Haverford College n W. W. NORTON AND COMPANY Ƌ ƋĐƋ W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program—trade books and college texts— were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: Bonnie Blackburn Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics-Fairfield, PA A catalogue record is available from the Library of Congress ISBN 978-0-393-92916-4 W.