DOKUMENTATION Hans-Ehrenberg-Preis 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aryan Jesus and the Kirchenkampf: an Examination of Protestantism Under the Third Reich Kevin Protzmann
Aryan Jesus and the Kirchenkampf: An Examination of Protestantism under the Third Reich Kevin Protzmann 2 Often unstated in the history of National Socialism is the role played by Protestantism. More often than not, Christian doctrine and institutions are seen as incongruous with Nazism. Accordingly, the Bekennende Kirche, or Confessing Church, receives a great deal of scholarly and popular attention as an example of Christian resistance to the National Socialist regime. Overlooked, however, were the Deutsche Christen, or German Christians. This division within Protestantism does more than highlight Christian opposition to Nazism; on balance, the same cultural shifts that allowed the rise of Adolf Hitler transformed many of the most fundamental aspects of Christianity. Even the Confessing Church was plagued with the influence of National Socialist thought. In this light, the German Christians largely overshadowed the Confessing Church in prominence and influence, and Protestantism under the Third Reich was more participatory than resistant to Nazi rule. Like the National Socialists, the Deutsche Christen, or German Christians, have their roots in the postwar Weimar Republic. The movement began with the intention of incorporating post-war nationalism with traditional Christian theology.1 The waves of nationalism brought about by the dissolution of the German Empire spread beyond political thought and into religious ideas. Protestant theologians feared that Christianity retained many elements that were not “German” enough, such as the Jewishness of Jesus, the canonicity of the Hebrew Bible, and the subservient nature of Christian ethics.2 These fears led to dialogues among the clergy and laity about the future and possible modification of Christian doctrine. -

Tbe Confessional Pastor and His Struggle the Rev
Tbe Confessional Pastor and His Struggle THE REv. HANS EHRENBERG, PH.D. ANY accounts of the Church conflict in Germany have M been published in this country; they have been either historical records or attempts to show the fundamental theological and political principles in-rolved. The present study has a different object, viz., to draw out the lessons of the conflict for the practical or pastoral life of the Church herself. This implies that our attempt must be to survey and sum up the facts as well as the truths of the struggle from the standpoint of one who is engaged in the struggle, i.e., to lay bare its hmer elements. Thus my essay is to present the German Church struggle in such a way that other churches see it as part and parcel of Church history and Church life in general and, hertte, also of their own. Following upon an ,introduction treating the fundamental aspect under which all churches should consider the German church conflict, I present in this essay what I may call the three dramatis persona of the "Church drama" :-the Confessional Pastor, the Heretic (the "German Christian"), and the Confessing Congregation. The study closes on the problem-still unsolved, in the Confessional Church, and the like in all churches--of a Confessional Church Government. Readers of this study are asked to forget, for the time being, all the special traditions of their own churchdom, if they are Anglican, or Nonconformist, or even German (of course pre-Hitler German). For the life and death struggle of a church concerns the "church within the church," and, hence, it is the l?truggle of the Church. -

Hans Ehrenberg
Günter Brakelmann Hans Ehrenberg Am 21. Juni 1925 wird Hans Ehrenberg von der größeren Gemeindevertretung der Bochumer Altstadtgemeinde zum Pfarrer des 6. Bezirks gewählt und am 27. September 1925 durch den Superintendenten Alfred Niederstein in der Christuskirche in sein Amt eingeführt. Am Nachmittag dieses Tages wird der neu gewählte Pfarrer, der zuvor vom 9.6. bis 31.10. 1924 Hilfsprediger in Bochum gewesen war, von der Gemeinde und der Synode herzlich begrüßt. Zuvor hatte er 1923 und 1924 vor dem Konsistorium in Münster die beiden theologischen Examina abgelegt. Der inzwischen 42 Jährige hat das Amt als Gemeindepfarrer in einer vorrangig kleinbürgerlichen und proletarischen Gemeinde, die von Arbeitnehmern aus großindustriellen Unternehmen und Handwerksbetrieben wie von städtischen Arbeitnehmern bestimmt war, bis 1937 inne gehabt. Ehrenberg, der nun in den Dienst der Kirche eintrat, hatte schon einen längeren außergewöhnlichen Berufsweg hinter sich. Der 1883 in Hamburg-Altona geborene und aufgewachsene Sohn jüdischer Eltern hatte sein erstes Studium der Nationalökonomie 1906 mit einer Promotion über „Die Eisenhüttentechnik und der deutsche Hüttenarbeiter“ abgeschlossen. Die notwendigen empirischen Studien hatte er im Hüttenwerk des Hörder Vereins bei Dortmund 1 betrieben. Diese betriebs- und arbeitssoziologische wie lohntheoretische Studie ist eine frühe Pionierleistung empirischer Soziologie. Nach einem Jahr als „Einjährig-Freiwilliger“ in einem Kasseler Feldartillerieregiment beginnt er in Heidelberg ein zweites Studium der Geschichte und Psychologie. Er schließt es ab mit einer zweiten Dissertation über „Kants Kategorientafel und der systematische Begriff der Philosophie“. Zwei weitere Kant-Studien folgen: „Kritik der Psychologie als Wissenschaft. Forschungen nach den systematischen Prinzipien der Erkenntnislehre Kants“ und „Kants mathematische Grundsätze der reinen Naturwissenschaft“. Er wurde und blieb ein exzellenter Kantkenner. -

Laudatio Dr. Orr Scharf
Laudatio Dr. Orr Scharf Martin Buber und Franz Rosenzweig sind zwei der wichtigsten Wegbereiter des jüdisch- christlichen Dialogs nicht nur in Deutschland. In einem Land, das bis heute nicht frei von dem Schatten des Nazismus ist, ist dieser Dialog Ausdruck des Versuchs einer theologischen Aufarbeitung der christlichen und deutschen Vergangenheit, die in dieser Frage nicht viele weitere Lichtblicke kennt. Das Engagement des mit Rosenzweig freundschaftlich und verwandtschaftlich verbundenen Hans Ehrenberg in der Bochumer Bekennenden Kirche ist hier sicherlich eine weitere erfreuliche Ausnahme. Die 1925 begonnene und nach dem frühen Tod Rosenzweigs von Buber allein weitergeführte gemeinsame Verdeutschung der Hebräischen Bibel ist auch heute noch wesentliche Grundlage für das Bemühen, diesen jüdisch-christlichen Dialog – oft in Gestalt eines informellen Lehrhauses – weiter zu führen. Umso wichtiger ist die kontinuierliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Hintergrund und Durchführung des gemeinsamen Vorhabens von Buber und Rosenzweig. Dr. Orr Scharf zeigt in seinem nun ausgezeichneten Aufsatz „Whose Bible is it anyway? The Buber-Rosenzweig Translation as a Bible for Christian Readers“ die Hintergründe der gemeinsamen sprachdenkerischen Arbeit von Buber und Rosenzweig auf. Er beginnt dabei historisch mit Franz Rosenzweigs früher Korrespondenz mit Eugen Rosenstock als Entstehungshintergrund für Rosenzweigs Ansichten zur historischen Rolle des Christentums. Auf diese Weise wird die Thematik von der Biographie Rosenzweigs her eingeordnet. Scharf stellt Rosenzweigs Bedenken bezüglich der Hebräischkenntnisse seiner Hörerschaft als Ausdruck der Überzeugung in den Vordergrund, dass die mangelnde Vertrautheit mit dieser Sprache eine christliche Leserschaft zu einer wenig sinnvollen Alternative des Verdeutschungsprojektes machte. Der Aufsatz beinhaltet zudem eine aufschlussreiche Betrachtung von erst jüngst im Rahmen der Martin Buber Werkausgabe veröffentlichten und von Dr. -

The German Evangelical Church and the Nazi State
NO “SPOKE IN THE WHEEL”: THE GERMAN EVANGELICAL CHURCH AND THE NAZI STATE By HANNAH D’ANNE COMODECA Bachelor of Arts in History and Political Science Oklahoma Baptist University Shawnee, OK 2012 Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of MASTER OF ARTS May, 2014 NO “SPOKE IN THE WHEEL”: THE GERMAN EVANGELICAL CHURCH AND THE NAZI STATE Thesis Approved: Dr. Joseph F. Byrnes Thesis Adviser Dr. Ronald A. Petrin Dr. John te Velde ii Name: HANNAH D’ANNE COMODECA Date of Degree: MAY, 2014 Title of Study: NO “SPOKE IN THE WHEEL’: THE GERMAN EVANGELICAL CHURCH AND THE NAZI STATE Major Field: HISTORY Abstract: This study focuses on the relationship between the German Evangelical Church and the Nazi state from 1933-1945 and the reasons why the Church did not oppose state policies of persecution of the Jews. Through primary sources of sermons, synodal decisions, and memoirs, this study finds that during the years of the Third Reich, the German Evangelical Church retreated into itself. The internal conflicts that some historians have termed “the Church Struggle” distracted the Church from problems in the state. While some individuals within the Church did oppose state policies, the German Evangelical Church, as an institution, only protested when it felt directly threatened by the state. iii There are three possible ways in which the church can act towards the state: in the first place, as has been said, it can ask the state whether its actions are legitimate and in accordance with its character as state, i.e. -

Our Post-Christian Age’: Historicist-Inspired Diagnoses
‘Our post-Christian age’: Historicist-inspired diagnoses 1 ‘Our post-Christian age’: Historicist-inspired diagnoses of modernity, 1935–70 Herman Paul Introduction ‘“Post-Christian Era”? Nonsense!’ declared one of Europe’s foremost theologians, Karl Barth, in August 1948, at the first assembly of the World Council of Churches in Amsterdam. How do we come to adopt as self-evident the phrase first used by a German National Socialist, that we are today living in an ‘un-Christian’ or even ‘post- Christian’ era? … How indeed do we come to the fantastic opinion that secularism and godlessness are inventions of our time; that there was once a glorious Christian Middle Age with a generally accepted Christian faith, and it is now our task to set up this wonderful state of affairs again in new form?1 The World Council assembly was an appropriate venue for raising these questions, as several high-profile attendees used the very phrase, ‘post- Christian era’, in their diagnosis of the times. Even Martin Niemöller, a collaborator of Barth in the German Confessing Church, stated at the Amsterdam conference that ‘we already talk about a “post-Christian age”, in which we live and see the Christian church nearing its decline’.2 Apparently, by 1948, ‘post-Christian era’ had become a familiar turn of phrase, at least in circles of the World Council of Churches. But where did it come from and what did it mean? Barth’s emphatic statement notwithstanding, ‘post-Christian age’ was not a phrase of National Socialist origin. Admittedly, it resonated among secularists of right-wing political leaning, especially in the 1930s and early 1940s. -
Hans-Ehrenberg-Preis 17 PM Christuskirchebo
Thomas Wessel | Pfa rrer Pressemitteilung 01.09.2017 Adresse Platz des europäischen Versprechens 1 44787 Bochum Postadresse „Eine große Metapher für die- Westring 26 A 44787 Bochum ses Land“ Email [email protected] Hans Ehrenberg war Jude und Christ, Philosoph und Pub- lizist, er wurde zum Vordenker gegen die Nazis und ihren totalitären Staat. Der protestantische Hans-Ehrenberg- Preis erinnert an den Bochumer Pfarrer, am 17. Septem- ber wird der Preis an den Künstler Wim Wenders verliehen, die Laudatio hält der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm. Wenders, einer der bedeutendsten Filmkünstler der Gegenwart, wird für einen künstlerischen Stil geehrt, „der den Spielraum offen hält für das, was sich dem Zugriff entzieht“, so der Bochumer Su- perintendent Gerald Hagmann: Die Freiheit des Glaubens, die Hans Ehrenberg gegen den totalitären Staat verteidigt habe, sei immer auch die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Kunst immer auch die des Glaubens, so Hagmann weiter, beide seien sie „Indikatoren einer freien Gesellschaft“. Der Hans- Ehrenberg-Preis wird von der Evangelischen Kirche in Bochum gemeinsam mit der westfälischen Lan- deskirche an Persönlichkeiten verliehen, „die in öffentlicher Auseinandersetzung protestantische Positionen beziehen“. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem die Politikerin Antje Vollmer, der Publizist Robert Leicht, Altpräses Manfred Kock gemeinsam mit Karl Kardinal Lehmann sowie die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Dass mit Wim Wenders nun erstmals ein Künstler geehrt wird, fällt nicht zufällig in das Jahr, in dem die Evangelische Kirche das Reformationsjubiläum begeht: Eine der wesentlichen reformatorischen Überzeugungen ist, dass der einzelne Mensch ein Eigenrecht hat gegenüber Gesellschaft, Staat und eben auch der Kirche, er ist nicht gebunden an das, was ist, sondern wie es sein könnte. -

'Our Post-Christian Age': Historicist-Inspired Diagnoses Of
‘Our post-Christian age’: Historicist-inspired diagnoses 1 ‘Our post-Christian age’: Historicist-inspired diagnoses of modernity, 1935–70 Herman Paul Introduction ‘“Post-Christian Era”? Nonsense!’ declared one of Europe’s foremost theologians, Karl Barth, in August 1948, at the first assembly of the World Council of Churches in Amsterdam. How do we come to adopt as self-evident the phrase first used by a German National Socialist, that we are today living in an ‘un-Christian’ or even ‘post- Christian’ era? … How indeed do we come to the fantastic opinion that secularism and godlessness are inventions of our time; that there was once a glorious Christian Middle Age with a generally accepted Christian faith, and it is now our task to set up this wonderful state of affairs again in new form?1 The World Council assembly was an appropriate venue for raising these questions, as several high-profile attendees used the very phrase, ‘post- Christian era’, in their diagnosis of the times. Even Martin Niemöller, a collaborator of Barth in the German Confessing Church, stated at the Amsterdam conference that ‘we already talk about a “post-Christian age”, in which we live and see the Christian church nearing its decline’.2 Apparently, by 1948, ‘post-Christian era’ had become a familiar turn of phrase, at least in circles of the World Council of Churches. But where did it come from and what did it mean? Barth’s emphatic statement notwithstanding, ‘post-Christian age’ was not a phrase of National Socialist origin. Admittedly, it resonated among secularists of right-wing political leaning, especially in the 1930s and early 1940s. -

The US Reception of Heidegger's Political Thought
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 1-1-1991 Contextual misreadings : the US reception of Heidegger's political thought. George R. Leaman University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1 Recommended Citation Leaman, George R., "Contextual misreadings : the US reception of Heidegger's political thought." (1991). Doctoral Dissertations 1896 - February 2014. 2077. https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/2077 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. CONTEXTUAL MISREADINGS: THE US RECEPTION OF HEIDEGGER'S POLITICAL THOUGHT A Dissertation Presented By GEORGE R . LEAMAN Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 1991 Department of Philosophy (^Copyright by George R. Leaman 1991 All Rights Reserved CONTEXTUAL MISREADINGS: THE US RECEPTION OF HEIDEGGER'S POLITICAL THOUGHT A Dissertation Presented By GEORGE R. LEAMAN Approved as to style and content by: ivw Robert Ackermann, Chairman of Committee G. Robison, Department Head /artment of Philosophy ACKNOWLEDGEMENTS As u/ith every project of this size, many people contributed to its successful completion. The German Academic Exchange Service (DAAD) funded my first sixteen months of research and study u/ith Prof. Wolfgang F. Haug at the Free University in West Berlin. There I worked in his "Projekt Philosophie im deutschen Faschismus" at the Institute for Philosophy. -

Zwischen Wissenschaft Und Industrie Mechanismen Des Wissens- Und
Zwischen Wissenschaft und Industrie Mechanismen des Wissens- und Technologietransfers am Aachener Werkzeugmaschinenlabor von 1906 bis 2006 Von der Philosophischen Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie genehmigte Dissertation vorgelegt von Cornelia Kompe, M.A. aus Siegburg Berichter: Universitätsprofessor Dr. Armin Heinen Berichter: Universitätsprofessor Dr. Christine Roll Tag der mündlichen Prüfung: 17.7.2009 Diese Dissertation ist auf den Internetseiten der Hochschulbibliothek online verfügbar. Vorwort Ein Wort des Dankes Die vorliegende Arbeit zur Interaktion zwischen Wissenschaft und Industrie entstand größtenteils im Rahmen meiner Tätigkeit als Mitarbeiterin des WZL. Ich erhielt die Aufgabe, die 100jährige Geschichte des Institutes aufzuarbeiten und eine Jubiläums- schrift zu verfassen. Diese wurde zur Hundertjahrfeier am 12. Mai 2006 präsentiert. Danken möchte ich an dieser Stelle zunächst meinem Doktorvater, Herrn Professor Armin Heinen, der mir dieses Projekt vermittelte und mir damit auch die Möglichkeit gab, zu promovieren. Er ermutigte mich zur Bearbeitung dieses komplexen Themas und begleitete meine Arbeit mit großem Engagement. Dafür danke ich ihm sehr. Ebenso herzlich danke ich Frau Professor Christine Roll, die als Zweitgutachterin großes Interesse für mein Thema zeigte, sowie Herrn Professor Max Kerner, der die Rolle des Beisitzers bei meiner Disputation übernahm und dem ich mich besonders verbunden fühle. Auch am WZL erhielt ich von allen Seiten Unterstützung, Hilfe und Freundschaft. Die Kolleginnen und Kollegen nahmen mich als ‚Nicht-Ingenieurin’ selbstverständlich in ihre Mitte auf. Allen voran war es die großartige Unterstützung von Herrn Professor Walter Eversheim, auf die ich jederzeit zählen konnte, sowie die der Professoren Christian Brecher, Fritz Klocke, Tilo Pfeifer, Robert Schmitt, Günther Schuh und Man- fred Weck. -

A Forum on the Gospel and the Jewish People MISHKAN Issue 83, 2020
A Forum on the Gospel and the Jewish People MISHKAN Issue 83, 2020 Contents Ulrich Laepple Jewish Christians, Messianic Jews and the Evangelical Church in Germany (EKD) in Christian-Jewish Encounters since 1945 Raymond Lillevik Your Word is Truth - The Identity of the Bible as Two Natures Christine Eidsheim Negotiating a Messianic Identity Through the Use of Space and Art Torleif Elgvin New Technology on the Dead Sea Scrolls MISHKAN Published by The Caspari Center for Biblical and Jewish studies, in cooperation with Jews for Jesus, the Danish Israel Mission, AMZI Focus Israel, and Chosen People Ministries. C 2020 Caspari Center, Jerusalem Editorial Board Rich Robinson, PhD Richard Harvey, PhD Judith Mendelsohn Rood, PhD Raymond Lillevik, PhD Elliot Klayman, JD Elisabeth E. Levy David Serner Sanna Erelä Linguistic editor: Emma Cole Cover design: Jennifer Nataf ISSN 0792-0474 Subscriptions, back issues, and other inquiries: [email protected] www.caspari.com Mishkan 83: Winter 2020 MISHKAN A FORUM ON THE GOSPEL AND THE JEWISH PEOPLE ISSUE 83/2020 www.caspari.com Mishkan 83: Winter 2020 Dear Mishkan readers, This issue of Mishkan will give you a glimpse into different topics, such as Messianic identity, the Messianic Movement and the Church in Germany, how to read the Bible, and new methods for identifying false Dead Sea Scrolls. And, as always, book reviews, “Thoughts from the Sidelines,” and “From the Israeli Scene.” From Jerusalem, we want to wish all our readers a Merry Christmas and a Happy New Year 2021! Happy reading! The Caspari -
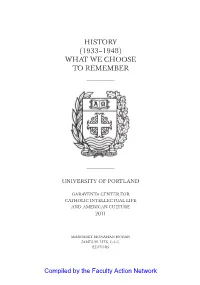
What We Choose to Remember ______
HISTORY (1933–1948) WHAT WE CHOOSE TO REMEMBER ___________ ___________ UNIVERSITY OF PORTLAND GARAVENTA CENTER FOR CATHOLIC INTELLECTUAL LIFE AND AMERICAN CULTURE 2011 MARGARET MONAHAN HOGAN JAMES M. LIES, C.S.C. EDITORS Compiled by the Faculty Action Network ISBN-13: 978-0-9817771-4-6 ISBN-10: 0-9817771-4-7 Compiled by the Faculty Action Network “Where are our Brothers, the Strong, Free Men? Artist: Alice Lok Cahana Compiled by the Faculty Action Network CONTENTS Introduction Margaret Monahan Hogan 5 James M. Lies, C.S.C. Remembering the Suffering of the People Archbishop Elias Chacour 19 For the People of the Land: Peace with Justice Alice Lok Cahana 33 Miracles in Auschwitz: Word and Art as Kaddish Remembering the Response of the Catholic Church Gerald P. Fogarty, S.J. 39 The Vatican and the United States: Rapprochement in Time of War Eugene J. Fisher 61 Interpreting We Remember: A Reflection on the Shoah The History and Development of a Document of the Holy See John T. Pawlinkowski, O.S.M. 85 Why History Matters for Christian-Jewish Relations Remembering Christian Resistance Walton Padelford 101 From Pacifist to Conspirator: The Ethical Journey of Dietrich Bonhoeffer Steven P. Millies 113 Bonhoeffer and Delp: The View from Below Richard A. Loomis 135 Dietrich Bonhoeffer’s Journey of Resistance Remembering Jewish Resistance Temitayo Ope Peters 151 1 Man’s Fight: 1,200 Saved Ewa K.Bacon 161 The Prisoner Hospital at Buna-Monowitz Remembering the Voices of Women Laura L. Garcia 191 Edith Stein: The Nature and Vocation of Women Margaret Monahan Hogan 215 Pardigm Lost: Gertrud Von Le Fort’s The Eternal Woman Compiled by the Faculty Action Network 1 BETWEEN PROMISE AND FULFILLMENT SHOAH/NAKBAH OFFERINGS OF MEMORY AND HISTORY Revised JulyI 28, 2014 BY JUDITH MENDELSOHN ROOD his paper recounts a journey, an enabling event, and a transformation.