Jacques Santer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

30Years 1953-1983
30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -

Bilan Législature 2013-2018
BILAN LÉGISLATURE 2013-2018 KLOER, NO & GERECHT. TABLE DES MATIÈRES PRÉFACE DE CLAUDE WISELER 3 LE BILAN DU GROUPE PARLEMENTAIRE CSV À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS 29 BREF RÉSUMÉ EN CHIFFRES 4 1) Politique familiale et du troisième âge 30 LES DÉPUTÉS CSV 5 2) Affaires sociales et politique du travail et de l’emploi 30 3) Politique du logement 31 Diane Adehm 6 4) Croissance et aménagement du territoire 31 Sylvie Andrich-Duval 7 5) Politique d’intégration 33 Nancy Arendt 8 6) Politique de l’éducation 33 Emile Eicher 9 7) Politique budgétaire et finances 34 Felix Eischen 10 8) Réforme fiscale 35 Léon Gloden 11 9) Plan hospitalier 35 Jean-Marie Halsdorf 12 10) Justice 35 Martine Hansen 13 11) Sécurité des citoyens 36 Françoise Hetto-Gaasch 14 12) Lutte contre le terrorisme 36 Ali Kaes 15 13) Services de secours 37 Marc Lies 16 14) Fabriques d’églises 37 Martine Mergen 17 15) Economie 37 Paul Henri Meyers 18 16) Fonction publique et institutions étatiques 38 Octavie Modert 19 17) Réforme constitutionnelle 38 Laurent Mosar 20 18) Egalité des Chances 39 Marcel Oberweis an Claudine Konsbrück 21 19) Sport 39 Gilles Roth 22 20) Gaspillage alimentaire 39 Marco Schank 23 21) Culture 39 Marc Spautz 24 Serge Wilmes 25 LES DÉPUTÉS CSV AU PARLEMENT Claude Wiseler 26 EUROPÉEN 40 Michel Wolter 27 Laurent Zeimet 28 Législature 2013-2018 SYNTHÈSE DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE DES DÉPUTÉS CSV La présente législature touche à sa fin. Le 14 octobre pro- Le présent bilan constitue une synthèse de notre travail par- chain, une nouvelle Chambre des Députés sortira des urnes. -

Download (515Kb)
European Community No. 26/1984 July 10, 1984 Contact: Ella Krucoff (202) 862-9540 THE EUROPEAN PARLIAMENT: 1984 ELECTION RESULTS :The newly elected European Parliament - the second to be chosen directly by European voters -- began its five-year term last month with an inaugural session in Strasbourg~ France. The Parliament elected Pierre Pflimlin, a French Christian Democrat, as its new president. Pflimlin, a parliamentarian since 1979, is a former Prime Minister of France and ex-mayor of Strasbourg. Be succeeds Pieter Dankert, a Dutch Socialist, who came in second in the presidential vote this time around. The new assembly quickly exercised one of its major powers -- final say over the European Community budget -- by blocking payment of a L983 budget rebate to the United Kingdom. The rebate had been approved by Community leaders as part of an overall plan to resolve the E.C.'s financial problems. The Parliament froze the rebate after the U.K. opposed a plan for covering a 1984 budget shortfall during a July Council of Ministers meeting. The issue will be discussed again in September by E.C. institutions. Garret FitzGerald, Prime Minister of Ireland, outlined for the Parliament the goals of Ireland's six-month presidency of the E.C. Council. Be urged the representatives to continue working for a more unified Europe in which "free movement of people and goods" is a reality, and he called for more "intensified common action" to fight unemployment. Be said European politicians must work to bolster the public's faith in the E.C., noting that budget problems and inter-governmental "wrangles" have overshadolted the Community's benefits. -
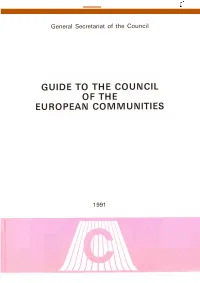
Guide to the Council of the European Communities
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you byCORE provided by Archive of European Integration General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1991 W/lliMW ι \ \\\ General Secretariat of the Council GUIDE TO THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 1991 Cataloguing data can be found at the end of this publication Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1991 ISBN 92-824-0796-9 Catalogue number: BX-60-90-022-EN-C © ECSC-EEC-EAEC, Brussels · Luxembourg, 1991 Printed in Belgium CONTENTS Page Council of the European Communities 5 Presidency of the Council 7 Conference of the Representatives of the Governments of the Member States 8 List of Representatives of the Governments of the Member States who regularly take part in Council meetings 9 Belgium 10 Denmark 11 Federal Republic of Germany 12 Greece 15 Spain 17 France 19 Ireland 21 Italy 23 Luxembourg 29 Netherlands 30 Portugal 32 United Kingdom 35 Permanent Representatives Committee 39 Coreper II 40 Coreper I 42 Article 113 Committee 44 Special Committee on Agriculture 44 Standing Committee on Employment 44 Budget Committee 44 Scientific and Technical Research Committee (Crest) 45 Education Committee 45 Committee on Cultural Affairs 46 Select Committee on Cooperation Agreements between the Member States and third countries 46 Energy Committee 46 Standing Committee on Uranium Enrichment (Copenur) 47 Working parties 47 Permanent Representations 49 Belgium 50 Denmark 54 Federal Republic of -

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg 2004
2004 The Government of the Grand Duchy of Luxembourg Biographies and Remits of the Members of Government Updated version July 2006 Impressum Contents 3 Editor The Formation of the New Government 7 Information and Press Service remits 33, bd Roosevelt The Members of Government / Remits 13 L-2450 Luxembourg biographies • Jean-Claude Juncker 15 19 Tel: +352 478-2181 Fax: +352 47 02 85 • Jean Asselborn 15 23 E-mail: [email protected] • Fernand Boden 15 25 www.gouvernement.lu 15 27 www.luxembourg.lu • Marie-Josée Jacobs ISBN : 2-87999-029-7 • Mady Delvaux-Stehres 15 29 Updated version • Luc Frieden 15 31 July 2006 • François Biltgen 15 33 • Jeannot Krecké 15 35 • Mars Di Bartolomeo 15 37 • Lucien Lux 15 39 • Jean-Marie Halsdorf 15 41 • Claude Wiseler 15 43 • Jean-Louis Schiltz 15 45 • Nicolas Schmit 15 47 • Octavie Modert 15 49 Octavie Modert François Biltgen Nicolas Schmit Mady Delvaux-Stehres Claude Wiseler Fernand Boden Lucien Lux Jean-Claude Juncker Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean Asselborn Jean-Marie Halsdorf Marie-Josée Jacobs Jean-Louis Schiltz Luc Frieden 5 The Formation of the New Government The Formation of Having regard for major European events, the and the DP, Lydie Polfer and Henri Grethen, for 9 Head of State asked for the government to preliminary discussions with a view to the for- the New Government remain in offi ce and to deal with current matters mation of a new government. until the formation of the new government. The next day, 22 June, Jean-Claude Juncker again received a delegation from the LSAP for The distribution of seats Jean-Claude Juncker appointed a brief interview. -

GREECE JANUARY-JUNE 1994 Meetings and Press Releases April
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION PRESS RELEASES PRESIDENCY: GREECE JANUARY-JUNE 1994 Meetings and press releases April 1994 Meeting number Subject Date 1745th Fisheries 12 April 1994 1746th General Affairs 18-19 April 1994 1747th Transport 18 April 1994 1748th Labour/Social Affairs 19 April 1994 1749th Civil Protection 21 April 1994 1750th Industry 22 April 1994 1751st Agriculture 25-26 April 1994 1752nd Home Affairs 21 April 1994 1753rd No record of a meeting ) 6165/94 (Presse 59) 1745th Council meeting - FISHERIES - Luxembourg, 12 April 1994 President: Mr Floras CONSTAI\ITINOU State Secretary for Agriculture of the Hellenic Republic 6165/94 (Presse 59- G) EN 1 12.1V.94 The Governments of the Member States and the European Commission were represented as follows: Belgium: Mr Andre BOURGEOIS Minister for Agriculture Denmark: Mr Bjmn WESTH Minister for Agriculture and Minister for Fisheries Mr Thomas LAURITSEN State Secretary at the Ministry of Fisheries Germany: Mr Franz-Josef FElTER State Secretary, Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry Greece: Mr Floras CONST ANTINOU State Secretary for Agriculture Spain: Mr Vincente ALBERO Minister for Agriculture, Fisheries and Food France: Mr Jean PUECH Minister for Agriculture and Fisheries Ireland: Mr David ANDREWS Minister for the Marine Italy: Mr Rocco Antonio CANGELOSI Deputy Permanent Representative Luxembourg: Ms Marie-Josee JACOBS Minister for Agriculture, Viticulture and Rural Development Netherlands: Mr Piet BUKMAN Minister for Agriculture, Nature Conservation and Fisheries Portugal: -

Die Unentbehrlichen Wie Viel Macht Haben Hohe Beamte?
Politische Kultur September 2013 33 Bernard Thomas, Laurent Schmit Die Unentbehrlichen Wie viel Macht haben hohe Beamte? Die Selbstdarstellungen der hohen Staats- Dissonanz“, wie er es nennt, habe er we- Unterschied; Kulturpolitik sei nicht mehr diener sind von verblüffender Ähnlichkeit. der unter Brasseur noch unter Delvaux dermaßen ideologisch geprägt, glaubt Sie umschreiben einen informellen Poli- erlebt. Dockendorf. tikstil: auf kurzen Wegen, unideologisch und persönlich. Es herrscht, so versichert Als die CSV-Kulturministerin Octavie man uns allerseits, der Pragmatismus, die Kompetent, flexibel, nicht zu Modert 2010 einen Nachfolger für Guy Lehre also, die (dem Duden nach) „das sehr spezialisiert und, vor allem, Dockendorf suchte, griff sie, wie ihre Vor- Handeln über die Vernunft stellt und die unpolitisch; so beschreiben gänger, auf einen Quereinsteiger zurück. Wahrheit und Gültigkeit von Ideen und sich die hohen Beamte selbst. Dass die Wahl auf Bob Krieps fiel, erschien Theorien allein nach ihrem Erfolg be- wie ein Luxemburger Pendant zu Nicolas misst“. Politwissenschaftliche Konzepte Sarkozys „ouverture à gauche“, der Frédéric beißen auf Watte. Guy Dockendorf war Französischlehrer Mitterrand einen Ministerposten ver- „in der Provinz“ (Diekirch) als ihm Jacques dankte. Die Luxemburger Sozialdemokra- Michel Lanners, erster Regierungsberater Santer nach den Wahlen im Juni 1989 tie hatte Robert Krieps – Bob Krieps Vater – im Erziehungsministerium, betont gleich den Job des ersten Regierungsrates im in den Jahren zuvor zu einer Ikone stili- zu Anfang des Gesprächs: „Die Ideologie Kulturministerium anbot. Warum man siert, an die die CSV-Ministerin nun ge- ist dabei aus der Schulpolitik zu weichen. ihn gefragt hat, wisse er bis heute nicht: nealogischen Anschluss fand. Bob Krieps An ihre Stelle tritt die Internationalisie- „Ich glaube wegen meines Vaters, der sehr bezeichnet sich selbst als „Maverick“ (Frei- rung und die sich schnell entwickelnden geachtet wurde und der in Luxemburg geist). -

Results Elected Members
Results and Elected Members Second edition based on official statistics where available 13 JuLy, 1989 PE 133.341 C 0 N T E N T S Electorate and turnout in the 12 . 1 Great Britain . 2 Northern Ireland . 3 Great Britain constituency results .................................... 4 Ireland constituency results .......................................... 14 Belgium ............................................................... 16 Denmark ............................................................... 18 France ................................................................ 20 Germany . 22 Greece ................................................................ 24 Ireland ............................................................... 26 Italy ................................................................. 28 Luxembourg . 31 Netherlands ........................................................... 33 Portugal .............................................................. 35 Spain ......................... : . ...................................... 37 United Kingdom ........................................................ 39 EUROPEAN ELECTIONS Electorate and turnout in EC states in 1979, 1984 and 1989 Country Electorate Turnout V\J.lid votes Belgium 1989 7,096,273 90.7 5,899,285 1984 6,975,677 92.2 5,725,837 1979 6,800,584 91.4 5,442,867 Denmark 1989 3,923,549 46.2 1,789,395 1984 3,878,600 52.4 2,001,875 1979 3,754,423 47.8 1,754,350 France 1989 38,348,191 48.7 18,145,588 1984 36,880,688 56.7 20,180,934 1979 35,180,531 60.7 20,242,347 Germany 1989 45,773,179 62.3 28,206,690 1984 44,451,981 56.8 24,851,371 1979 42,751,940 65.7 27,847,109 Greece 1989 8,347.387 79.9 6,544,669 1984 7,790,309 77.2 5,956,060 1981 7,319,070 78.6 5,753,478 Ireland 1989 2,453,451 68.3 1,632, 728 1984 2,413,404 47.6 1,l20,-ll6 1979 2,188, 798 63.6 1 '339. -

·European. Elections Results And· Elected Members
·European. elections 14-17 June 198~ Results and· Elected Members as at July 1984 Second revised edition based on official results for Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg and the Netherlands. Official results for the UK are not expected before October. NB: The list of Italian members is incorrect. Luxembourg members are missing. For corrections, see European Community News No. 26/84. Directorate-General for Information and Public Relations Publications and Briefings Division -1- EUROPEAN ELECTIONS Electorate and turnout in EC states in 1979 and 1984 r-- Country Electorate Turnout Valid votes Belgium 1984 6,975,677 92.2 5,725,837 1979 6,800,584 91.4 5,442,867 Luxembourg 1984 215,792 88.8 173,888 1979 212,740 88.9 170,759 Italy 1984 44,438,303 83.4 35,0913,046 1979 42,193,369 84.9 35,042,601 Greece 1984 7,790,309 77.2 5,956,060 1981 7,319,070 78.6 5,753,478 Germany 1984 44,451,981 56.8 24,851,371 1979 42,751,940 65.7 27,847,109 France 1984 36,880,688 56.7 20,180,934 1979 35,180,531 60.7 20,242,347 Denmark 1984 3,87"8,600 52.4 2,001,875 1979 3,754,423 47.8 1,754,850 Netherlands 1984 10,4 7 6, 000 50.57 5,297,621 1979 9,808,176 58.1 5,667,303 Ireland 1984 2,413,404 47.6 1,120,416 1979 2,188,798 63.6 1,339,072 United Kingdom 1984 42,984,998 32.56 13,998,188 1979 41, 57 3, 897 32.3 13,446,091 Total 1984 200,505,752 59 114 , 4 o4 , 2 3 6 1979 191,783,52~ 62.5 116,706,4 77 -2- Belgium The Socialists win two seats and the Christian Democrats lose four as a result of the second EP elections. -

Der Mann Ohne Eigenschaften Jean-Claude Juncker Zu Seinem Dreißigsten Regierungsjubiläum
4 forum 324 30 Jahre Jean-Claude Juncker Laurent Schmit, Jürgen Stoldt, Bernard Thomas Der Mann ohne Eigenschaften Jean-Claude Juncker zu seinem dreißigsten Regierungsjubiläum Nach 30 Jahren Regierungsbeteiligung und 18 Jahren im Amt des Premierministers schien es uns angebracht, das Phänomen Juncker einer vorläufigen Analyse zu unterziehen. Was als Zwischenbilanz gedacht war, könnte jedoch vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Wochen wie ein erster Abschiedstext gelesen werden. Das Ende der politischen Laufbahn Jean-Claude Junckers scheint vorgezeichnet. Die Geschichte begann vor genau 30 Jah- es aber nicht für notwendig, sie an der Ent- Modernisierungswerkstatt der Partei. Das ren in einer Pariser Hotelsuite. Wenige scheidung zu beteiligen. Erna Hennicot- Experiment gelang ausreichend gut: 1979 Tage zuvor hatte Landwirtschaftsminis- Schoepges, die damalige Präsidentin der wurde Werner nach fünf Jahren unerbittli- ter Camille Ney aus gesundheitlichen Christlich-Sozialen Frauen, kritisierte den cher Opposition wieder Staatsminister. Gründen sein Amt abgegeben. Der engere Entschluss ebenfalls. Aus ihrer Sicht hätte Machtzirkel der CSV befand sich in der Wie ein fleißiger Student habe er sich zu französischen Hauptstadt, um an einem Beginn auf jede Regierungsratssitzung Kongress der Europäischen Volkspartei Jean-Claude Juncker bezeichnet sich vorbereitet, erzählt Juncker, um sich ja teilzunehmen. Nun saßen Premierminis- noch heute gerne als Werners „fils keine Blöße gegenüber seinem Chef und ter Pierre Werner, Arbeitsminister Jacques spirituel“, um eine Kontinuität zum Mentor zu geben. 1984 hatte er seine Santer und Parteipräsident Jean Spautz Patriarchen zu konstruieren. Gönner überzeugt und durfte das Arbeits- zusammen, um zu entscheiden, wer in die ministerium von Jacques Santer überneh- Regierung nachrücken solle. Spautz und men. -

Greece July-December 1988
COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES PRESS RELEASES PRESIDENCY: GREECE JULY-DECEMBER 1988 Meetings and press releases November 1988 Meeting number Subject Date 1270th Interior/Civil Protection 4 November 1988 1271 st Economics/Finance 7 November 1988 1272na Energy 8 November 1988 1273ro Agriculture 14-15 November 1988 I 274m Research 17 November 1988 1275th Internal Market 18 November 1988 1276tn General Affairs 21-22 November 1988 127th Budget 22 November 1988 1278m Education 23 November 1988 1279m Development Co-operation 23 November 1988 1280tn Environment 24-25 November 1988 1281 St Fisheries 28 November 1988 COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES GENERAL SECRETARIAT PRESS RELEASE 8880/88 (Presse 160) 1270th meeting of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council (Ministers for the Interior/Civil Protection) Brussels, 4 November 1988 President: Mr Apostolos TSOCHATZOPOULOS Minister for the Interior of the Hellenic Republic Presse 160 - G - 1 - - 2 - 4.XI.B8 The Governments of the Member States and the Commission of the European Communities were represented as follows: Belgium Mr Louis TOBBACK Minister for the Interior, for Modernization of the Public Utilities and for National Scientific and Cultural Institutions Mr Balder POSTHUMA Minister Plenipotentiary Denmark Mr Thor PEDERSEN Minister for the Interior and for Nordic Co-operation Germany Mr Carl-Dieter SPRANGER Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for the Interior Greece Mr Apostolos TSOCHATZOPOULOS Minister -
2004 Au 30 Septembre 2004
Le Médi ateu r au se rvic e des ci toye ns Rapport d’activité du 1 er mai 2004 au 30 septembre 2004 PAGE Chambre des Députés RAPPORT INTERMEDIAIRE (du 1er mai 2004 au 30 septembre 2004) adressé à la Chambre des Députés par Marc Fischbach Médiateur PAGE 2 Chambre des Députés Monsieur Lucien WEILER, Président 17, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxembourg Monsieur le Président, Conformément à l’article 8 de la du 22 août 2003 instituant un Médiateur, j’ai l’honneur de vous transmettre le premier rapport intermédiaire du Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg, couvrant la période du 1er mai 2004 au 30 septembre 2004. Je vous en souhaite bonne réception et je reste à votre entière disposition. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. Le Médiateur, Marc FISCHBACH PAGE 3 Le bon fonctionnement d’une démocratie est essentiellement tributaire de la confian- ce qui règne entre le citoyen et l’administration publique. Cela est d’autant plus vrai dans un Etat de droit où, par l’extension constante et les réaménagements de plus en plus fréquents de l’arsenal législatif et réglementaire, voire du domaine d’intervention public, le citoyen éprouve de plus en plus de diffi- cultés pour suivre et comprendre les actes et les procédures de l’administration. Aussi l’institution d’un Médiateur mise en place le 1 er mai 2004 n’a-t-elle d’autre finalité que d’offrir aux citoyens de nouvelles perspectives pour se faire entendre et pour par- ticiper aux processus de décision qui les concernent.