Der Teutoburger Waldh. Von Dechen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
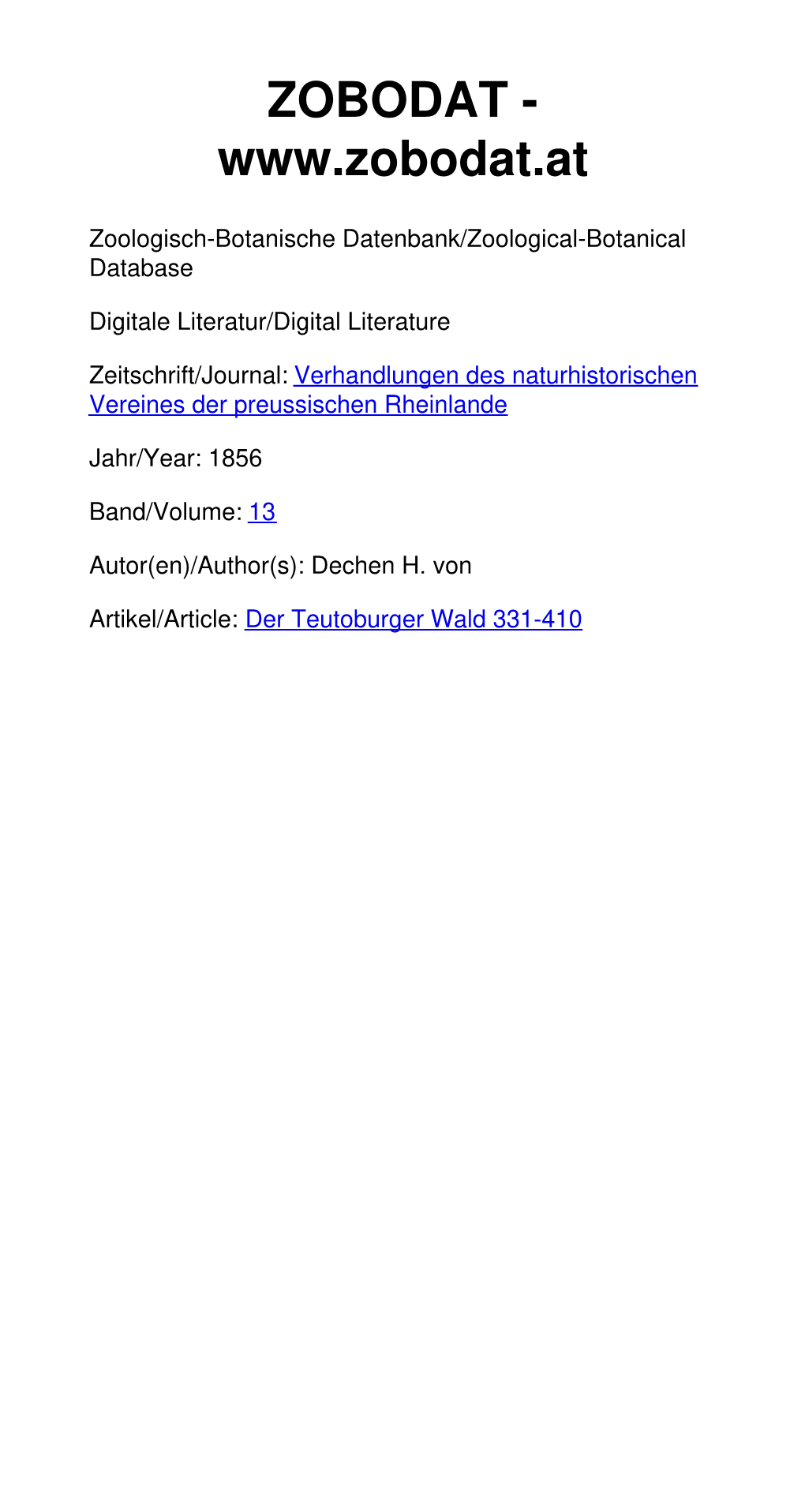
Load more
Recommended publications
-

Gesunde Wanderung Im Teutoburger Wald Moderne Medizin in Sieben Kliniken Und Quelllebendig Wandern Wandertour
www.dwt.2015.de 1 Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, wir freuen uns, Sie zum 115. Deutschen Wandertag 2015 nach Paderborn einladen zu dürfen. Bereits zum dritten Mal ist der Eggegebirgsverein stolzer Ausrichter dieser traditionsreichen Veranstaltung. Gerne nutzen die rund 6.500 Mitglieder des mehr als 110 Jahre jungen Vereins die Gelegenheit, Ihnen vom 17. bis zum 22. Juni 2015 ihre Heimatregion vorzustellen. Erste Eindrücke von der Vielfalt des Paderborner Landes und der Nachbarregionen vermittelt dieses Magazin: So stellt sich auf den folgenden Seiten der Hauptveran- staltungsort Paderborn vor, eine junge, moderne Universitäts-Stadt mit einer mehr als 1.200-jährigen, spannenden Geschichte. Die gastfreundliche westfälische Metropole ist der ideale Ausgangspunkt für erlebnisreiche Wanderungen in naturschönen, vielfältigen Landschaften: durch die tiefen Wälder und über die Kämme des Eggegebirges etwa. Oder über die weite Karstlandschaft der Paderborner Hochfläche. Und natürlich durch die Kiefernwälder und über die urwüchsige Heide der Senne. Abrunden lässt sich das „klassische“ Wander- programm durch kurzweilige Stadtrundgänge, ausgedehnte Radtouren und spannende GPS-Ausflüge. Mit diesem Magazin wollen wir zudem einen ersten Eindruck vom reichen und vielgestaltigen kulturellen Angebot der zehn Städte des Kreises Paderborn vermitteln. Dieses bietet die besten Voraussetzungen für ein attraktives Rahmenprogramm Ihres Wander-Urlaubs bei uns. Wir sind überzeugt, dass wir den 115. Deutschen Wandertag 2015 für unsere Gäste zu einem unvergesslichen -
Fietsroutes in Het Paderborner Land
Fietsen in het Paderborner Land MustertextWelkom in het Paderborner Land 2 3 Breitegrund Ummeln Schillingshof AS Währentrup Boller- Nienhagen Dorla Lutter Bielefeld/Sennestadt OERLINGHAUSEN Hellwege bruch Meschesee Mosebeck Jerxen-Orbke Herberhausen Cappel FietsroutesSENNE 1 in het PaderbornerSteinbült Land Werre Windelsbleiche Im Hellenburg Meierberg Ramsbrock Welschen 270 Mossen- Wistinghausen Stapelage Hiddentrup Niederschönhagen berg Kranzmann AK Barkhauser Hakedahl Isselhorst Windflöte Bielefeld SENNESTADT Berge Pivitsheide Vahlhausen 293 Hörste Schwarzen- Hohenwart Lipper- Südstadt T brink Stapelager Hörster Bruch Egge reihe E Heiden- DETMOLD Diestelbruch Berge Brüntrup Heidegrund oldendorf U 365 Kl. Ehberg Kussel Rödling- hausen 68 Dalbke Wistinghauser T 217 Friedrichs- Senne Kahler Langer Berg dorf Ehberg Een fascinerende omgeving met O 251 Eckardtsheim Hiddesen Hülsen Nordhorn Oerlinghauser Stapelager Gr. Ehberg 224 Drostenkamp Schanze Leistruper Avenwedde Heide- Senne B 340 Spork- AS blümchen Senne Eichholz Schloß Holte/ Kröppel- interessante bezienswaardigheden: 2 Unter der feld Wald Stukenbrock Heidehaus U Grotenburg Remmig- hausen Fissenknick 33 Stukenbrock R Wellnerberg deze aantrekkelijke combinatie van Schönemark Dalkebach Sende Heiligenkirchen Hornolden- Maßbruch Senne- dorf Wehren Siewecke Schloß G Hellberg Remmighauser 1 W Berg 239 Holte ie m natuur en cultuur ontdekt u tijdens 242 Bad AUGUSTDORF 346 b Wällen H o l t e r Schling e c Meinberg E Berlebeck ke GÜTERSLOH Hahnberg onze fietsroutes! W a l d R Sundern Sürenheide Mühlgrund SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK Stemberg Fromhausen Verler Napte See HORN - BAD AS VERL Dressel- MEINBERG Gütersloh haus Vahlhausen N a t u r p a r k Stemberg Holzhausen- Moorlage Spexard W Externsteine 402 Beleef de hoogvlaktes van het Pa- ch Horn Bellenberg ba en Bornholte d Siedlung o Liemke Heimathof R Falkenberg Bärenstein Determeyer ch Elserheide ba pel A 318 derborner Land, de uitlopers van het a W h Gr. -

Wanderplan 2016
Wanderplan 2016 01.01.16 (Fr., Neujahr) W 01 – Neujahrswanderung, ca. 10 km Wandergebiet: An den Externsteinen, hinterher Einkehr im Hotel Bärenstein. Abmarsch: 12.30 Uhr ab Parkplatz bei Hotel Bärenstein in Holzhausen Externsteine Wanderleiter: Elisabeth und Winfried Knuth, Lage, Tel.: 05232/5890 oder [email protected] 10.01.16 (So.) W 02 - Schneeschuhwanderung mit Glühwein Wandergebiet: Bavenhausen, Erbholz, Kleeberg Schneeschuhe können gegen eine Gebühr von 5,-€/Paar in der Sektion ausgeliehen werden. Es gibt 15 Paar Schneeschuhe. Mitzubringen wären noch Wanderstöcke. Wenn nicht genügend Schnee liegt, wird eine normale Halbtagswanderung zu Fuß im gleichen Wandergebiet angeboten (auch mit Glühwein). Sollte am 17.01.16 ausreichend Schnee für eine Schneeschuhwanderung vorhanden sein, wird nur eine Schneeschuhwanderung im Gebiet Bavenhausen durchgeführt. Diese Option ist nur als Ersatztermin gedacht. Die Schneeschuhe werden zu Beginn der Wanderung ausgeteilt, es muss sich nicht jeder selbst um Schneeschuhe kümmern. Abmarsch: 13.30 Uhr ab Bavenhausen, Parkplatz Ortsmitte in der Nähe vom Gasthaus Rieke Anmeldung unbedingt erforderlich bis Donnerstag, 07.01.16 bzw.14.01.16 wegen Ausleihe Schneeschuhe Wanderleiterin: Renate Koralewicz, Rentorf, Tel.: 05261/15878, mobil 0170-4614240 30.01.2016 (Sa.) W 03 - Pickertwanderung, ca. 12 km Wandergebiet: In der Umgebung von Hillentrup, Rundwanderung. Abfahrt: 11.30 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus (Nähe Bahnhof). Abmarsch: 12.00 Uhr ab Hillentrup, Bauernhofpension „Waldmühle“. Nach der Wanderung ab ca. 15 Uhr, Einkehr in der Bauernhofpension „Waldmühle“ in Hillentrup, Waldmühlenweg 1, 32694 Dörentrup-Hillentrup. Auch Nichtwanderer sind zum Pickertessen herzlich willkommen. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt, daher bitte rechtzeitig anmelden, spätestens bis zum 27.01.2016. -
Wanderplan Ab Mai 2016
Wanderplan ab Mai 2016 01.05.16 (So.) W 14 – Tageswanderung auf dem Pilgerweg, 4. Etappe, Streckenwanderung, 19 km Wandergebiet: Schieder, ev. ref. Kirche Schieder, Schwalenberger Wald, Kirche Schwalenberg, Dohlenberg, Biesterfeld, Rischenau, Kloster Falkenhagen. Rucksackverpflegung, nach der Wanderung Einkehr. Abfahrt: 09.00 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus, (Nähe Bahnhof) Abmarsch: 10.00 Uhr ab ev. ref. Kirche Schieder Wanderleiter: Elisabeth und Winfried Knuth, Lage, Tel.: 05232/5890 oder [email protected] 08.05.16 (So.) W 15 – Tageswanderung über das Schwalenberger Mörth, 20 km Wandergebiet: Schwalenberg, Brakelsiek, Schieder, Kahlenberg, über das Mörth zurück nach Schwalenberg. Rundweg, viel Wald mit einigen Ausblicken. Rucksackverpflegung, Einkehr nach der Wanderung. Abfahrt: 08.30 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus, (Nähe Bahnhof) Abmarsch: 09.15 Uhr ab Schwalenberg, Parkplatz Mengersen Strasse Wanderleiterin: Angelika Hoffmann, Lemgo, Tel.: 05261/72650 14.05.16 (Sa.) W 16 – Leistungswanderung, Gemeinschaftswanderung der Sektionen Lippe-Detmold und Paderborn, 57 km Wandergebiet: Über den gesamten Residenzweg. Berlebeck, Bielstein, Donoperteich, Heiden, Mosebeck, Vahlhausen, Wilberg, Fromhausen, Berlebeck. Rucksackverpflegung, ausreichend Getränke (2Liter). Abmarsch: 06.00 Uhr ab Adlerwarte Berlebeck, Parkplatz Hangsteinstraße Anmeldung erforderlich bis 12.05.16 Wanderleiter: Michael Nordmann, Detmold, Tel.: 0171-8653114 16.05.16 (Pfingstmontag) W 17 – Frühwanderung zwischen Gauseköte und B1, ca. 15 km Wandergebiet: im Bereich Holzhausen/Externsteine- Kreuzkrug- Barnacken Abfahrt: 05.00 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus, (Nähe Bahnhof) Abmarsch: 05.20 Uhr ab Holzhausen/Externsteine, Parkplatz bei Landhotel Haus Weber Nach der Wanderung wird zum Frühstück im Landhotel Weber eingekehrt. Wanderleiterin: Beate Lippert, Detmold, Tel.: 05231/3052318, mobil 0173-3544821 22.05.16 (So.) W 18 – Radtour: Mühlentour an der Weser, 45 km Tourgebiet: Minden, Petershagen, Fähre bei Windheim, Lade, Dankersen, Minden. -

Ausgabe Nr. 32
Ausgabe Nr. 32 Neues vom Hundetalk Kopf-Hals-Krebs Jagen mit Hund, Frettchen Früherkennung rettet Leben und Greifvogel Ab in den Schnee Ein Tipp der Reise-Expertin Raus aus der Komfortzone Wolfsschatten aus dem Roman Volker Hoffschmidt "Mörderisches Lipperland" cool, neu, anders von Christian Jaschinski www.reporter-lippe.de Preise Preise Wochentag Uhrzeit Preis/Std MoWochentag - Do 16.00 Uhrzeit - 19.00 Preis/Std Uhr 17,- € Mo 19.00 - Do - 23.00 16.00 Uhr - 19.00 20,- Uhr € 17,- € 19.00 - 23.00 Uhr 20,- € Fr, Sa & vor 15.00 - 19.00 Uhr 17,- € FeiertagenFr, Sa & vor 19.0015.00 -- bis19.00 Ende Uhr 24,- 17,- € € Feiertagen 19.00 - bis Ende 24,- € So & Feiertage 14.00 - 19.00 Uhr 17,- € Freuen Sie sich auf: So 19.00 & Feiertage - 23.00 Uhr 14.00 20,- - 19.00 € Uhr 17,- € Freuen Sie sich auf: 19.00 - 23.00 Uhr 20,- € 10 Bowlingbahnen, 2 Billardtische, 2 Turnier Darts Leihschuhe 1,60 € | Einzelpreise auf Anfrage und10 Bowlingbahnen, einen Air-Hockey 2 Billardtische, 2 Turnier Darts Leihschuhe 1,60 € | Einzelpreise auf Anfrage Billard: 1,00 € p. Spiel und einen Air-Hockey Billard: 1,00 € p. Spiel Alle Spiele der Fußball Bundesliga live übertragen. Dart:Billard: 0,50 1,00 € €p.Spiel p. Spiel Airhockey: WirAlle sindSpiele eine der lizensierte Fußball Bundesliga Sky Sportsbar. live übertragen. Airhockey:Dart: 0,50 € p.Spiel1,00 € p. Spiel Wir sind eine lizensierte Sky Sportsbar. Airhockey: 1,00 € p. Spiel Kleine und große Köstlichkeiten aus unserer Küche. Parken in der Tiefgarage für 1,50 € WerfenKleine und Sie malgroße einen Köstlichkeiten Blick in die ausSpeisekarte. -
Radrouten Und Pauschalangebote Im Paderborner Land Mustertextwillkommen Im Paderborner Land
Radfahren Radrouten und Pauschalangebote im Paderborner Land MustertextWillkommen im Paderborner Land 2 3 Breitegrund Ummeln Schillingshof AS Währentrup Boller- Nienhagen Dorla Lutter Bielefeld/Sennestadt OERLINGHAUSEN Hellwege bruch Meschesee Mosebeck Jerxen-Orbke Herberhausen Cappel RadroutenSENNE 1 im PaderbornerSteinbült Land Werre Windelsbleiche Im Hellenburg Meierberg Ramsbrock Welschen 270 Mossen- Wistinghausen Stapelage Hiddentrup Niederschönhagen berg Kranzmann AK Barkhauser Hakedahl Isselhorst Windflöte Bielefeld SENNESTADT Berge Pivitsheide Vahlhausen 293 Hörste Schwarzen- Hohenwart Lipper- Südstadt T brink Stapelager Hörster Bruch Egge reihe E Heiden- DETMOLD Diestelbruch Berge Brüntrup Heidegrund oldendorf U 365 Kl. Ehberg Kussel Rödling- hausen 68 Dalbke Wistinghauser T 217 Friedrichs- Senne Kahler Langer Berg dorf Ehberg O 251 Eckardtsheim Hiddesen Hülsen Nordhorn Oerlinghauser Stapelager Gr. Ehberg 224 Drostenkamp Faszinierende Landschaften mit herausra- Schanze Leistruper Avenwedde Heide- Senne B 340 Spork- AS blümchen Senne Eichholz Schloß Holte/ Kröppel- 2 Unter der feld Wald Stukenbrock Heidehaus U genden Sehenswürdigkeiten: Diese Kom- Grotenburg Remmig- hausen Fissenknick 33 Stukenbrock R Wellnerberg Schönemark bination präsentieren wir Ihnen bei den Dalkebach Sende Heiligenkirchen Hornolden- Maßbruch Senne- dorf Wehren Siewecke Schloß G Hellberg Remmighauser 1 W Berg 239 Holte ie m 242 Bad dargestellten Radrouten. AUGUSTDORF 346 b Wällen H o l t e r Schling e c Meinberg E Berlebeck ke GÜTERSLOH Hahnberg W a l d R Erfahren Sie die Paderborner Hochfläche, Sundern Sürenheide Mühlgrund SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK Stemberg Fromhausen Verler HORN - Napte See BAD die Ausläufer des nördlichen Sauerlandes, AS VERL Dressel- MEINBERG Gütersloh haus Vahlhausen N a t u r p a r k Stemberg Holzhausen- Moorlage Spexard W Externsteine 402 das Radlerparadies Delbrück oder das ein- ch Horn Bellenberg ba en Bornholte d Siedlung o Liemke Heimathof R Falkenberg Bärenstein Determeyer ch Elserheide lba zigartige Naturschutzgebiet Moosheide e A 318 ap W h Gr. -

Inhaltsverzeichnis TOP 26 2.00 Std
Nördlicher Teutoburger Wald und Wiehen . 84 Inhaltsverzeichnis TOP 26 2.00 Std. Tierpark Olderdissen – Hünenburg Bielefeld . 86 TOP 27 4.15 Std. Werther Schanze – Bußberg – Jakobsberg . 88 Vorwort . 3 TOP 28 4.15 Std. Halle – Barenberg – Ravensberg . 90 TOP 29 4.00 Std. Wellingholzhausen – Beutling – Blauer See . 92 Übersichtskarten . 6 TOP 30 3.30 Std. Bad Iburg – Freeden – Limberg . 94 TOP 31 3.00 Std. Dörenberg – Varusturm – Bardenburg . 96 Allgemeine Hinweise . 10 TOP 32 3.10 Std. Hagen – Borgberg – Duvensteine . 99 TOP Die Top-Touren im Teutoburger Wald . 10 TOP 33 4.30 Std. Leeden – Schollbruch – Lengericher Berg . 102 TOP TOP 34 4.45 Std. Tecklenburg – Leeden – Lengerich . 104 Wandern im Teutoburger Wald . 12 TOP TOP 35 3.00 Std. Tecklenburg – Brochterbeck . 107 TOP Informationen und Adressen . 18 TOP 36 2.30 Std. Hockendes Weib – Dreikaiserstuhl – Brochterbeck . 110 TOP GPS-Tracks und Koordinaten der Ausgangspunkte . 19 TOP 37 4.15 Std. Riesenbeck – Dörenther Klippen – Dortmund-Ems-Kanal . 112 TOP Sport und Freizeit . 20 TOP 38 2.45 Std. Bevergern – Riesenbecker Berg – Nasses Dreieck . 114 TOP TOP 39 4.25 Std. Rheine – Gellendorfer Mark – Bevergern . 116 TOP TOP 40 4.25 Std. Hopsten – Heiliges Meer – Dicke Eiche . 118 TOP Teutoburger Wald / Eggegebirge . 24 TOP 41 4.10 Std. Bippener Maiburg – Hekese . 120 TOP 1 4.45 Std. Marsberg – Obermarsberg – Priesterberg . 28 TOP 42 4.30 Std. Dümmerlohausen – Hüde – Lembruch . 122 TOP 2 3.35 Std. Blankenrode – Essentho – Marsberg . 32 TOP 43 4.00 Std. Mühlenort – Süntelstein – Venner Turm . 124 TOP 3 4.15 Std. Scherfede – Hardehausen – Schwarzbachtal . 34 TOP 44 4.30 Std. -

Wanderplan 2019
Wanderplan 2019 01.01.19 (Di., Neujahr) W 1 – Neujahrswanderung, Rundwanderung in der Umgebung des Silberbachtals, 10 km Wandergebiet: Zwischen Silbermühle und Velmerstot, Abfahrt: 11.30 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus (Nähe Bahnhof) Abmarsch: 11.50 Uhr ab Parkplatz Silberbachtal, 300m vor der Schranke Wanderleiterin: Beate Lippert, Detmold, Tel.: 05231/3052318, mobil 0173-3544821 oder [email protected] 20.01.19 (So.) W 2 – Pickertwanderung Wandergebiet: Zwischen Holzhausen Externsteine und Horn, ca. 12 km Nach der Wanderung, ab ca. 15 Uhr, Einkehr im Gasthaus/Hotel „Waldesruh“ in Holzhausen, Ruheweg 8, 32805 Horn-Bad Meinberg. Auch Nichtwanderer sind zum Pickertessen herzlich willkommen. Anmeldung bitte spätestens bis zum 15.01.2019. Parkmöglichkeit: oberste Einfahrt Holzhausen, dann gleich links Parkplatz am Waldrand Abfahrt: 11.30 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus (Nähe Bahnhof). Abmarsch: 11.50 Uhr ab oben beschriebenem Parkplatz Wanderleiterin: Beate Lippert, Detmold, Tel.: 05231/3052318, mobil 0173-3544821 oder [email protected] 17.02.19 (So.) W 3 – Kaiser-Wilhelm Denkmal und Wittekindsburg im Wiehengebirge, 13 km Vom Wanderparkplatz Kaiserhof über Kaiser-Wilhelm Denkmal, Moltketurm, Dehmer Burg, Gut Wedigenstein, Kaiserhof. Rucksackverpflegung, evtl. Einkehr nach der Wanderung. Abfahrt: 09.30 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus (Nähe Bahnhof) Abmarsch: 10.30 Uhr ab Wanderparkplatz Kaiserhof Wanderleiter: E. und W. Knuth, Lage, Tel.: 05232/5890 oder [email protected] 17.03.19 (So.) W 4 – Wanderung auf dem Pilgerweg, von Lemgo nach Detmold, 10 km Wandergebiet: Lemgo, Wahmbeck, Loßbruch, Herberhausen, Detmold. Einkehr nach der Wanderung Abfahrt: 09.00 Uhr ab Detmold, Sinalcohaus (Nähe Bahnhof) Abmarsch: 09.30 Uhr ab Lemgo, Parkplatz hinter der alten Post, Ecke Bruchweg/Pöstenweg Wanderleiter: E. -

Teutoburger Waldes Als Nationalpark
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) Gutachten zur Eignung des Teutoburger Waldes als Nationalpark Recklinghausen, Mai 2011 1 Inhaltsverzeichnis Kurzfassung 2 1. Einleitung 3 2. Gebietskulisse 4 3. Gebietsbeschreibung 6 4. Schutzwürdigkeit 12 4.1 Geologie 12 4.2 Lebensräume 14 4.3 Arten 21 5. Kriterien für die Ausweisung eines Nationalparks 27 5.1 Allgemeine Vorgaben 27 5.2 Erfüllung der Nationalparkkriterien nach § 24 BNatSchG 28 5.3 Erfüllung der Qualitätskriterien nach EUROPARC 2008 35 5.4 Erfüllung der IUCN-Kriterien 36 6. Zonierung 36 7. Tourismus 39 8. Zusammenhang mit der Nationalparkplanung für die Senne 39 9. Literatur 41 Anhang 2 Kurzfassung Die vorrangige Aufgabe von Nationalparken ist der Schutz natürlicher oder naturnaher, großräumiger Gebiete oder Ökosysteme von nationaler und internationaler Bedeutung mit dem Ziel, im überwiegenden Teil seines Gebietes die natürliche Dynamik ihrer Lebensgemeinschaften sicherzustellen bzw. zu ermöglichen. Bei dem hier betrachteten Gebiet eines potenziellen Nationalparks Teutoburger Wald mit einer Flächengröße von ca. 8650 ha in den Kreisen Lippe, Höxter und Paderborn handelt es sich um ein international bedeutsames, geschlossenes Waldgebiet mit 5127 ha Buchenwald-FFH-Lebensraumtypen. Die Kombination großflächiger Wälder mit Felsen und Höhlen sowie die Besonderheit großflächiger Sandböden (Podsole) im Mittelgebirge, die auf über 15 % der Fläche von der Senne her hinein streichen, bedingen darüber hinaus die Bedeutung und besondere Eigenart des Gebietes im Vergleich zu den bisherigen Nationalparken in Deutschland. Die Flächen des potenziellen Nationalparks Teutoburger Wald zeichnen sich darüber hinaus ganz im Sinne der Nationalparkziele durch besonders gut ausgebildete Artengemeinschaften natürlicher Lebensräume aus. Das ca. 8650 ha große Gebiet erfüllt die naturschutzfachlichen Voraussetzungen und Kriterien für einen Nationalpark gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Sinne eines Zielnationalparks. -

18. Ornithologischer Sammelbericht Für Den Kreis Lippe 2014
18. ORNITHOLOGISCHER SAMMELBERICHT FÜR DEN KREIS LIPPE 2014 Ornithologischer Sammelbericht 2014; Kreis Lippe Herausgeber: Redaktion und Gestaltung: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Lippe Holger Sonnenburg c./o. Biologische Station Lippe [email protected] Domäne 2 Matthias Füller 32816 Schieder-Schwalenberg [email protected] Tel. 05282-462 (Fax -8620) www.biologischestationlippe.de Christian Stolz [email protected] Bei der Dateneingabe half Niklas Wenke Dase Foto auf der Titelseite (Sperlingskauz) stellte Günter Jäkel freundlicherweise zur Verfügung. Im Sammelbericht verwendete Abkürzungen: ad. = adult (Altvogel) BP = Brutpaar(e) BV = Brutvogel dj = diesjährig(e) dz = durchziehend Ex. = Exemplar(e) immat. = immatur (flügger Jungvogel / noch nicht ausgefärbt) juv. = juvenil (nichtflügger Jungvogel) M = Männchen P = Paar(e) pull. = pullus/pulli (Daunenjunge(s) / Küken) n/m = Anzahl Männchen / Anz. Weibchen; z.B. 4,6 für 4 Männchen und 6 Weibchen üf = überfliegend wf = weibchenfarbig Rev. = Revier(e) rglm. = regelmäßig vj = vorjährig(e) W = Weibchen wdh. = wiederholt ~ = ungefähr > = mindestens Statistik: 2012 2013 2014 Anzahl gemeldeter Arten ~200 207 196 Anzahl gemeldeter Arten bei ornitho.de 194 203 186 Im Bericht besprochene Arten 168 169 174 Datensätze bei ornitho.de 11.129 11.023 12.102 Datensätze gesamt ~12.000 ~13.100 ~15.000 Anzahl Melder 120 125 160 Ausgewertete Internetportale: Erstmals wurden neben sturmmöwe.de und ornitho.de noch weitere Internetmeldeplattformen mit ausgewertet: naturgucker.de, -
Im Paderborner Land Mustertextwillkommen Im Paderborner Land
Radfahren im Paderborner Land MustertextWillkommen im Paderborner Land 2 3 Breitegrund Ummeln Schillingshof AS Währentrup Boller- Nienhagen Dorla Lutter Bielefeld/Sennestadt OERLINGHAUSEN Hellwege bruch Meschesee Mosebeck Jerxen-Orbke Herberhausen Cappel RadroutenSENNE 1 im PaderbornerSteinbült Land Werre Windelsbleiche Im Hellenburg Meierberg Ramsbrock Welschen 270 Mossen- Wistinghausen Stapelage Hiddentrup Niederschönhagen berg Kranzmann AK Barkhauser Hakedahl Isselhorst Windflöte Bielefeld SENNESTADT Berge Pivitsheide Vahlhausen 293 Hörste Schwarzen- Hohenwart Lipper- Südstadt T brink Stapelager Hörster Bruch Egge reihe E Heiden- DETMOLD Diestelbruch Berge Brüntrup Heidegrund oldendorf U 365 Kl. Ehberg Kussel Rödling- hausen 68 Dalbke Wistinghauser T 217 Friedrichs- Senne Kahler Langer Berg dorf Ehberg Inhalt O 251 Eckardtsheim Hiddesen Hülsen Nordhorn Oerlinghauser Stapelager Gr. Ehberg 224 Drostenkamp Schanze Leistruper Avenwedde Heide- Senne B 340 Spork- AS blümchen Senne Eichholz Schloß Holte/ Kröppel- 2 Unter der feld Wald Stukenbrock Heidehaus U Regionale Radwege S. 6 – S. 15 Grotenburg Remmig- hausen Fissenknick 33 R Wellnerberg Stukenbrock Schönemark Dalkebach Sende Heiligenkirchen Hornolden- Maßbruch Senne- dorf Wehren Siewecke Schloß G Hellberg Remmighauser 1 W Berg 239 Holte ie m 242 Bad AUGUSTDORF 346 b Wällen H o l t e r Schling e c Meinberg E Berlebeck ke GÜTERSLOH Hahnberg W a l d R Sundern Sürenheide Mühlgrund SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK Stemberg Fromhausen Lokale Radwege S. 16 – S. 37 Verler Napte See HORN - BAD AS VERL Dressel- MEINBERG Gütersloh haus Vahlhausen N a t u r p a r k Stemberg Holzhausen- Moorlage Spexard W Externsteine 402 ch Horn Bellenberg ba en Bornholte d Siedlung o Liemke R Heimathof Determeyer h Falkenberg Bärenstein ac Elserheide elb A 318 ap W h Gr. -

In Der Schatzkammer Naturerlebniswelt Teuto-Egge
Willkommen in der Schatzkammer NaturErlebnisWelt Teuto-Egge Gebietsbezogenes integriertes ländliches Entwicklungskonzept (GIEK) für die Förderperiode 2015 – 2020 Gebietsbezogenes integriertes ländliches Entwicklungskonzept (GIEK) für die Förderperiode 2015-2020 NaturErlebnisWelt Teuto-Egge Bewerbung Region NaturErlenbisWelt Teuto-Egge Vertreten durch Gemeinde Schlangen Der Bürgermeister Kirchplatz 6 D-33189 Schlangen Tel +49 (0)52 52 / 981-100 Fax +49 (0)52 52 / 97 42 11 [email protected] www.gemeinde-schlangen.de Erstellung der Bewerbungsunterlagen Büro Junker + Kruse Markt 5 D-44137 Dortmund Tel +49 (0)2 31 - 55 78 58 0 Fax +49 (0)2 31 - 55 78 58 50 www.junker-kruse.de Verfasser: Rolf Junker Christina Nitz Holger Pump-Uhlmann Silke Saskia de Roode Titelmotiv Wessel Januar 2015 INHALT 1 Lage und Abgrenzung der Region 6 2 Beschreibung der Methodik 9 3 Ausgangslage / Bestandsaufnahme 11 3.1 Versorgung und Verkehr 11 3.1.1 Erreichbarkeit 11 3.1.2 Nahversorgung 13 3.1.3 Gesundheit 13 3.1.4 Wirtschaft und Arbeit 15 3.2 Bevölkerungsentwicklung, Städtebau, Wohnen 17 3.2.1 Bevölkerungsentwicklung 17 3.2.2 Städtebau/Stadtstrukturen (siehe auch Abschnitt Kultur und Sehenswürdigkeiten) 20 3.2.3 Wohnen 24 3.3 Bildung und Soziales 29 3.4 Natur und Landschaft 35 3.5 Tourismus und Freizeit 43 4 Entwicklungsstrategie 55 4.1 Entwicklungsziele, Leitgedanken und Handlungsfelder 55 4.2 Handlungsempfehlungen und Maßnahmen 60 5 Aktionsplan 62 6 Monitoring und Verfahren zur Selbstevaluierung 86 7 Anhang 90 6 1 LAGE UND ABGRENZUNG DER REGION Die Region NaturErlebnisWelt Teuto – Egge Angaben zur Einwohnerzahl, zur Fläche liegt im Osten Nordrhein-Westfalens.