Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe (Mega)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Le Travail De Parti De Karl Marx Jean Quétier
Théoriser le communisme dans les organisations ouvrières : le travail de parti de Karl Marx Jean Quétier To cite this version: Jean Quétier. Théoriser le communisme dans les organisations ouvrières : le travail de parti de Karl Marx. Philosophie. Université de Strasbourg, 2020. Français. NNT : 2020STRAC017. tel- 03275455v2 HAL Id: tel-03275455 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03275455v2 Submitted on 6 Sep 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ÉCOLE DOCTORALE DES HUMANITÉS (ED 520) Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine (UR 2326) THÈSE présentée par : Jean QUÉTIER soutenue le : 28 septembre 2020 pour obtenir le grade de : Docteur de l’Université de Strasbourg Discipline/ Spécialité : Philosophie Théoriser le communisme dans les organisations ouvrières Le travail de parti de Karl Marx THÈSE dirigée par : M. FISCHBACH Franck Professeur de philosophie, Université de Strasbourg RAPPORTEURS : Mme APRILE Sylvie Professeure d'histoire, Université Paris Nanterre M. BINOCHE Bertrand Professeur de philosophie, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne AUTRES MEMBRES DU JURY : M. HABER Stéphane Professeur de philosophie, Université Paris Nanterre Mme HÜHN Lore Professeure de philosophie, Université Albert-Louis de Fribourg-en-Brisgau M. -

Peace in Print
Peace in print Originally written on the Operating System CP/M 2.2 and the Word Processing Program Word Star 2.2 Converted into and continued in Word Perfect 5.1 and 7.0. Converted into html 2001. Dk=5: 01.6157. 01.6323. 01.63551. 15.7. 32.3. 35.51 Copyright 1991-2001 © Holger Terp. This book is copyright under the Berne Convention. All rights are reserved. Apart from any fair dealing for the purpose of private study research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, 1956, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, chemical, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Holger Terp. Strandbyparken 4. 1 tv. 2650 Hvidovre. Denmark. 009 45 (3) 1 78 40 28. ACKNOWLEDGMENTS Thanks to the late Hans-Henrik Pusch of Copenhagen whose kind generosity inspired and made this work much more complete than it otherwise would have been; Librarian Betty Nielsen, Librarian Katherine Laundry at Canadian Institute for International Peace and Security - Ottawa. The staffs at The Royal Library - Copenhagen, Odense University Library, The Labor Movement Library and Archive - Denmark - Copenhagen, The Labor Movement Archive and Library - Norway - Oslo, The Library of the Nobel Institute - Oslo, The International Institute of Social History - Amsterdam (who keep the files of WRI), International Archives of the Women's Movement - Amsterdam, McCabe Library - Swartmore (where the Swartmore College Peace Collection is located), The Periodical Center - Copenhagen, The Library at Guldbergsgade - Copenhagen, The Royal School of Librarianship at Copenhagen. -

Collected Works of VI Lenin
W O R K E R S O F A L L C O U N T R I E S , U N I T E! L E N I N COLLECTED WORKS GA A THE RUSSIAN EDITION WAS PRINTED IN ACCORDANCE WITH A DECISION OF THE NINTH CONGRESS OF THE R.C.P.(B.) AND THE SECOND CONGRESS OF SOVIETS OF THE U.S.S.R. ИНCTИTУT МАРÇCИзМА — ЛЕНИНИзМА пpи ЦK KНCC B. n. l d H n H С О Ч И Н E Н И Я И з д a н u е ч е m в е p m o e ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ M О С К В А V. I. L E N I N cOLLEcTED WORKS VOLUME GA !ugust 1916 –March 1917 PROGRESS PUBLISHERS MOSCOW TRANSLATED FROM THE RUSSIAN BY M. S. L E V I N, THE LATE JOE FINEBERG AND OTHERS EDITED BY M. S. L E V I N From Marx to Mao M L © Digital Reprints 2011 www.marx2mao.com First printing 1964 Second printing 1974 10102–038 l 164–74 014(01)–74 7 CONTENTS Preface ....................... 11 1916 THE NASCENT TREND OF IMPERIALIST ECONOMISM ...... 13 REPLY TO P. KIEVSKY (Y. PYATAKOV) ........... 22 A CARICATURE OF MARXISM AND IMPERIALIST ECONOMISM .. 28 1. The Marxist Attitude Towards War and “Defence of the Fatherland” ................... 29 2. “Our Understanding of the New Era” ........ 36 3. That Is Economic Analysis? ............ 40 4. The Example of Norway .............. 48 5. “Monism and Dualism” .............. 55 6. The Other Political Issues Raised and Distorted by P. -

Red Camarade
Surat Engels untuk Gerson Trier di Copenhagen (Draft) Friedrich Engels (1889) Diterjemahkan dari Marx-Engels Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscow, 1982, h.386-387. Published by Eko Teguh Pribadi E-mail [email protected] London, 18 Desember 1889 Tuan Trier yang baik, Saya mengucapkan banyak terimakasih atas perbincangan menarik kita yang ke delapan. Bila Saya boleh memberikan pandangan tentang keributan besar yang baru-baru ini melanda kota Copenhagen [*] dimana Anda sendiri menjadi salah satu korbannya, Saya mulai dengan penegasan bahwa Saya tidak sepakat dengan Anda. Anda menolak secara prinsipiil tiap dan segala bentuk kolaborasi, dengan partai- partai lain, betapapun sementaranya hal ini. Saya tidak cukup revolusioner untuk memukul rata hal semacam ini bahwa jika dalam suatu keadaan hal itu adalah lebih menguntungkan atau malah lebih buruk. Kita telah sepakat dalam hal ini: bahwa kaum proletariat tidak akan bisa mengambilalih kekuasaan politik, satu- satunya pintu menuju masyarakat baru, tanpa revolusi kekerasan. Karenanya supaya proletariat sanggup memiliki kekuatan untuk memenangkan pertarungan yang menentukan itu, ia harus. Saya dan Marx telah menyarankan ini sejak 1847 membentuk sebuah partai yang terpisah dari semua (klas, pent) lainnya dan secara tegas melawan semua, sebuah partai yang berkesadaran klas. Namun itu bukan berarti bahwa partai ini tidak boleh dalam momen-momen tertentu menggunakan partai-partai lainnya untuk tujuannya. Ini juga bukan berarti bahwa partai kita tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan sementara pada partai-partai lainnya selama dukungan ini secara langsung menguntungkan kaum proletariat atau maju seiring perkembangan ekonomi ataupun kebebasan politik. Saya memberikan dukungan pada siapapun yang melaksanakan perjuangan nyata di Jerman untuk penghapusan hak istimewa bagi anak sulung dan sisa-sisa tradisi feodal, birokrasi, tarif-tarif perlindungan, UU Anti Sosialis, ataupun pembatasan-pembatasan hak berkumpul dan berorganisasi. -

Modernitet Eller Åndsdannelse?
Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund 1800-1935 Jens Rahbek Rasmussen Museum Tusculanums Forlag Københavns Universitet 2003 [E-bog 2006] Jens Rahbek Rasmussen: Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund 1800-1935 Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 339 E-bog © Museum Tusculanums Forlag 2006 ISBN 87 635 0527 4 ISSN 1901 9173 (online) Uændret gengivelse i pdf-format af: Jens Rahbek Rasmussen: Modernitet eller åndsdannelse? Engelsk i skole og samfund 1800-1935 Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 339 © 2003, Museum Tusculanums Forlag Redaktion: Mogens Herman Hansen Omslag, layout, sats: Pernille Sys Hansen Sat med Aldus Trykt hos Special-Trykkeriet Viborg a-s ISBN 87 7289 868 2 ISSN 0107 9212 Forsideillustration: Plakat af Ib Andersen, Den Britiske Udstilling, 1932. 64 × 170 cm. Gengivet efter Steen Ejlers: Ib Andersens Brugsgrafik. Politiken, København 1984, med tilladelse fra Ib Andersens søn, Povl Valdemar Andersen. Bogen er udgivet med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd Museum Tusculanums Forlag Njalsgade 92 dk-2300 København S www.mtp.dk Copyright © Museum Tusculanums Forlag Indholdsfortegnelse Indledning 7 Småstatsidentitet og modbilleder: Danmark mellem stater og kulturer efter 1864 13 Alternativer til England 17 Tyskland 17 Sverige og Norden 19 Frankrig 20 Englandsbilledet i Danmark 22 Heiberg og Grundtvig 29 Georg Brandes 34 Omkring Boerkrigen 35 Omkring 1. verdenskrig 38 England i danske aviser o. 1900 40 Engelsk fra handelssprog til gymnasiefag 47 Fra latinskolen til den -

V.I. Lenin Udvalgte Værker Bind 6
V.I. Lenin Udvalgte Værker Bind 6 Udvalgte Værker 1914-1917 Forlaget Tiden 1981 V. I. Lenin Udvalgte Værker i 15 bind Redaktion: Eigil Nielsen og Gelius Lund Artiklerne oversat fra russisk efter Lenin: Samlede Værker, bind 26, 27, 29 og 30 5. udgave, Moskva 1969 Oversættere: Side 15- 27: Poul Hansen Side 28- 33: GeliusLund Side 34- 51: Poul Hansen Side 52- 65: Martin Thomsen Side 66-177: Robert Mikkelsen. Denne udgave gennemset og revideret af Martin Thomsen Side 178-182: Jørgen Smith og Birgit Elvang Side 183-197: GeliusLund Side 198-208: Poul Hansen Side 209-211: Martin Thomsen Alle datoer i bogen er angivet efter gammel russisk tidsregning, der var 13 dage efter den nu anvendte tidsregning Oversættelserne © Forlaget Tiden 1981 Tryk: Terpo Tryk ISBN 87-579-0110-4 INDHOLDSFORTEGNELSE Til den danske udgave 7 Krigen Og Det Russiske Socialdemokrati 15 Om Storrussernes Nationalstolthed 23 Hvad Har Processen Mod Den Socialdemokratiske Duma-gruppe Bevist? 28 Om Parolen Europas Forenede Stater 34 Kommentar Fra Redaktionen af Sotsial-Demokrat Til RSDAP's Centralkomités Manifest Om Krigen... 39 Opportunismen Og II Internationales Sammenbrud . 40 Den Socialistiske Revolution og Nationernes Selvbestemmelsesret 52 Imperialismen Som Kapitalismens Højeste Stadium. 66 Om Dialektik 178 Om Junius-brochuren 183 Den Proletariske Revolutions Militærprogram 198 Hele Ti »Socialistiske« Ministre 209 Noter 213 Navneregister 229 TIL DEN DANSKE UDGAVE De tolv skrifter, der er medtaget i dette bind, udgør en lil- le tiendedel af Lenins litterære produktion i tidsrummet fra den første verdenskrigs udbrud i august 1914 til ud- bruddet af revolutionen i marts 1917. Seks af disse skrifter var med i 1947-udgaven af Ud- valgte Værker bd.6, seks andre er nu føjet til, nemlig Hvad Har Processen Mod Den Socialdemokratiske Duma- gruppe Bevist? Kommentar Fra Redaktionen af Sotsial- Demokrat Til RSDAP's Centralkomités Manifest Om Kri- gen, Den Socialistiske Revolution Og Nationernes Selvbe- stemmelsesret, Om Junius-brochuren, Hele Ti »Sociali- stiske« Ministre og Om Dialektik. -
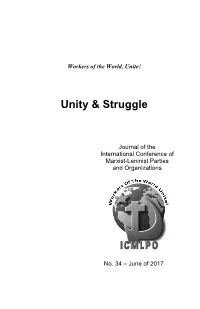
Unity & Struggle
Workers of the World, Unite! Unity & Struggle Journal of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations No. 34 – June of 2017 UNITY & STRUGGLE #34 JUNE 2017 Unity & Struggle Journal of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations. Published in English, Spanish, Turkish, Arabic, Portuguese and German as the responsibility of the Coordinating Committee of the International Conference. Any opinions expressed in this journal belong to the contributors. Postal Address: Verlag AZ, Postfach 401051, D-70410, Stuttgart, Germany Contents Brazil ................................................................................................. 5 The Red Army and the Soviet People Saved Humanity from Nazism Revolutionary Communist Party – PCR Burkina Faso ................................................................................... 15 The October Revolution: Its Teachings on the Question of Nations and Nationalities Revolutionary Communist Party of Volta – PCRV Denmark.......................................................................................... 23 Denmark and the Nordic countries: The rise and fall of the dream of peace and socialism without a revolution Workers’ Communist Party of Denmark – APK Dominican Republic ....................................................................... 37 Hundredth Anniversary of the October Revolution: The Experience of the Soviets Communist Party of Labor – PCT Ecuador .......................................................................................... -

Besprechung Lahme EN
All these circumstances allowed the author to conclude ON THE HISTORY OF OPPOSITION IN DENMARK'S that the nature of the Social DeMocratic Union in the 1880s SOCIAL DEMOCRATIC PARTY. was reformist, as its leaders saw no need for revolutionary changes in the country and sought to achieve their goals by Svetlana Gavrilchenko, Russian State Archive of Socio- gradually transforMing social order froM bourgeois to Political History (E-mail: [email protected]), Rec. ad. socialist. At the saMe time, the importance of the scientific op.: Die Revolutionären. Gerson Trier, Trier, Nicolaj L. theory of socialisM and its assimilation was not denied. Petersen und die Revolutionäre Sozialistische Therefore, Much attention in the LahMe’s work is paid to Arbeiterpartei (RSAP), Dänemarks. Beschreibung und the relationship of Danish socialists with K. Marx and F. Ausblick, Exkurse, Briefe, in: Zeitschrift der Russischen Engels, first as a section of the IAA then to bolster the Akademie der Wissenschaften "Новая и новейшая Marxist views aMong party MeMbers. This was facilitated история" ("Neue und neuere Geschichte") 2020, Nr. 3, by the personal acquaintance of Engels with G. Trier (1851- S. 199-202. Translated froM Russian into English. 1918) and N. L. Petersen (1854- circa 1916), both who had worked in London since 1885. For the book series A new edition of the faMous Danish historian Hans- “Socialistisk Bibliotek” (Socialist Library) published in Norbet Lahme’s work Die Revolutionären. Gerson Trier, Copenhagen, Trier translated Engels’ work “Der Ursprung Trier, Nicolaj L. Petersen und die Revolutionäre der FaMilie, des Privateigentums und des Staates” into Sozialistische Arbeiterpartei (RSAP), Dänemarks Danish. -

Portrætter Af 10 Kommunister
Portrætter af 10 kommunister Morten Thing har tidligere skrevet og udgivet: Dansk socialistisk teori 1850-1900 (med Jette Lundbo Levy), 1973 Ideologier og litteratur, 1973 Marie Nielsen: Revolution, 1975 Karl Marx og Friedrich Engels: Verdensmarkedet 1-3 (med Kjeld Schmidt), 1977-88 Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941 (med Jørgen Bloch-Poulsen), 1979 Planøkonomi og folkefront (med Jørgen Bloch-Poulsen og Hans Erik Avlund Frandsen), 1979 Far mor børn (med Anette Steen Pedersen), 1979. I arbejdernes Rusland. Kobbersmed Niels Johnsens Moskvarejser (med Henning Grelle), 1981 politisk revy i 20 år, 1983 Rud Broby: Blod, 1988 Venskab og revolution. Martin Andersen Nexøs og Marie Nielsens venskab og politiske virke 1918-24 (med Børge Houmann), 1990 1. maj 1890. Et dokumentarium (med Flemming Hemmersam), 1990 Børge Houmann og hans samtid (med Torben Bech Rasmussen), 1992 Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, 1993 Barndommens land (med Søren Vinterberg), 1994 Morten Thing Portrætter af 10 kommunister Tiderne Skifter PORTRÆTTER AF 10 KOMMUNISTER 1996 Morten Thing og Tiderne Skifter Bogen er sat med Galliard Tryk: Clemenstrykkeriet A/S Århus Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Anne Houe Billedredaktion: Morten Thing Printed in Denmark 1995 ISBN 87-7445-672-5 Denne version af Portrætter af 10 kommunister følger den trykte bogs tekst. Billederne er ikke gengivet. Indhold Forord 6 ”Danmarks eneste kommunist” 7 Marie Nielsen 1875-1951 Kobbersmeden 43 Niels Johnsen 1893-1931 I søgen efter kærlighed og sandhed 60 Konrad Simonsen -

Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA), Herausgegeben Von Der Internationalen Marx-Engels-Stiftung (IMES)
Hans-Norbert Lahme Karl Marx / Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA), herausgegeben von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung (IMES). Dritte Abteilung: Briefwechsel, Band 30: Friedrich Engels, Briefwechsel Oktober 1889 bis November 1890, Text (Briefe von und an Friedrich Engels, S. v–xxiii, 1–640) und Apparat (S. 645–1512). Bearbeitet von Gerd Callesen und Svetlana Gavril’cenko. Unter Mitarbeit von Regina Roth und Renate Merkel-Melis, Akademie Verlag: Berlin 2013. € 199,95 Der neueste Band der MEGA2, III/30, trotz seines offiziellen Er- scheinungsdatums erst im Februar / März dieses Jahres ausgelie- fert, bringt die Edition auf nunmehr 62 Bände, also etwas mehr als die Hälfte der geplanten 114 Bände. Von den vier „Abteilungen“, in die sich die Ausgabe gliedert (nämlich I: Werke, Artikel, Entwürfe; II: „Das Kapital“ einschließlich Vorarbeiten; III: Briefwechsel; IV: Exzerpte, Notizen, Marginalien) liegen die 15 Bände von Abteilung II inzwischen vollständig vor und sind zum Teil schon wieder ver- griffen und dabei, neu aufgelegt zu werden. Wenn man bedenkt, dass der zuerst fertiggestellte Band der MEGA2 bereits 1975 erschi- en, dürften bei Beibehaltung des bisherigen Erscheinungstempos im günstigsten Falle zwei, wenn nicht gar drei Generationen ver- gangen sein, bis die geplanten 228 in blaues Leinen gebundenen Halbbände des Marx-Engels’schen Gesamtwerkes einschließlich der Kommentare der Herausgeber / Bearbeiter auf den Regalen der Bibliotheken stehen werden, wobei hinzugefügt werden muss: wenn es denn so weit kommt, was natürlich zu hoffen wäre, jedoch Sozial.Geschichte Online 15 (2015), S. 115–130 (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de) 115 nicht selbstverständlich ist. Den Informationen des Rezensenten zufolge sind Fortführung und erfolgreicher Abschluss der MEGA2 bislang keineswegs gesichert. -
Die Weitere Herausgabe Der Marx-Engels-Gesamtausgabe
Erich KundeIl Alexander Malysch sen wir uns auch mit solchen von der Geschichte längst widerlegten, aber immer wieder neu verwendeten Behauptungen auseinandersetzen, daß die Lehren von Marx und Engels überholt und der Marxismus-Leninismus für die Lösung der politi schen, ökonomischen und sozialen Probleme der Welt von heute ungeeignet wäre. Die weitere Herausgabe MEGA-Forschung und MEGA-Edition leisten ihren spezifischen Beitrag zur theoreti der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) schen und ideologischen Arbeit der kommunistischen und Arbeiterparteien, sie sind und die Perspektiven der Marx-Engels-Forschung ein Teil der Bemühungen zurVerbreitung marxistisch-leninistischen Gedankengutes im internationalen Maßstab. Es ist bereits heute unumstritten, daß mit der MEGA eine neue, höhere Etappe in der Marx-Engels-Forschung und -Edition eingeleitet wurde. Der mit der Vorberei Seit der Veröffentlichung der ersten Bände unserer historisch-kritischen Gesamtaus tung, Herausgabe und Auswertung der MEGA-Bände einhergehende Aufschwung gabe des literarischen Nachlasses von Karl Marx und Friedrich Engels Sind fast auf der Marx-Engels-Forschung wird vor allem in den Herausgeberländern, der UdSSR den Tag elf Jahre vergangen. Nach dem Erscheinen des 20. Bandes der MEGA im und der DDR deutlich; aber auch in anderen Ländern ist eine zunehmende Publika Karl-Marx-Jahr 1983 haben wir inzwischen den 30. Band der internationalen Öffent tionstätigkeit über Leben und Werk von Marx und Engels zu verzeichnen. Die inspi lichkeit vorgelegt. Er kam anläßlich bedeutender Höhepunkte im gesellschaftlichen rierende Rolle der MEGA für die internationale Marx-Engels-Forschung findet unmit Leben der Sowjetunion und der DDR heraus, des XXVII. Parteitages der KPdSU und telbaren Ausdruck in den verschiedenen Publikationsreihen, die diese Ausgabe be des XI. -

University of Copenhagen
Excentriske slægtsskaber En mobilitetsbevidst gentænkning af danske kvindelige kunstnere ca. 1880-1910 Bierlich, Emilie Boe Publication date: 2020 Document version Også kaldet Forlagets PDF Document license: CC BY-NC-ND Citation for published version (APA): Bierlich, E. B. (2020). Excentriske slægtsskaber: En mobilitetsbevidst gentænkning af danske kvindelige kunstnere ca. 1880-1910. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Download date: 01. Oct. 2021 Ph.d.-afhandling Excentriske slægtskaber En mobilitetsbevidst gentænkning af danske kvindelige kunstnere ca. 1880-1910 af Emilie Boe Bierlich Afhandlingen er indleveret til bedømmelse ved Københavns Universitet i november 2019 Den er financieret af Novo Nordisk i form af et Mads Øvlisen-stipendium og huset af Statens Museum for Kunst i perioden 2015-2019 Hovedvejleder: Anne Ring Petersen, professor ved Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Bivejleder: Peter Nørgaard Larsen, overinspektør, seniorforsker på Statens Museum for Kunst 2 Indhold Forord ............................................................................................................................................................. 5 Introduktion .................................................................................................................................................... 7 Motivation. Fra gut feeling til konceptualisering ......................................................................................... 7 Motiveret problemformulering: at svare logisk på