L-G-0000074075-0014179658.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mitgemacht, Weitergemacht, Zugemacht Zum NS-Erbe Der Kommunikationswissenschaft in Deutschland
Horst Pöttker, Dortmund Mitgemacht, weitergemacht, zugemacht Zum NS-Erbe der Kommunikationswissenschaft in Deutschland Mediziner, Juristen, ja sogar Historiker und Journalisten (4; 5; 6;) bemühen sich mittlerweile, ihrer NS-Vergangenheit offen ins Auge zu blicken. Ausgerechnet in der deutschen Kommunikationswissenschaft, dem Prinzip Öffentlichkeit eigent- lich besonders verpflichtet, ist davon bisher wenig zu spüren. Über dunkle Fle- cken redet man hier immer noch am liebsten hinter vorgehaltener Hand - das allerdings ausgiebig. Der folgende Beitrag konzentriert sich auf wenige weder irrelevante noch untypische Beispiele. Vor 1933 begrenzte Vielfalt In ihrer Gründungsphase hatten in der deutschen Zeitungswissenschaft sowohl konservative wie liberale und sogar linke Positionen Platz. In Leipzig, wo der sozialdemokratisch orientierte Nationalökonom Karl Bücher 1916 das erste In- stitut für Zeitungskunde an einer deutschen Universität gegründet hatte, wurde zehn Jahre später der Liberale Erich Everth als erster Ordinarius für dieses Fach berufen, während sich kurz darauf in Berlin mit der Berufung Emil Dovifats auf den neuen Lehrstuhl für Zeitungswissenschaft und gleichzeitig zum Direktor des Deutschen Instituts für Zeitungskunde eine katholisch-konservative Ten- denz durchsetzte (2, 105-141). Wer als Zeitungswissenschaftler jüdischer Her- kunft war, hatte freilich schon in den 20er Jahren wenig Chancen. Otto Groth hat auch vor 1933 keinen Lehrstuhl bekommen, obwohl seine vierbändige Mo- nographie "Die Zeitung" die fachliche Leistung jener Epoche war. Emil Dovifat: Die Zeitung als Massenführungsmittel Für die Zeitung sind die Führungsgrundsätze der Masse von Wichtigkeit, denn sie ist ein Massenführungsmittel, dem freilich die Aufgabe gestellt ist, den neu- en Bindungen Beistand zu leisten, die aus der Masse Volk zu machen berufen sind. Gehorcht die Masse z. B. -

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Uationalsozialistisclie deutsche Arbeiterpartei. Peidisgescltåstsstelle München Der Führer: Adolf Hitler zugleich Oberster SA.-Führer. Der chef der Kanzlel des 7äl1rers der USDAP. Der Peicltsorganisationslelter der UFDAP. und Reichsleiter Philipp Bouhler, Berlin W 8, Boßstraße l. Leiter der Deutschen Ärbeitsfrontr Die Kandel des Tülirers der UFDAP.: Reichsleiter Dr. Robert Leh, München, Barerstraße 15. Amt l. Persönliche Angelegenheiten des Führers und Hauptorganisationsamt — Qrganisationsleitung Sonderaufgaben. der Reichsparteitage — Hauplpersonalamt — Haupt- Amt ll. Bearbeitung von Eingaben, die die NSDAP., schulungsamt — Ordensburgen der NSDAP. — ihre Gliederungen und angeschlossenen Ber- Hauptamt NSBQ — Hauptamt für Handwerk und biinde, sowie die Stellen des Reiches und der Handel. Länder betreffen. Amt Ill. Bearbeitung von Gnadensachen von Ange- hörigen der Bewegung- Der Peitlissclratzmeister der UFDÄP·: Amth. Bearbeitung von sozialtvirtschaftlichen Ange- Reichsleiter Franz Xader Schwarz, München, Arri- legenheiten und Gesuchen sozialer Art- straße 10. Amt V. Personals und Berkoaltungsangelegenheiten Finanzoerroaltung Reichshaushaltamt Neichsrechnungsamt — Verwaltungsamt — Rechts- Der Stellvertreter cles Mitvers- amt — Reichsreoisionsamt —- Hilfskasse der NSDAP. Rudolf Heß, München, Braunes Haus,B1-ienner- Aeichszeugmeisterei Sonderbeaustragte des strasze 44. Reichsschatzmeisters. Die Peidtslelter der UFDAP.: Arnann Max, Reichsleiter der Presse· Der Peichspropaganclaleiter der UFDAP.: Bormann Martin, Stabsletter des Stellvertreters -

Journalism Research 3/2020 183 Editorial
Journalism Research Edited by Bernhard Debatin, Gabriele Hooffacker, Horst Pöttker, Tanjev Schultz and Martina Thiele 2020 | Vol. 3 (3) www.journalistik.online 183 Editorial Reviews Research Paper 259 Michael Haller, Walter Hömberg (Eds.): »Ich lass mir den Mund 186 Anna Spatzenegger nicht verbieten!«. Journalisten als Social media as a source for Wegbereiter der Pressefreiheit und journalistic work Demokratie [»I won’t be silenced!« An investigation into the influence of Journalists as pioneers of press freedom Facebook and Twitter posts by politicians and democracy] on reporting in daily newspapers Reviewed by Hans-Dieter Kübler 203 Horst Pöttker 262 Lauren Lucia Seywald: Investigativer For historical reasons Journalismus in Österreich. Geschichte, On the lack of acceptance of Gegenwart und Zukunft einer journalism studies in Germany Berichterstattungsform [Investigative journalism in Austria. History, present and Essay future of a form of reporting] Reviewed by Boris Romahn 220 Peter Welchering Opinion or attitude 265 Margreth Lünenborg, Saskia Sell (Eds.): Clarification in a journalistic debate on Politischer Journalismus im Fokus der values and knowledge Journalistik [Political journalism in the focus of journalism studies] Debate Rezensiert von Roger Blum 235 Gabriele Hooffacker 267 Patricia Müller: Social Media und Copycats or integrative innovators? Wissensklüfte. Nachrichtennutzung A proposal for the assessment of und politische Informiertheit junger »alternative media« Menschen [Social media and knowledge gaps. News use and political awareness 247 Michael Meyen among young people] The mainstream media are the problem Reviewed by Hans-Dieter Kübler Why the counter-discourse might help journalism HERBERT VON HALEM VERLAG H H Legal Notice Journalism Research (Journalistik. Zeitschrift für Journalismusforschung) 2020, Vol. 3 (3) http://www.journalistik.online Editorial Board Publisher Bernhard Debatin, Ohio University, Herbert von Halem Verlagsgesellschaft Athens (OH) mbH & Co. -
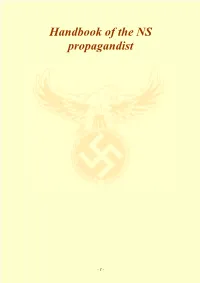
Handbook of the NS Propagandist
Handbook of the NS propagandist - 1 - Context: Propaganda Articles Pre - 1933 1. "Propaganda": A 1927 periodical discussing guidebook for Nazi problems speakers had with propagandists. local group leaders. 2. Modern Political Propaganda: 5. Rural Propaganda: A 1932 A 1930 pamphlet for Nazi piece on how to reach the propagandists. countryside. 3. "How I Treat a Local Group 6. An Analysis of Nazi Leader": a 1931 piece from Propaganda: Written after the the Nazi monthly for July 1932 Reichstag election. propagandists, discussing 7. Reaching the Marxists: A late problems in the propaganda 1932 essay discussing the system. difficulties in appealing to 4. "How I Treat a Speaker": A Marxists. 1931 piece from the same Propaganda Articles 1933-1945 1. "14 Days in a Gau Propaganda 7. "The Reichspropaganda- Office": How a Nazi regional leitung ": A 1936 article on propaganda office functioned the Nazi Party's Central in 1934. Propaganda Office. 2. "The Propaganda Warden": 8. "Political Propaganda as a The importance of lower-level Moral Duty": A 1936 article propagandists. on the importance of 3. "The Tasks of Propaganda in propaganda. the National Socialist State": 9. "The Reich Speaker School": A 1934 Goebbels speech on On methods of training propaganda. speakers. 4. "10 Commandments for 10. "Heart or Reason? What We Propagandists": A 1934 Don't Want from our satirical article on problems in Speakers": Problems in the the system. Nazi speaker system. 5. "Political Propaganda": A 11. "Film as a Weapon": A 1937 rather lengthy 1934 essay on piece by Fritz Hipper, who the nature of propaganda. made The Eternal Jew. -

Magisterarbeit
Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit Hitlers Vordenker Warum Adolf Hitlers Wegbereiter vom nationalsozialistischen Regime verboten wurden Verfasserin Shirin Heydaripour, Bakk. phil. angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im März 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066/841 Studienrichtung lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Matrikelnummer: 0201461 Betreuerin: Dr. - Ao. Univ.-Prof. Fritz Hausjell 2 Abstract Die vorliegende Arbeit versucht mittels einer eingehenden Literaturstudie Erklärungen für das Verleugenen und Verbergen der Nationalsozialiten hinsichtlich ihrer Voräuferschaft zu finden. Am Beispiel von zwei charakteristischen Persönlichkeiten werden in diesem Zusammenhang, vor allem die möglichen Motive Adolf Hitlers geprüft. Die darin zu findenen Ergebnisse basieren auf Vermutungen und gehen von der Annahme aus, dass die „Wegbereiter“ Hitlers ihm solange von Nutzen war, bis er an die Macht gelangte. Davor noch nicht einmal anerkannt, wurde sie von da an systematisch aus dem Weg geräumt. Es wird vermutet dass sie zur Bedrohung seiner Führerstellung wurden, vor allem wenn bekannt gewesen wäre, dass seine nationalsozialitischen Ideen und Ideale bereits lange vor ihm von anderen „Rassentheoretikern“ erdacht und umgesetzt wurden. 3 Abkürzungsverzeichnis DAP Deutsche Arbeiter Partei DSP Deutsch Sozialitische Partei NS Nationalsozialisten NSDAP Nationalsozialitische Deutsche Arbeiterpartei ONT Orden der Neutempler/Ordi Novi Templi SPD Sozialitische Partei Deutschland USPD Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deuschland VB Völkischer Beobachter 4 INHALTSVERZEICHNIS I. Einleitung I. 1. Einführung in die Thematik I. 2. Forschungsstand und Methode II. Die völkischen Vordenker und ihre Ideologie II. 1. Definition II. 2. Völkische Rassentheoretiker II. 3. Die völkischen Parteien und die NSDAP III. Die Ausnahmen: von den Nationalsozialisten anerkannte Vordenker III. 1. Richard Wagner III. 2. Georg von Schönerer und Karl Lueger III. -

Public Opinion Propaganda Ideology Brill’S Japanese Studies Library
Public Opinion Propaganda Ideology Brill’s Japanese Studies Library Edited by Joshua Mostow (Managing Editor) Caroline Rose Kate Wildman Nakai VOLUME 39 The titles published in this series are listed at brill.nl/bjsl Public Opinion Propaganda Ideology Theories on the Press and its Social Function in Interwar Japan, 1918–1937 By Fabian Schäfer LEIDEN • BOSTON 2012 Cover illustration: Taken from volume 2 of Sōgō jānarizumu kōza (Naigai-sha, 1930/31), depicting violations against article 23 of the press law (shinbunshi-hō) and article 19 of the publishing law (shuppan-hō) in 1923 (right circle) and in 1929 (left circle). During the short period of only six years, prohibitions of sale on the basis of ideology-based violations of the public peace and order (an’nei chitsujō) rose from 122 to 565 cases, whereas offenses against public morality ( fūzoku kairan) sunk from 1.394 to 614 cases. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Schäfer, Fabian. Public opinion, propaganda, ideology : theories on the press and its social function in interwar Japan, 1918–1937 / by Fabian Schäfer. p. cm. — (Brill’s Japanese studies library ; 39) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-22913-6 (hardback : alk. paper) 1. Journalism—Social aspects—Japan—History—20th century. 2. Journalism—Political aspects—Japan—History—20th century. 3. Public opinion—Japan. I. Title. PN5407.S6S33 2012 02.230952—dc23 2012009656 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.nl/brill-typeface. -

The Hitler Youth: Blind Fanaticism
The Hitler Youth: Blind Fanaticism Janessa Hansen Senior Division Individual exhibit Student Composed Words: 500 Process Paper Word Count: 500 Process Paper I’ve always had an interest in The Holocaust. I’ve watched films and read books on it for many years. Last summer my grandpa and I were watching a documentary on National Geography about The Hitler Youth. It was fascinating to me how millions of children could believe the ridiculous rhetoric the Nazis preached. I decided it would be a fascinating project and proceeded to rid of my research from my old topic I had thought of. To begin, I started with doing background research. I learned some interesting information about how the group was started and what kind of activities they took part in from The Holocaust Memorial Museum and books. After some time, I decided I should try to find books written by people who were actually in the Hitler Youth, and found quite a few. After that, I began researching how the Hitler Youth was able to thrive. By that time I had established that the barrier they broke through, which was their ignorance and prejudice, so I started researching how they were able to break through that barrier. Using this knowledge, I looked for textbooks the Nazis had used for the Hitler Youth to teach them, and I also looked at education standards at the time. I looked at letters and diaries written by the Hitler Youth at the time to understand how their feelings and perspectives, and how those thoughts progressed after the war. -

Zeitungswissenschaft in Wien Bis 1945
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Zeitungswissenschaft in Wien 1900-1945 Die Institutionalisierung im Kontext der deutschsprachigen Fachentwicklung Verfasserin Katharina Kniefacz angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 301 Studienrichtung lt. Studienblatt: 1. Studienrichtung Geschichte Betreuer: ao. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Stadler Inhalt 1 Einleitung: Beitrag zur Disziplingeschichte der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und zur „Historischen Wissenschaftsforschung“ ............................................................................... 3 2 Zeitungskunde und Zeitungswissenschaft als akademische Disziplin in Deutschland.................................................................................................. 11 2.1 Frühe Zeitungskunde: Vorläufer und Pioniere zwischen Geschichte, Nationalökonomie und Pressepraxis 1890-1925 ............................................... 11 2.2 Konsolidierung und inhaltliche Neuorientierung 1925 bis 1933 ....................... 16 2.3 Zeitungswissenschaft im Nationalsozialismus: „Gleichschaltung“ durch den DZV unter Walther Heide ................................................................................ 19 2.4 Ende und Neubeginn 1945 ............................................................................... 27 2.5 Wirkungsstätten der Zeitungskunde/-wissenschaft ........................................... 28 2.5.1 Schweiz ................................................................................................................ -

GEN MS 27 Early 20Th-Century German Print Collection Finding Aid
University of Southern Maine USM Digital Commons Search the General Manuscript Collection Finding Aids General Manuscript Collection 8-2012 GEN MS 27 Early 20th-century German Print Collection Finding Aid Julie Cismoski University of Southern Maine Kristin D. Morris Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usm.maine.edu/manuscript_finding_aids Part of the European History Commons, German Literature Commons, and the Military History Commons Recommended Citation Early 20th-century German Print Collection, Special Collections, University of Southern Maine Libraries. This Article is brought to you for free and open access by the General Manuscript Collection at USM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Search the General Manuscript Collection Finding Aids by an authorized administrator of USM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. UNIVERSITY OF SOUTHERN MAINE LIBRARIES SPECIAL COLLECTIONS EARLY 20th-CENTURY GERMAN PRINT COLLECTION GEN MS 27 Total Boxes: 2 Linear Feet: 1.5 By Julie Cismoski and Kristin D. Morris Portland, Maine August 2012 Copyright 2012 by the University of Southern Maine 1 Administrative Information Provenance: The Early 20th-century German Print Collection was donated in 2012 by Karen S. Curley, whose father acquired the materials while serving in West Germany during the Cold War. Ownership and Literary Rights: The Early 20th-century German Print Collection is the physical property of the University of Southern Maine Libraries. Literary rights, including copyright, belong to the creator or her/his legal heirs and assigns. For further information, consult the Head of Special Collections. Cite as: Early 20th-century German Print Collection, Special Collections, University of Southern Maine Libraries. -

Comparative History of Communication Studies: France and Germany
The Open Communication Journal, 2008, 2, 1-13 1 Comparative History of Communication Studies: France and Germany Stefanie Averbeck* University of Leipzig, Institut for Communication and Media Studies Abstract: The aim is to outline general differences in two academic cultures, considering historic perspectives: German ‘Kommunikationswissenschaft’ with its roots in ‘Publizistik-’ and ‘Zeitungswissenschaft’ and French ‘Sciences de l’information et de la communication’ with its roots in semiotics and cultural views on communication. There are differ- ent internal and external (societal and political) means which influenced the development of communication studies and theories in each of the two countries. The Sciences de l’information et de la communication (SIC) gained their academic acceptance in France in 1975 which under international comparison was late. One strong external moment of the instutionalization of SIC was the political aim to modernize the French University for the so called ‘information society’. The French researchers developed their own focus. Semio-pragmatics and social constructivism are two basic theoretical orientations which, after the end of the limiting structuralistic paradigm of the 1960ths, lead to a fruitful connection of the analysis of the micro and the meso-level of communication processes. Thus, Pragmatics and Symbolic Interactionism played an important role in French SIC much earlier than in Germany. Keywords: History of communication studies, French Sciences de l’information et de la communication, German -

For Historical Reasons. on the Lack of Acceptance of Journalism
Journalism Research HERBERT VON HALEM VERLAG 2020, Vol 3 (3) p. 203-219 ISSN 2569-152X DOI: 10.1453/2569-152X-32020-10998-en Research Paper Horst Pöttker For historical reasons On the lack of acceptance of journalism studies in Germany Abstract: In Germany, journalism studies as a university subject – whose role is innovation and education/training in relation to journalism as a profes- sion, in a similar way to medicine for the medical profession – receives little acceptance compared to in the USA and even Russia. This is expressed, for example, in the rather hostile attitude of media practitioners to the academ- ic professional training of journalists. This paper outlines a reason for this deficit that goes back to the history of the subject: In the USA, professional journalism training became established at many universities as far back as the 1920s, as journalism there broke away from party politics and questions of belief early on and publishers were happy to allow the public purse to pay for qualification for a profession with a public role. In Germany, on the other hand, it was the publishing houses and chief editors who called the shots as journalism studies was being set up, acting as party politicians or church rep- resentatives at the same time. They did not want to leave the training of their journalistic staff to universities – institutions that were and still are focused on academic objectivity. In contrast, journalism studies as a subject devel- oped early and more powerfully in the USSR than in Germany, as both the media and the universities there were in the hands of the ruling single party, the CPSU. -

Arminius in National Socialism How the Nazis Presented Antiquity in Propaganda
Arminius in National Socialism How the Nazis presented antiquity in propaganda A Master thesis by Job Mestrom (s4130030) Supervisor: Dr. Coen Van Galen Coordinator: Dr. Lien Foubert Eternal Rome MA History Radboud University Nijmegen 10-08-2016 Contents: Abstract 3. Introduction 3. Reception studies 4. Chapter 1: Towards an understanding of National Socialist Propaganda. 9. Propaganda as a concept and how the Nazi Regime put it to use. 9. Backgrounds to racial inequality in National Socialist thought. 12. The importance of the Classics and history as Rassenkampf. 13. Chapter 2: Nineteenth century propaganda of the antique past. 16. Monuments, the materialisation of the link between nation building and antiquity. 16. Nation building from 1871 onwards, antiquity as a common ancestry. 20. Chapter 3: 1933-1945; a period of ambiguity? 23. Antique Greek art, the 'evidence' of a common primeval race. 24. More ambiguity within the Reich's propaganda. 27. Understanding the Nazis' appropriation of the antique past. 29. Clashing ideologies. Germanentum or a broader idea of Aryanism? 30. Chapter 4: 1933-1945; The case of Arminius. 33. Arminius as a propaganda tool for National-Socialists: Grabbe's Die Hermannsschlacht. 33. Arminius as a propaganda tool for National-Socialists: the Lippe campaign 1933. 36. Arminius as propaganda tool for National-Socialists: 'Ewiger Wald' (1936). 38. Arminius-propaganda put in perspective. 41. Conclusion 46. Bibliography 49. 2 Abstract This thesis examines how the National Socialist regime in Germany between the years 1933 and 1945 interacted with the figure of Arminius, the German tribal leader who transformed during the nineteenth century into Hermann, the forefather of the German nation.