Der Große Reiz Des Kamera-Mediums
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
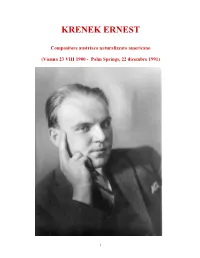
Krenek Ernest
KRENEK ERNEST Compositore austriaco naturalizzato americano (Vienna 23 VIII 1900 - Palm Springs, 22 dicembre 1991) 1 Allievo dal 1916 al 1920 di F. Schreker all'Accademia musicale di Vienna, passò poi alla Hochschule fur Musik di Berlino, dove continuò gli studi con Schreker, ed entrò in proficuo contatto di lavoro con Busoni, A. Schnabel ed altri esponenti del mondo musicale della capitale tedesca. Sposata la figlia di Mahler, Anna (1923) si stabilì in Svizzera ma due anni dopo divorziò e dal 1925 al 1927, su invito di P. Bekker, fu nominato consigliere artistico dell'Opera di Kassel, mettendosi in luce con numerose composizioni teatrali e strumentali ed iniziando un'intensa attività pubblicistica come collaboratore musicale della "Frankfurter Zeitung" e dal 1933 della "Wiener Zeitung”. Ottenuto un successo di portata internazionale con l'opera Jonny spielt auf, dal 1928 si stabilì a Vienna dedicandosi quasi esclusivamente alla composizione, anche qui a contatto con gli ambienti artistici d'avanguardia (Berg, Webern, K. Kraus). Nel 1937 emigrò in America, dove nel 1939 ottenne una cattedra nel Vassar College di Poughkeepsie, presso New York. Dal 1945 ha avuto la cittadinanza americana. Dal 1942 al 1947 ha insegnato nell'Università di Saint Paul, stabilendosi poi a Los Angeles. Dopo la guerra rientrò spesso in Europa, per corsi di composizione, conferenze e concerti. Musicista assai sensibile ai più attuali problemi estetici e di linguaggio, il suo arco creativo rispecchia l'evoluzione spesso contraddittoria delle correnti dell'avanguardia musicale del secolo. L'insegnamento di Schreker lo ha avvicinato nella prima gioventù ad una sorta di espressionismo temperato in senso tardo-romantico, ma ben presto si liberò da quell'influenza per avvicinarsi alle più diverse esperienze musicali. -

100 Years of Extraordinary Historical Highlights from the Baltimore Symphony Orchestra Archives
100 Years of Extraordinary Historical Highlights from the Baltimore Symphony Orchestra Archives 1910s 1915 – Through a $6,000 grant from the city of Baltimore, the Baltimore Symphony Orchestra is founded as a branch of the city’s Department of Municipal Music, making it the only major American orchestra to be fully funded as a municipal agency. 1916 – On February 11, the Baltimore Symphony Orchestra performs its inaugural concerts to a standing- room-only crowd at The Lyric, under the direction of Music Director Gustav Strube. All three concerts comprising the first season at the Lyric are sold out. 1920s 1924 – On February 16, the BSO hosts its first children’s concert. The Baltimore Symphony youth concert series is the first to be established by an American orchestra. 1926 – The Baltimore Symphony makes its initial broadcast performance on WBAL Radio. 1930s 1930 - George Siemonn becomes the second music director of the orchestra. He conducts his opening concert, with the musicians now numbering 83, on November 23. 1935 - In late February, George Siemonn reluctantly resigns as music director and is replaced by Ernest Schelling. Forty-four musicians apply for the position. Schelling is well-known for his children’s concert series at Carnegie Hall. 1937 - Sara Feldman and Vivienne Cohn become the first women to join the Baltimore Symphony. The older members of the orchestra are supportive, but union members picket the hall with signs saying, “Unfair to Men,” which is reported in the New York Times. 1937 - Ernest Schelling becomes ill and is replaced by Werner Janssen. The dynamic young conductor and his wife, the celebrated film star Ann Harding, receive an enthusiastic response when they arrive in Baltimore. -

Amahl and the Night Visitors
Set Design By: Steven C. Kemp AMAHL AND THE NIGHT VISITORS Welcome to Amahl and the Night Visitors! During this exceptional time, it has been a delight for us to bring you the gift of this wonderful holiday show. Created with love, we have brought together a variety of Kansas City’s talented artists to share this story of generosity and hope. It has been so heartwarming to see this production evolve, from the building of the scenery and puppets, to the addition of puppeteers, singers, and the orchestra. I know that it has meant a great deal to all involved to be in a safe space where creativity can flourish and all can practice their craft. The passion and joy of our performers, during this process, has been palpable. I wish you all a happy holiday and hope you enjoy this special show! Deborah Sandler, General Director and CEO BOARD OF TRUSTEES 2020-2021 OFFICERS Joanne Burns, President Tom Whittaker, Vice President Scott Blakesley, Secretary Craig L. Evans, Treasurer BOARD OF TRUSTEES Dr. Ivan Batlle Mira Mdivani Mark Benedict Edward P. Milbank Richard P. Bruening Steve Taylor Tom Butch Benjamin Mann, Counsel Melinda L. Estes, M.D. Karen Fenaroli Michael D. Fields Lafayette J. Ford, III Kenneth V. Hager Niles Jager Amy McAnarney EX-OFFICIO MEMBERS Andrew Garton | Chair, Orpheus KC Mary Leonida | President, Lyric Opera Circle Gigi Rose | Ball Chair, Lyric Opera Circle Dianne Schemm | President, Lyric Opera Guild Presents Amahl and the Night Visitors Opera in one act by Gian Carlo Menotti in order of PRINCIPAL CAST vocal appearance MOTHER Kelly Morel^ AMAHL Holly Ladage KING KASPAR Michael Wu KING MELCHIOR Daniel Belcher KING BALTHAZAR Scott Conner THE PAGE Keith Klein ^Former Resident Artist First Performance: NBC Opera Theatre, New York City, December 24, 1951. -

General Index
Cambridge University Press 0521780098 - The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera Edited by Mervyn Cooke Index More information General index Abbate, Carolyn 282 Bach, Johann Sebastian 105 Adam, Fra Salimbene de 36 Bachelet, Alfred 137 Adami, Giuseppe 36 Baden-Baden 133 Adamo, Mark 204 Bahr, Herrmann 150 Adams, John 55, 204, 246, 260–4, 289–90, Baird, Tadeusz 176 318, 330 Bala´zs, Be´la 67–8, 271 Ade`s, Thomas 228 ballad opera 107 Adlington, Robert 218, 219 Baragwanath, Nicholas 102 Adorno, Theodor 20, 80, 86, 90, 95, 105, 114, Barbaja, Domenico 308 122, 163, 231, 248, 269, 281 Barber, Samuel 57, 206, 331 Aeschylus 22, 52, 163 Barlach, Ernst 159 Albeniz, Isaac 127 Barry, Gerald 285 Aldeburgh Festival 213, 218 Barto´k, Be´la 67–72, 74, 168 Alfano, Franco 34, 139 The Wooden Prince 68 alienation technique: see Verfremdungse¤ekt Baudelaire, Charles 62, 64 Anderson, Laurie 207 Baylis, Lilian 326 Anderson, Marian 310 Bayreuth 14, 18, 21, 49, 61–2, 63, 125, 140, 212, Andriessen, Louis 233, 234–5 312, 316, 335, 337, 338 Matthew Passion 234 Bazin, Andre´ 271 Orpheus 234 Beaumarchais, Pierre-Augustin Angerer, Paul 285 Caron de 134 Annesley, Charles 322 Nozze di Figaro, Le 134 Ansermet, Ernest 80 Beck, Julian 244 Antheil, George 202–3 Beckett, Samuel 144 ‘anti-opera’ 182–6, 195, 241, 255, 257 Krapp’s Last Tape 144 Antoine, Andre´ 81 Play 245 Apollinaire, Guillaume 113, 141 Beeson, Jack 204, 206 Appia, Adolphe 22, 62, 336 Beethoven, Ludwig van 87, 96 Aquila, Serafino dall’ 41 Eroica Symphony 178 Aragon, Louis 250 Beineix, Jean-Jacques 282 Argento, Dominick 204, 207 Bekker, Paul 109 Aristotle 226 Bel Geddes, Norman 202 Arnold, Malcolm 285 Belcari, Feo 42 Artaud, Antonin 246, 251, 255 Bellini, Vincenzo 27–8, 107 Ashby, Arved 96 Benco, Silvio 33–4 Astaire, Adele 296, 299 Benda, Georg 90 Astaire, Fred 296 Benelli, Sem 35, 36 Astruc, Gabriel 125 Benjamin, Arthur 285 Auden, W. -

Claudia Maurer Zenck
Claudia Maurer Zenck Publikationsliste A: Bücher Verfolgungsgrund: „Zigeuner“. Unbekannte Musiker und ihr Schicksal im „Dritten Reich“ (= Antifaschistische Literatur und Exilliteratur – Studien und Texte, Bd. 25, hg. v. Verein zur Förderung und Erforschung der antifaschistischen Literatur), Wien: Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, 2016 Mozarts Così fan tutte: dramma giocoso und deutsches Singspiel. Frühe Abschriften und frühe Aufführungen, Schliengen: edition argus, 2007 Vom Takt. Untersuchungen zur Theorie und kompositorischen Praxis im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 2001 Ernst Krenek – ein Komponist im Exil, Wien: Lafite, 1980 Versuch über die wahre Art, Debussy zu analysieren (= Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten 8), München / Salzburg: Katzbichler, 1974 B: Editionen Ernst Krenek. Frühe Lieder für Gesang und Klavier, 3 Hefte, Wien: Universal Edition, 2015 (mit Einleitung, Textteil, Kritischem Bericht) Ernst Krenek - Briefwechsel mit der Universal Edition (1921-1941), 2 Teile, Köln / Weimar / Wien: Böhlau, 2010 „'...la di Ella inaudita finezza'. Zur Entstehung der Varianti. Briefwechsel Luigi Nono – Rudolf Kolisch 1954–1957/58“, in: Schönberg & Nono. A Birthday Offering to Nuria on May 7, 2002, hg. v. Anna Maria Morazzoni, Florenz: Olschki, 2002, S. 267–315 Ernst Krenek: Die amerikanischen Tagebücher 1937–1942. Dokumente aus dem Exil (Hg. u. Übers.), Wien / Köln / Weimar: Böhlau, 1992 Der hoffnungslose Radikalismus der Mitte. Briefwechsel Ernst Krenek – Friedrich T. Gubler 1928–1939 (Hg.), Wien / Köln: Böhlau, 1989 C: Herausgabe Younghi Pagh-Paan. Auf dem Weg zur musikalischen Symbiose, Mainz: Schott, 2020 (wird im Mai/Juni 2020 erscheinen) (zus. mit Gernot Gruber u. Matthias Schmidt:) Ernst Krenek – nicht nur Komponist (= Ernst Krenek Studien 7), Schliengen: edition argus, 2018 Musik, Bühne und Publikum. -

Regent Theatre Ulumbarra Theatre, Bendigo
melbourne opera Part One of e Ring of the Nibelung WAGNER’S Regent Theatre Ulumbarra Theatre, Bendigo Principal Sponsor: Henkell Brothers Investment Managers Sponsors: Richard Wagner Society (VIC) • Wagner Society (nsw) Dr Alastair Jackson AM • Lady Potter AC CMRI • Angior Family Foundation Robert Salzer Foundation • Dr Douglas & Mrs Monica Mitchell • Roy Morgan Restart Investment to Sustain and Expand (RISE) Fund melbourneopera.com Classic bistro wine – ethereal, aromatic, textural, sophisticated and so easy to pair with food. They’re wines with poise and charm. Enjoy with friends over a few plates of tapas. debortoli.com.au /DeBortoliWines melbourne opera WAGNER’S COMPOSER & LIBRETTIST RICHARD WAGNER First performed at Munich National Theatre, Munich, Germany on 22nd September 1869. Wotan BASS Eddie Muliaumaseali’i Alberich BARITONE Simon Meadows Loge TENOR James Egglestone Fricka MEZZO-SOPRANO Sarah Sweeting Freia SOPRANO Lee Abrahmsen Froh TENOR Jason Wasley Donner BASS-BARITONE Darcy Carroll Erda MEZZO-SOPRANO Roxane Hislop Mime TENOR Michael Lapina Fasolt BASS Adrian Tamburini Fafner BASS Steven Gallop Woglinde SOPRANO Rebecca Rashleigh Wellgunde SOPRANO Louise Keast Flosshilde MEZZO-SOPRANO Karen Van Spall Conductors Anthony Negus, David Kram FEB 5, 21 Director Suzanne Chaundy Head of Music Raymond Lawrence Set Design Andrew Bailey Video Designer Tobias Edwards Lighting Designer Rob Sowinski Costume Designer Harriet Oxley Set Build & Construction Manager Greg Carroll German Language Diction Coach Carmen Jakobi Company Manager Robbie McPhee Producer Greg Hocking AM MELBOURNE OPERA ORCHESTRA The performance lasts approximately 2 hours 25 minutes with no interval. Principal Sponsor: Henkell Brothers Investment Managers Sponsors: Dr Alastair Jackson AM • Lady Potter AC CMRI • Angior Family Foundation Robert Salzer Foundation • Dr Douglas & Mrs Monica Mitchell • Roy Morgan Restart Investment to Sustain and The role of Loge, performed by James Egglestone, is proudly supported by Expland (RISE) Fund – an Australian the Richard Wagner Society of Victoria. -

Final Program G
Amahl and the Night Visitors The (Names of the Songs) in the Opera are in Parentheses The story is set near the city of Bethlehem in the first century just after the birth of Christ. Amahl, a disabled boy who can walk only with a crutch, has a problem with telling tall tales. He is sitting outside playing his shepherd's pipe when his mother calls for him ("Amahl! Amahl!"). After much persuasion, he enters the house but his mother does not believe him when he tells her there is an amazing star "as big as a window" outside over their roof ("O Mother You Should Go Out and See"; "Stop Bothering Me!"). Later that night, Amahl's mother weeps, praying that Amahl not become a beggar ("Don't Cry Mother Dear"). After bedtime ("From Far Away We Come"), there is a knock at the door and the mother tells Amahl to go see who it is ("Amahl ... Yes Mother!"). He is amazed when he sees three splendidly dressed kings (the Magi). At first the mother does not believe Amahl, but when she goes to the door to see for herself, she is stunned. The Three Kings tell the mother and Amahl they are on a long journey to give gifts to a wondrous Child and they would like to rest at their house, to which the mother agrees ("Good Evening!"; "Come In!"), saying that all she can offer is "a cold fireplace and a bed of straw". The mother goes to fetch firewood, and Amahl seizes the opportunity to speak with the kings. -

Toccata Classics TOCC 0125 Notes
P ERNEST KRENEK: MUSIC FOR CHAMBER ORCHESTRA by Peter Tregear The Austrian-born composer Ernst Krenek (1900–91) has been described, with good reason, as a compositional ‘companion of the twentieth century’.1 Stretching over seventy years of productive life, his musical legacy encompasses most of the common forms of modern western art music, from string quartets and symphonies to opera and electronic music. Moreover, it engages with many of the key artistic movements of the day – from late Romanticism and Neo- classicism to abstract Expressionism and Post-modernism. The sheer scope of his music seems to reflect something profound about the condition of his turbulent times. The origins of Krenek’s extraordinary artistic disposition are to be found in the equally extraordinary circumstances into which he was born. He came to maturity in Vienna in the dying days of the First World War and the Austro-Hungarian Empire and, with its collapse in 1919, the cultural norms that had nurtured Vienna’s enviable musical reputation all but disappeared. In addition, by this time, new forms of transmission of mass culture, such as the wireless, gramophone and cinema, were transforming the ways and means by which cultural life could be both propagated and received. As an artist trying to come to terms with these changes, Krenek was doubly fortunate. Not only was he generally recognised as one of the most gifted composers of his generation; he was also an insightful thinker about music and its role in society. Right from the moment in 1921 when, in the face of growing tension between himself and his composition teacher Franz Schreker, he set out on a full-time career as a composer, he determined that he would be more than just as a passive reflector of the world around him; he would be both its witness and conscience. -

6.5 X 11 Double Line.P65
Cambridge University Press 978-0-521-87392-5 - Never Sang for Hitler: The Life and Times of Lotte Lehmann, 1888-1976 Michael H. Kater Index More information Index 8 [Acht] Uhr-Blatt, Vienna, 56 Auguste Victoria, ex-queen of Portugal, 137 Abessynians, 273 Auguste Viktoria, Empress, 3, 9 Abravanel, Maurice, 207, 259–61, 287, 298 Austrian Honor Cross First Class, 278 Academy Awards, Hollywood, 232, 236 Austrian Republic, 44, 48, 51, 57, 64–66, 77, Adler, Friedrich, 38 85, 94, 97–99, 166, 307–8 Adolph, Paul, 110–11 Austrian State Theaters, 220 Adventures at the Lido, 234 Austrofascism, 94, 166–69, 308 Agfa company, 185 Aida, 266, 276 Bachur, Max, 15, 18–21, 28, 30–31, 33, Albert Hall, London, 117 42–43 Alceste, 269 Baker, Janet, 251 Alda, Frances, 68 Baker, Josephine, 94 Aldrich, Richard, 69 Baklanoff, Georges, 43 Alexander, king of Yugoslavia, 170 Ballin, Albert, 16, 30, 77, 304 Alice in Wonderland, 193 Balogh, Erno,¨ 147–49, 151, 158, 164, Alien Registration Act, 211 180–81 Allen, Fred, 230 Bampton, Rose, 183, 206, 245 Allen, Judith, 253 Banklin oil refinery, Santa Barbara, 212 Althouse, Paul, 174 Barnard College, Columbia University, New Altmeyer, Jeannine, 261 York, 151 Alvin Theater, New York, 204 Barsewisch, Bernhard von, 1, 13, 35, 285, Alwin, Karl, 102, 106–7, 189, 196 298, 302, 319n172, 343n269 American Committee for Christian German Barsewisch, Elisabeth von, nee´ Gans Edle zu Refugees, 211 Putlitz, 13, 82, 285, 295 American Legion, 68 Bartels, Elise, 11, 14 An die ferne Geliebte, 217 Barthou, Louis, 170 Anderson, Bronco Bill, 198 -

Poetik Und Dramaturgie Der Komischen Operette
9 Romanische Literaturen und Kulturen Albert Gier ‚ Wär es auch nichts als ein Augenblick Poetik und Dramaturgie der komischen Operette ‘ 9 Romanische Literaturen und Kulturen Romanische Literaturen und Kulturen hrsg. von Dina De Rentiies, Albert Gier und Enrique Rodrigues-Moura Band 9 2014 ‚ Wär es auch nichts als ein Augenblick Poetik und Dramaturgie der komischen Operette Albert Gier 2014 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Informationen sind im Internet über http://dnb.ddb.de/ abrufbar. Dieses Werk ist als freie Onlineversion über den Hochschulschriften-Server (OPUS; http://www.opus-bayern.de/uni-bamberg/) der Universitätsbibliothek Bamberg erreichbar. Kopien und Ausdrucke dürfen nur zum privaten und sons- tigen eigenen Gebrauch angefertigt werden. Herstellung und Druck: Digital Print Group, Nürnberg Umschlaggestaltung: University of Bamberg Press Titelbild: Johann Strauß, Die Fledermaus, Regie Christof Loy, Bühnenbild und Kostüme Herbert Murauer, Oper Frankfurt (2011). Bild Monika Rittershaus. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Monika Rittershaus (Berlin). © University of Bamberg Press Bamberg 2014 http://www.uni-bamberg.de/ubp/ ISSN: 1867-5042 ISBN: 978-3-86309-258-0 (Druckausgabe) eISBN: 978-3-86309-259-7 (Online-Ausgabe) URN: urn:nbn:de:bvb:473-opus4-106760 Inhalt Einleitung 7 Kapitel I: Eine Gattung wird besichtigt 17 Eigentlichkeit 18; Uneigentliche Eigentlichkeit -

John Stewart Papers
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8qj7jg3 No online items John Stewart Papers Special Collections & Archives, UC San Diego Special Collections & Archives, UC San Diego Copyright 2013 9500 Gilman Drive La Jolla 92093-0175 [email protected] URL: http://libraries.ucsd.edu/collections/sca/index.html John Stewart Papers MSS 0614 1 Descriptive Summary Languages: English Contributing Institution: Special Collections & Archives, UC San Diego 9500 Gilman Drive La Jolla 92093-0175 Title: John Stewart Papers Identifier/Call Number: MSS 0614 Physical Description: 5.6 Linear feet(15 archives boxes) Date (inclusive): 1916-1991 Abstract: The papers of John Stewart, author, musician and UCSD Muir College provost (1965-1987) contain the research materials for his book about composer Ernst Krenek titled Ernst Krenek: The Man and His Music (1991), including typescript drafts; notes describing correspondence, essays, and articles about Krenek; chronologies; and a series of reel-to-reel audiorecordings of interviews with Krenek by Stewart. Also included are drafts of writings, teaching materials, and correspondence with colleagues including Ernst Krenek. Biography John Lincoln Stewart was born January 24, 1917 in Alton, Illinois, and grew up in Granville and Dwight, Ontario. He graduated from Dennison College with a double major in English and Music and received his doctorate in English literature at Ohio State University. He served in World War II in the Army Signal Corps. He taught English at UCLA and Dartmouth before joining UCSD, publishing The Burden of Time: The Fugitives and Agrarians, a history of the Nashville literary groups of the 1920s and 1930s. Stewart came to UCSD in 1964 to take the lead in establishing arts departments on campus. -

The Concerts at Lewisohn Stadium, 1922-1964
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2009 Music for the (American) People: The Concerts at Lewisohn Stadium, 1922-1964 Jonathan Stern The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/2239 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] MUSIC FOR THE (AMERICAN) PEOPLE: THE CONCERTS AT LEWISOHN STADIUM, 1922-1964 by JONATHAN STERN VOLUME I A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2009 ©2009 JONATHAN STERN All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Music in satisfaction of the Dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Professor Ora Frishberg Saloman Date Chair of Examining Committee Professor David Olan Date Executive Officer Professor Stephen Blum Professor John Graziano Professor Bruce Saylor Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii Abstract MUSIC FOR THE (AMERICAN) PEOPLE: THE LEWISOHN STADIUM CONCERTS, 1922-1964 by Jonathan Stern Adviser: Professor John Graziano Not long after construction began for an athletic field at City College of New York, school officials conceived the idea of that same field serving as an outdoor concert hall during the summer months. The result, Lewisohn Stadium, named after its principal benefactor, Adolph Lewisohn, and modeled much along the lines of an ancient Roman coliseum, became that and much more.