Gelterkinden 1377
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

750 Wanderrouten Der Wandergruppe Sissach
Wandergruppe Sissach 750 Wanderrouten 750 Wanderrouten der Wandergruppe Sissach Wie alles entstand Im Herbst 1989 kamen zwei Männerriegler, beide pas- sionierte Wanderer, auf die Idee den AHV-Alltag mit gemeinsamen Nachmittags-Ausflügen etwas aufzulo- ckern und die Marschtüchtigkeit zu fördern. Bevorzug- tes Gebiet waren die herrlichen Weiden und Höhenzü- gen in der Umgebung Froburg/Schafmatt. Auf ihren ausgedehnten Wanderungen diskutierten der Paul Schmassmann Oskar Tschannen Tschannen Oski und der Schmassman Paul über Ski- fahren, Skiwandern, über Hochgebirgswanderungen, über Versicherungen, über Wein- und Schnaps-Herstellung und vieles andere. Dass der Oski et- was mehr Diskussionsanteil beisteuerte, darf wohl verraten werden. Beim zweiten gemeinsamen Bummel entwickelte sich die Idee, solch regelmässige Ausflüge könnten doch auch noch andere Männerriegler interessieren, die bereits zur AHV-Garde gehören. Paul Schmassmann ... und so kam es, dass während den letzten 30 Jahren auf den 750 Wanderungen total 14‘899 Teilnehmer 1‘923 Wanderstunden absolvierten. Legende Nr. Datum Start - Ziel Wanderzeit Wanderroute Einkehr Wanderleiter [Anzahl Wanderer + Gäste nur beim Einkehr] © TV Sissach gesammelt von verschiedenen Wandergruppe-Leitern Layout Rolf Cleis, 18.01.2020 Wandergruppe Sissach 1 11.01.1990 Eptingen - Waldenburg 5.00 Std. 15 30.10.1990 Buus - Maisprach 2.00 Std. Eptingen - Bölchenflue - Kilchzimmersattel - Rehag - Waldenburg Buus - Rebenweg - Aussichtsturm Maisprach - Maisprach Oskar Tschannen [4] Oskar Tschannen [6] 2 06.02.1990 Läufelfingen-Oltingen 4.00 Std. 16 13.11.1990 Maisprach - Wintersingen 2.25 Std. Läufelfingen - Froburg - Bergmatten - Zeglingerberg - Schafmatt - Oltingen Maisprach - Rebenweg Buus - Rebenweg Wintersingen - Wintersingen Oskar Tschannen [6] Rebhüsli von Sutter Dölfi, Wintersingen Oskar Tschannen [13] 3 13.03.1990 Wittinsburg - Sissach 3.00 Std. -

50-Bs Bl Ag So
FAHRPLANJAHR 2020 50.102 Gelterkinden - Kienberg - Salhöhe Stand: 6. November 2019 Montag–Freitag ohne allg. Feiertage ohne 1.5. sowie 2.1. 12001 12005 12011 12013 12017 12023 12027 12037 12039 12047 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Gelterkinden, Bahnhof 5 33 6 03 6 33 7 03 7 33 8 03 8 33 9 33 10 03 10 33 Gelterkinden, Post 5 34 6 04 6 34 7 04 7 34 8 04 8 34 9 34 10 04 10 34 Gelterkinden, obere Mühle 5 34 6 04 6 34 7 04 7 34 8 04 8 34 9 34 10 04 10 34 Ormalingen, Unterdorf 5 37 6 07 6 37 7 07 7 37 8 07 8 37 9 37 10 07 10 37 Ormalingen, Hemmikerstrasse 7 08 8 38 10 08 Hemmiken, Dorf 7 12 8 42 10 12 Rothenfluh, Asphof 7 14 8 44 10 14 Ormalingen, Oberdorf 5 38 6 08 6 38 7 38 8 08 9 38 10 38 Rothenfluh, Hirschengasse 5 42 6 12 6 42 7 19 7 42 8 12 8 49 9 42 10 19 10 42 Anwil, Dorf 5 47 6 17 6 47 7 24 7 47 8 17 8 54 9 47 10 24 10 47 Kienberg, Hirschen 5 53 6 23 6 53 7 30 7 53 8 23 9 00 9 53 10 30 10 53 Salhöhe 9 07 10 37 12051 12061 12065 12069 12073 12081 12085 12089 12091 12097 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Gelterkinden, Bahnhof 11 33 12 03 12 40 13 03 13 40 14 03 14 40 15 11 15 40 16 11 Gelterkinden, Post 11 34 12 04 12 41 13 04 13 41 14 04 14 41 15 12 15 41 16 12 Gelterkinden, obere Mühle 11 34 12 04 12 41 13 04 13 41 14 04 14 41 15 12 15 41 16 12 Ormalingen, Unterdorf 11 37 12 07 12 44 13 07 13 44 14 07 14 44 15 15 15 44 16 15 Ormalingen, Hemmikerstrasse 12 45 14 08 15 16 Hemmiken, Dorf 12 49 14 12 15 20 Rothenfluh, Asphof 12 51 14 14 15 22 Ormalingen, Oberdorf 11 38 12 08 13 08 13 45 14 45 15 45 16 16 Rothenfluh, Hirschengasse -

Amtliche Pilzkontrolleurin Der Folgenden Gemeinden: Gelterkinden, Maisprach, Ormalingen, Anwil, Buus, Hemmiken, Oltingen, Ricken
Amtliche Pilzkontrolleurin der folgenden Gemeinden: Gelterkinden, Maisprach, Ormalingen, Anwil, Buus, Hemmiken, Oltingen, Rickenbach, Rothenfluh, Tecknau, Wenslingen CATHERINE MUELLER PILZKONTROLLE Feste Öffnungszeiten während der Jeweils am Samstag und Sonntag, Pilzsaison: von 16.00 bis 19.00 Uhr ab 5. August bis 29. Oktober 2017 Wo: Jundt-Huus, Gelterkinden Ausserhalb der Pilzsaison stehe ich 076 412 08 11 nach telefonischer Anmeldung gern [email protected] zur Verfügung. Die meisten essbaren Pilze gibt es in den Monaten April bis Ende Oktober. Im April schon kann man Morcheln finden. Der Mai schenkt uns ab und an Mairitterlinge. Ab Juni kann man damit rechnen, die wunderbar schmeckenden Pfifferlinge zu finden. Diese Pilzsorte wächst gern in Schonungen, unter Tannen, im Mischwald. Hat man einen größeren Pfifferling entdeckt, kann man damit rechnen, dass weitere kleine daneben stehen, die man sieht, wenn man die Augen weit aufmacht. Pfifferlinge gibt es bis in den Oktober. Im Juli findet man dann auch schon vereinzelt Maronen, Steinpilze oder Rotkappen. Die eigentliche Zeit dieser Sorte von Pilzen geht aber meist erst ab Mitte August los, vorausgesetzt, es ist nicht zu trocken. Ab September gibt es dann die gut schmeckenden Semmelstoppelpilze, die meist an Moos bedeckten Stellen im lichten Kiefernwald oder an Wegrändern zu finden sind. August bis Mitte Oktober hat es die meisten Pilze auch giftige Arten - eben eine sehr grosse Vielfalt. Dann heisst es obacht geben auf die giftigen Doppelgänger der beliebtesten Speisepilze! Bis gegen Ende des Monats Oktober hat der Pilzler meist schon so viele Pilze gefunden, dass er sich einen 'Wintervorrat' anlegen konnte. Gedörrt, gefroren oder eingelegt erfreuen sie dann 'hors saison' das Gourmetherz: Als Sauce zu Pasta und Fleisch oder in der Kartoffelsuppe, im Fondue, im Risotto. -

Kontakt Mitteilungsblatt Der Gemeinde Rickenbach Nr
Kontakt Mitteilungsblatt der Gemeinde Rickenbach Nr. 5, November 2018 Foto: M. Huber, 25. Oktober 2018 Inhalt Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 1 liebe Leserinnen und Leser des Kontakts Editorial In dieser Ausgabe darf ich das hilfsbereites und geselliges Völk 2 Editorial übernehmen. Wie Sie chen kennen und auch schätzen Nachrichten und vielleicht schon festgestellt haben, gelernt. Sie haben mir vor Jahren Informationen der Gemeinde gilt dieses Privileg jetzt nicht mehr den Einstieg in Rickenbach durch nur dem Gemeindepräsidium. Das Ihre Offenheit und Freundlichkeit 10 heisst aber nicht, dass unser Preesi leicht gemacht. Ich schätze das Mitteilungen der Schule dies nicht mehr machen will und unkomplizierte Wirken mit Ihnen sich davor drückt. Die Idee dahin sehr. Heute, nach ein paar Jahren, 17 ter ist, wenn das Editorial von Ge finde ich die Arbeit auf der Ge Vermischtes meinderat oder von der Verwal meindeverwaltung immer noch und Veranstaltungen tung verfasst wird, dass dadurch spannend und äusserst vielseitig. viele verschiedene Meinungen, Es ist also davon auszugehen, Gedankengänge und Denkanstös dass Sie noch ein wenig mit mir se aufs Blatt gebracht werden. Für Vorlieb nehmen müssen. die Leserschaft des Kontakts ab Wenn ich zwei drei Eigenschaften wechslungsreiche Lektüre und die der Rickenbacherinnen und Ri Arbeit wird so auf mehrere Schul ckenbacher nennen müsste, dann tern verteilt. wären es wohl folgende: Hilfs Apropos Arbeit: Ende Jahr bin ich bereitschaft, Zusammenhalt und schon neun Jahre als Gemeinde Vertrauen. schreiberin tätig. Meine Kollegin Lassen Sie mich erklären: Hilfsbe Gabi Meggiolaro gar ein halbes reitschaft erlebe ich nach jeder Ge Schalteröffnungszeiten Jahr länger. Wie die Zeit vergeht. meindeversammlung. Es ist einfach der Gemeindeverwaltung Dass wir es in Rickenbach schon Usus, dass einige Freiwillige ohne Dienstag 9.30–11.30 Uhr ein paar Jährchen ausgehalten Aufforderung die Stühle aufsta Donnerstag 17–19 Uhr haben, liegt klar am Umfeld, also peln und wegräumen. -

Friedhofgemeinde Sissach-Böckten-Diepflingen-Itingen-Thürnen
Friedhofgemeinde Sissach-Böckten-Diepflingen-Itingen-Thürnen FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSREGLEMENT FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSREGLEMENT Die Einwohnergemeinden Sissach, Böckten, Diepflingen, Itingen und Thürnen, nachstehend Friedhofgemeinde genannt, gestützt auf §§ 46 und 47 des Gemein- degesetzes vom 28. Mai 1970 und § 13 des Gesetzes über das Begräbniswesen vom 19. Oktober 1931 beschliessen: A. Allgemeine Bestimmungen § 1 Zweck 1 Das Reglement regelt die Organisation der Friedhofgemeinde. 2 Das Reglement regelt das Bestattungswesen und die Benüt- zung der Friedhofanlagen. § 2 Geltungsbe- Das Reglement hat Gültigkeit für die in der "Friedhofgemeinde" reich zusammengeschlossenen 5 Gemeinden § 3 Aufsicht 1 Die Friedhofkommission ist Aufsichts- und Kontrollorgan über das Bestattungs- und Friedhofwesen. 2 Sie ist berechtigt, in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Reglementes zu beschliessen. § 4 Vollzug Mit dem Vollzug werden beauftragt: 1 Die Gemeindeverwaltung Sissach mit den administrativen Arbeiten 2 Der Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerin für den Unterhalt und Betrieb des Fried hofes sowie die Führung des Gräberbuches. 3 Der Leiter techn. Dienste/die Leiterin techn. Dienste der Gemeinde Sissach für den Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen. § 5 Ausführungs- 1 Die Friedhofkommission erlässt im Einvernehmen mit den bestimmungen örtlichen Kirchgemeinden Weisungen über den Ablauf einer Bestattung. 2 Sie erlässt Ausführungsbestimmungen über die Gestaltung der Friedhofanlagen. 2 3 Sie erlässt die Dienstordnung für den Friedhofgärtner/die Friedhofgärtnerin und für den Leichenwagenführer/die Leichenwagenführerin. B. Organisation der Friedhofgemeinde § 6 Organe 1 Die Friedhofkommission 2 Die einzelnen Einwohnergemeinden § 7 Bestand der 1 Die Friedhofkommission besteht aus 7 Mitgliedern. Friedhofkom- mission 2 Der Gemeinderat Sissach delegiert 3 Mitglieder und zwar von Amtes wegen den Vorsteher des Friedhofwesens und ein weiteres Mitglied des Gemeinderates. -

Kilchberg 1386
Kilchberg ® Gemeinde Kilchberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft Ortsbilder Flugbild Bruno Pellandini 2006, © BAK, Bern Von Wiesenhängen flankierte ein - drückliche Staffelung intakter Bauernhäuser zu einem relativ steil abfallenden Gassenraum. Erhöhter Platz vor der filigranen neugotischen Kirche, der Stiftung eines in Eng - land reich gewor denen Kaufmanns. Dorf £££ Lagequalitäten ££$ Räumliche Qualitäten £££ Architekturhistorische Qualitäten Siegfriedkarte 1884 Landeskarte 2005 1 Kilchberg Gemeinde Kilchberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft 2 Ortszufahrt von Norden 1 3 4 5 Ref. Pfarrkirche, 1868 7 6 Kirchplatz 8 2 Kilchberg ® Gemeinde Kilchberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft Ortsbilder 1 2 4 10 3 59 12 7 6 8 11 13 14 Plangrundlage: Übersichtsplan UP5000, Geodaten des Kantons Basel-Landschaft, © Amt für Geoinformation des Kantons Basel-Landschaft Fotostandorte 1: 10000 Aufnahmen 2003: 1–14 9 Pfarrhaus, 16. Jahrhundert 10 Aussiedlerhof 11 12 13 Strassenfront von Süden 14 3 Kilchberg Gemeinde Kilchberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft Aufnahmeplan 1: 5000 aft I 0.0.3 0.1 0.0.2 0.1.1 0.0.1 I 1 1.0.4 1.0.3 1.0.1 1.0.2 1.0.5 0.0.4 Plangrundlage: Übersichtsplan UP5000, Geodaten des Kantons Basel-Landschaft, © Amt für Geoinformation Basel-Landsch III II 0.0.5 0.0.6 0.0.7 Gebiet, Baugruppe (G, B) Umgebung (U-Zo, U-Ri) Einzelelement (E) Hinweis Störfaktor Kilchberg ® Gemeinde Kilchberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft Ortsbilder G Gebiet, B Baugruppe, U-Zo Umgebungszone, U-Ri Umgebungsrichtung, E Einzelelement Art Nummer Benennung Aufnahmekategorie Räumliche Qualität Arch. hist. Qualität Bedeutung Erhaltungsziel Hinweis Störend Bild-Nr. G 1 Ortskern mit bäuerlicher Altbebauung entlang eines steil abfallenden A £££ A 1–9, 11–14 Strassenzugs, in den Hang gestaffelte Bauernhäuser mit Vorplätzen und Gärten, 17.–19.Jh. -

Bericht Des Trägervereins 19. Juni 2015 Bis 31. Dezember 2016 Shutterstock Auftrag / Leitziel
Bericht des Trägervereins 19. Juni 2015 bis 31. Dezember 2016 shutterstock Auftrag / Leitziel Die Alterstagesstätte «Zum Lebenslauf» Gelterkinden bietet Seniorinnen und Senioren mit leichten oder mittleren körperlichen, mentalen oder psychischen Beeinträchtigungen die Möglichkeit, einen halben oder ganzen Tag in Gesellschaft zu verbringen. Mit einer individuell angepassten Betreuung und bei Bedarf pflegerischer Unterstützung durch ausgewiesenes Fachpersonal wird dafür Sorge getragen, dass sich die Gäste in einer lockeren Tagesstruktur wohlfühlen. Es ergeben sich neue Beziehungen und Anregungen. Damit werden Einsamkeit und Depression vermindert, eigene Fähigkeiten werden wieder besser wahrgenommen und eingesetzt. Insgesamt soll damit die Lebensqualität der Gäste wirksam und nachhaltig verbessert werden. Inhalt Seite Auftrag / Leitziel 3 Vorwort des Präsidenten 5 Von der Vision zur Realität 6 Bericht über das erste Betriebsjahr 9 Pflegeteam 11 Besuch bei einem Gast 12 Vorstellung eines Vorstandsmitgliedes 13 Aktivitäten und Anlässe 14 Finanzen 15 Bilanz per 31.12.2016 16 Erfolgsrechnung 2015/2016 16 Revisionsbericht 17 Dank 18 Organe und Impressum 19 Handelsregisterauszug 20 Förderung Dieser Bericht dokumentiert ein Förderprojekt der Age-Stiftung - weitere Informationen dazu unter www.age-stiftung.ch. Der Bericht ist integraler Be- standteil der Förderung. Die Age-Stiftung legt ihren Fokus auf Wohnen und Älterwerden. Dafür fördert sie Wohn- und Betreuungsangebote in der deutsch- sprachigen Schweiz mit finanziellen Beiträgen. Sie engagiert sich für inspirierende zukunftsfähige Lö- sungen und informiert über gute Beispiele. Älteren Menschen einen gebührenden Platz geben! Die demografische Entwicklung der letzten Jahre zeigt eines sehr deutlich: Unsere Gesellschaft wird immer älter. Sie steht damit vor grossen Herausforderungen – vor allem in den zwei Handlungsfel- dern «Dienstleistungen und Pflege» und «Wohnen im Alter». -
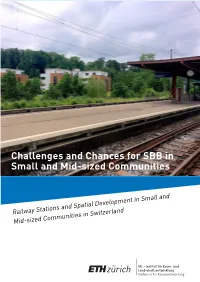
Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-Sized Communities
Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland IRL – Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung Professur für Raumentwicklung Imprint Editor ETH Zurich Institute for Spatial and Landscape Development Chair of Spatial Development Prof. Dr. Bernd Scholl Stefano-Franscini-Platz 5 8093 Zurich Authors Mahdokht Soltaniehha Mathias Niedermaier Rolf Sonderegger English editor WordsWork, Beverly Zumbühl Project partners at the SBB Stephan Osterwald Michael Loose SBB Research Advisory Board Prof. Dr. rer.pol. Thomas Bieger, University of St.Gallen Prof. Dr. Michel Bierlaire, EPFL Lausanne Prof. Dr. Dr. Matthias P. Finger, EPFL Lausanne Prof. Dr. Christian Laesser, University of St.Gallen Prof. Dr. Rico Maggi, University of Lugano (USI) Prof. Dr. Ulrich Weidmann, ETH Zurich Andreas Meyer, CEO of Schweizerische Bundesbahnen AG (Swiss Federal Railways, SBB). Project management Mahdokht Soltaniehha Mathias Niedermaier (Deputy) Print Druckzentrum ETH Hönggerberg, Zurich Photo credit Mahdokht Soltaniehha: Pages 8, 36 and cover photo Rolf Sonderegger: Pages 28 and 56 Data sources Amt für Raumentwicklung (ARE) Bundesamt für Statistik (BFS) Kantonale Geodaten AG, BE, SO, ZH Professur für Raumentwicklung, ETH Zürich - Raum+ Daten Schweizerische Bundesbahnen (SBB) swisstopo © 2015 (JA100120 JD100042) Wüest & Partner (W+P) 1 Final Report: SBB research fund Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland Citation suggestion: Scholl, B., Soltaniehha, M., Niedermaier, M. and Sonderegger, R. (2016). Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities: Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland. -

Gelterkinden
DEKANAT LIESTAL Gelterkinden Fastenopfer – Vielen Dank an die MITTEILUNGEN Klassen von Christine Amsler Offenes Chorprojekt «Firmung» Die Religionsklassen von Christine Fotos: Pfarramt Sing mit!/Singen Sie mit! Amsler haben den stolzen Betrag von Wir laden Jugendliche und Erwachse- Fr. 857.10 für das Fastenopfer gesam- ne ganz herzlich ein, beim Chorprojekt melt. Vielen herzlichen Dank! für die diesjährige Firmung, die am Samstag, 9. Juni, stattfindet, mitzuma- VORANZEIGEN chen. Wir singen diverse Lieder im Gos- pelstyle: «Joyful, joyful»; «I will follow Eucharistiefeier zu Christi Himmel- him» (aus Sister Act); «This I believe» fahrt mit den Erstkommunikanten (The Creed); «I am his child»; «I sing ho- Mittwoch, 9. Mai, 18 Uhr ly». Begleitet werden wir erneut von der Popband «DeLight». Hier sind unse- Ökumenischer Gottesdienst re Dienstagsproben: 15., 22., 29. Mai und zu Auffahrt Kommunionkurs zu Besuch in der Mühle in Maisprach. 5. Juni, 20 Uhr. Hauptprobe am Freitag, Donnerstag, 10. Mai, 10 Uhr auf der Rüti- 8. Juni, 18 Uhr. Die genaue Ausschrei- wiese in Diegten bung finden Sie auf unserer Website Mitwirkung des Musikvereins Diegten «Antreiben zum Guten und Teilen …» www.katholische-kirche-gelterkinden. sowie Samariter und Feuerwehr Böl- Am kommenden Sonntag feiern 20 Hélène Jäger und Conni und Christoph ch aufgeschaltet. Wir freuen uns, wenn chen, anschliessend Apéro mit Mög- Kinder aus sechs Dörfern unseres Wiederkehr wünschen allen zwanzig wir mit dir/Ihnen so richtig aufsingen lichkeit zum Grillieren von selber mit- Pfarreigebiets ihre Erstkommunion. Erstkommunikanten/innen im Namen können. Thomas Brand, Leitung gebrachtem Grillgut. Anfahrt ist ausge- Während der letzten Wochen und Mo- der Pfarrei einen frohen und unver- schildert. -

Rangliste+Hallenmehrkampf+2018.Pdf
! Rangliste$ Hauptsponsoren$ Kategoriensponsoren$ Wir schützen Ihr Zuhause. www.bgv.ch 26.$LGO(Hallenmehrkampf$ Sissach,$18.$März$2018$ Wir$danken$unseren$$ Sponsoren$und$Donatoren$ ! ! ! Abzeichen!Rusto!AG,!Goldach! ! Ancona!Nicola,!Carrosserie!+!Malerei,!Ormalingen! ! ! Basellandschaftliche!Gebäudeversicherung,!Liestal! ! Basellandschaftliche!Kantonalbank,!Sissach! ! Bläuer!Holzbau!AG,!Sissach! ! Bösiger!Gartenbau!AG,!Gelterkinden! ! Bracher!+!Schaub!AG,!Elektro!Unternehmung,!Ormalingen! ! Breitenstein!Fenstertechnik!AG,!Diepflingen! ! Bussinger!+!Itin,!Baut!und!Gipst,!Rothenfluh!! ! Die!Umbaumeister!GmbH,!Sissach! ! Felix!Freivogel!AG,!Fensterbau,!Gelterkinden! Garage!Rickli,!Gelterkinden! Garage!Wicki!AG,!Sissach! ! Hans!Grieder!AG,!Aushub!–!Tiefbau,!Tecknau!! Häring!Metzgerei!GmbH,!Sissach! ! Jehrmann!Ingenieure!+!Geometer!AG,!Sissach! ! LANDI!Reba!AG,!Aesch! ! MarQuis!AG,!Kanalservice,!Füllinsdorf! ! Martin!Hauswirth,!Bauleitungen,!Sissach! ! MineralQuelle!Eptingen!AG,!Sissach! ! Mobiliar!Versicherung,!Generalagentur!Liestal,!Liestal! ! Pichler!Werkzeug!AG,!Gelterkinden! ! PizzaVKurier!Sportivo,!Gelterkinden! ! PM!Mangold!Holzbau!AG,!Ormalingen! ! Protractor,!Wüthrich!&!Pichler,!Ormalingen! ! RM!Informatik,!Liestal! ! Ruepp!AG!Tiefbau!V!Strassenbau,!Ormalingen! ! Rutschmann!A.!AG,!HeizungenVLüftungen,!Sissach! ! Schaffner!Sport!GmbH,!Zunzgen! ! Schmutz!Guido,!Tiefbau!und!Kundenmaurerei,!Böckten! Solarspar,!Sissach! Spesan!AG,!Sanitäre!Anlagen,!Ormalingen! Sportamt!Baselland!/!Swisslos!Sport!–!Fonds!Baselland,!Pratteln! Strub!Ruedi!AG,!Garage,!Buckten! -

Wintersingen Buus Ormalingen Gelterkinden Böckten Sissach
Gemeinde Rickenbach Orientierender Planinhalt Gemeindegrenze Zonenplan Landschaft Perimeter Zonenplan Siedlung Statische Waldgrenze Gesamtrevision 2020 Wald Öffentliches Gewässer (offen / eingedolt) Massstab 1 : 5'000 Fruchtfolgeflächen Gefahrenzone bei Schiessanlagen . r N r r a l a p t n m e e Entwurf v x BLN-Perimeter n E I Beschluss des Gemeinderates: Namens des Gemeinderates: Nr. Archäologische Schutzzone Beschluss der Gemeindekommission: Präsident: Beschluss der Gemeindeversammlung: kantonales Naturschutzgebiet Referendumsfrist: Urnenabstimmung: Gemeindeverwalterin: Publikation der Planauflage im Amtsblatt Grundwasserschutzzone S1 (geplant; 1. Entwurf) Nr. vom Planauflage: Grundwasserschutzzone S2 (geplant; 1. Entwurf) 1285 Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft Die Landschreiberin Kantonal geschütztes Kulturdenkmal genehmigt mit Beschluss Nr. vom Publikation des Regierungsratsbeschlusses im Staufe 1297 1284 6 9 Amtsblatt Nr. vom 2 1 Buus 1100 Schlossweg 8 1 13031a 1295 Schlossweg 1b 1283 1298 1 Cholmatt 1304 1 1282 30 12877 7 1271 Chrüzacher 1299 Plan Nr. 059.05.0746 1305 1316 1307 1360 1294 1306 15. Juni 2020 Ischlag 1302 1317 Chrüegli 1100 Hirsmätteli Erstellt: BSU Geprüft: DST 1301 1313 2 Cholrüti 1293 1301 S:\059\05\0746\Gis\059_ZPL.gws 128 1291 1300 1338 1312 1315 Chrüegli 2 Eichholz 2 6 10 1185 7 1270 1287 1 Cholholz Wintersingen 1 1359 1320 1269 6 1311 1 129611841002 1302 1310 1339 1273 Zitmatte 1318 1276 Selfacher 10001001 Chrüeglihof Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG ¨ Telefon +41 (0)61 935 10 20 ¨ [email protected] ¨ www.sutter-ag.ch 1274 1183 4 1182 3 26 Höchi 1 1309 Standorte BL X Arboldswil - Laufen - Liestal - Reinach ¨ Standort SO X Nunningen 1 1 1355 8 1268 1286 1 1267 9 1 1180 g 5 1301 e 1314 1340 1379 27 w 1 t 2 t Grossacher a 1341 m 1406 1115 1279 1401t Einschlag e 1277 1179 i 2 1178 Z 1319 Breite 1407 Hofacher Farnsberg Im B 1177 1384 904 1356 Das Zonenreglement Landschaft und der Zonenplan Landschaft bilden eine Einheit. -

Liste Schulärztinnen Und Schulärzte, Kanton Basel-Landschaft Amtsperiode 2018-2022
Liste Schulärztinnen und Schulärzte, Kanton Basel-Landschaft Amtsperiode 2018-2022 Nachname Vorname Disziplin Praxisadresse PLZ Ort Schularzt-Gemeinde indergarten K Primarschule Sekudarschule Aeschlimann De Hoog Catherine Pädiatrie Pfistergasse 28 4054 Basel RSS, Münchenstein x x x Argenton Susanne Gynäkologie Allmendstrasse 20 4460 Gelterkinden Gelterkinden x Beckers Kirsten Allgemein Ergolzstrasse 52 4415 Lausen Lausen x x Bohrmann Veronica Allgemein Schulgasse 7a 4460 Gelterkinden Sissach x Buol Christiane Allgemein Hauptstrasse 72 4422 Arisdorf Arisdorf, Giebenach x x Breitenstein Claude Allgemein Eichenweg 1 4410 Liestal Liestal x Bücker Markus Pädiatrie Steinbühlweg 13 4123 Allschwil Schönenbuch, Allschwil x x x Burri Marcus Pädiatrie Oberwilerstrasse 3 4106 Therwil Therwil, Ettingen x x x Degiacomi Susanna Gynäkologie Bahnhofstrasse 4 4242 Laufen Laufen, Gymnasium x Dreher Markus Allgemein Baslerstrasse 163 4123 Allschwil Allschwil x x Franc Magdalena Allgemein Neumättli 3 4225 Brislach Brislach x x Friedli Fritz Allgemein Oristalstrasse 17 4410 Liestal Liestal, Schulheim Schillingsrain, UNICA x Galli Stefan Allgemein Frenkenstrasse 19 4434 Hölstein Hölstein x x Germanier Barbara Pädiatrie Käppelibodenweg 44 4132 Muttenz Muttenz x Gerosa Stephan Allgemein Hirzenfeldweg 4 4448 Läufelfingen Rümlingen, Häfelfingen,Buckten, Känerkinden, x x x Wittinsburg, Läufelfingen Graf-Wyttenbach Gabriela Pädiatrie Rheinstrasse 3 4410 Liestal Liestal x x Grehn Mathis Allgemein Hauptstrasse 100 4417 Ziefen Lupsingen, Ziefen x x Guldimann Linggi