Das 4. Programm Zur Barrierefreiheit Der Deutschen Bahn AG
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Neben Den Bereits Beschlossenen Und
=== VD-T === Der Virtuelle Deutschland-Takt = Strecken 950 bis 999 = Nordschwaben + Niederbayern Donauwörth, 17.9.08 Ein Integraler Taktfahrplan von Jörg Schäfer Der Virtuelle Deutschland-Takt (VD-T), www.vd-t.de, © Jörg Schäfer, Okt. 2015 - Seite 1 Übersichtskarte mit den VD-T-Kursbuchnummern Lila hervorgehoben sind die wichtigsten Verbesserun- gen des VD-T seit 1985. Der Virtuelle Deutschland-Takt (VD-T), www.vd-t.de, © Jörg Schäfer, Okt. 2015 - Seite 1 Grafischer Fahrplan für die Normal- verkehrszeit: Jede Linie stellt eine Zugfahrt Im Stundentakt dar: Reg.-Express (RE) IC-Express (ICE) (dunkel / hell zur Unterscheidung) Inter-City (IC) Inter-Regio (IR) Regionalbahn (RB) 2 Die Systematik der 900er Kursbuchnummern Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen die Deutsche Bundesbahn (DB) in ihren Kursbüchern die Bezeichnungen der Vorkriegszeit: Die Hauptstrecken hatten dreistellige Nummern (z.B. 411 Augsburg - Nürnberg) und an die abzweigenden Nebenbahnen wurden Kleinbuchstaben angehängt (z.B. 411a Augsburg - Welden und 411b Mertingen - Wertingen). Durch zahlreiche Stilllegungen sank die Zahl der Bahnlinien unter 1.000. Bei der Kursbuchreformen 1971 bekam daher jede Bahnlinie eine dreistellige Nummer. Die DB wies ihren zehn verbliebenen Bundesbahndirektionen (BD) jeweils einen Hunderterblock zu: Die BD Stuttgart bekam 700 bis 799, die BD Nürnberg 800 bis 899 und die BD München 900 bis 999. Die Hauptachsen erhielten „runde Zahlen“ mit einer „0“ am Ende, also 900, 910, 920 undsoweiter. Die davon abzweigenden Strecken wurden an der letzten Stelle fortlaufend nummeriert, an die Kursbuchstrecke (KBS) 900 schlossen somit die KBS 901, 902, 903 usw. an. Nürnberg Regensburg Skizze der 880 Nummern- 900 vergabe im A 920 930 Mühldorf DB-Kursbuch Stuttgart von 1972. -

The Climate Impacts of High-Speed Rail and Air Transportation: a Global Comparative Analysis
The Climate Impacts of High-Speed Rail and Air Transportation: A Global Comparative Analysis by Regina Ruby Lee Clewlow B.S. Computer Science, Cornell University (2001) M.Eng. Civil and Environmental Engineering, Cornell University (2002) Submitted to the Engineering Systems Division in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY September 2012 © Regina R. L. Clewlow All rights reserved The author hereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part in any medium now known or hereafter created. Signature of Author ............................................................................................................................ Engineering Systems Division August 17, 2012 Certified by ........................................................................................................................................ Joseph M. Sussman JR East Professor of Civil and Environmental Engineering and Engineering Systems Thesis Supervisor Certified by ........................................................................................................................................ Hamsa Balakrishnan Assistant Professor of Aeronautics and Astronautics and Engineering Systems Certified by ........................................................................................................................................ Mort D. Webster Assistant Professor of -
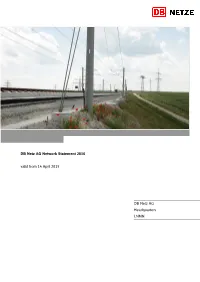
DB Netz AG Network Statement 2016 Valid from 14 April 2015 DB Netz
DB Netz AG Network Statement 2016 valid from 14 April 2015 DB Netz AG Headquarters I.NMN Version control Date Modification 12.12.2014 Amendment of Network Statement 2015 as at 12 December 2014 (Publication of the Network Statement 2016) Inclusion of detailed information in sections 1.9 ff and 4.2.5 ff due to 14.10.2015 commissioning of rail freight corridors Sandinavian-Mediterranean and North Sea-Balitc. Addition of connection to Port of Hamburg (Hohe Schaar) in section 13.12.2015 3.3.2.5 Printed by DB Netz AG Editors Principles of Network Access/Regulation (I.NMN) Theodor-Heuss-Allee 7 60486 Frankfurt am Main Picture credits Front page photo: Bildschön, Silvia Bunke Copyright: Deutsche Bahn AG Contents Version control 3 List of Annexes 7 1 GENERAL INFORMATION 9 1.1 Introduction 9 1.2 Purpose 9 1.3 Legal basis 9 1.4 Legal framework of the Network Statement 9 1.5 Structure of the Network Statement 10 1.6 Term of and amendments to the Network Statement 10 1.7 Publication and opportunity to respond 11 1.8 Contacts at DB Netz AG 11 1.9 Rail freight corridors 12 1.10 RNE and international cooperation between DB Netz AG and other RIUs 14 1.11 List of abbreviations 15 2 CONDITIONS OF ACCESS 16 2.1 Introduction 16 2.2 General conditions of access to the railway infrastructure 16 2.3 Types of agreement 17 2.4 Regulations and additional provisions 17 2.5 Special consignments 19 2.6 Transportation of hazardous goods 19 2.7 Requirements for the rolling stock 19 2.8 Requirements for the staff of the AP or the involved RU 20 2.9 Special conditions -

Ihre Anfahrt Zu MSA
Anfahrt zu MSA_Berlin_2015_Layout 1 20.02.2015 09:59 Seite 1 Ihre Anfahrt zu MSA Wir freuen uns auf Ihren Besuch... MSA • Thiemannstraße 1 • D-12059 Berlin Telefon: +49 30 6886-0 • Telefax: +49 30 6886-1558 • [email protected] • www.MSAsafety.com 1 Thiemannstraße Hertzbergplatz MSA safety .com Anfahrt zu MSA_Berlin_2015_Layout 1 20.02.2015 09:59 Seite 2 Ihre Anfahrt zu MSA Wir freuen uns auf Ihren Besuch... MSA • Thiemannstraße 1 • D-12059 Berlin Telefon: +49 30 6886-0 • Telefax: +49 30 6886-1558 • [email protected] • www.MSAsafety.com Mit dem PKW Mit der Bahn Mit dem Flugzeug Hamburg/Bremen/Rostock Berlin-Hauptbahnhof (DB) Von Tegel A10 Berliner Ring Richtung Berlin-Zentrum. Taxi: Fahrzeit ca. 20 min. Taxi: Fahrzeit ca. 30 min. Abfahrt Dreieck Oranienburg auf A111, Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn S9 bis Treptower Park Öffentliche Verkehrsmittel: A100 folgen Richtung Dresden, Abfahrt Grenzallee. oder S3, S5, S7, S75 bis Ostkreuz. S41 bis Sonnenallee. Bus 109 oder X9 bis Jakob-Kaiser-Platz. Rechts in die Grenzallee, zweite Straße links in die Sonnenallee, U-Bahn U7 Richtung Rudow bis Hermannplatz. Berlin-Ostbahnhof (DB) dritte Straße rechts in die Thiemannstraße. Bus M41 Richtung Baumschulenstraße bis Hertzbergplatz. Taxi: Fahrzeit ca. 15 min. Hannover/Nürnberg Öffentliche Verkehrsmittel: Wie von Hauptbahnhof kommend. Von Schönefeld A10 Berliner Ring bis Schönefelder Kreuz. Taxi: Fahrzeit ca. 25 min. Berlin-Lichtenberg (DB) Abfahrt Richtung Berlin-Zentrum, A113 bis Ende. Öffentliche Verkehrsmittel: Taxi: Fahrzeit ca. 15 min. 2 Rechts B96a über Adlergestell, Grünauer Straße, Schnellerstraße, S-Bahn S45 bis Köllnische Heide. Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn S5, S7, S75 bis Ostkreuz. -

Streckenkarte Regionalverkehr Rheinland-Pfalz / Saarland
Streckenkarte Regionalverkehr Rheinland-Pfalz / Saarland Niederschelden Siegen Mudersbach VGWS FreusburgBrachbach Siedlung Eiserfeld (Sieg) Niederschelden Nord Köln ten: Kirchen or Betzdorf w Au (Sieg) ir ant Geilhausen Hohegrete Etzbach Köln GrünebacherhütteGrünebachSassenroth OrtKönigsstollenHerdorf Dillenburg agen – w Breitscheidt WissenNiederhövels (Sieg)Scheuerfeld Alsdorf Sie fr Schutzbach “ Bonn Hbf Bonn Kloster Marienthal Niederdreisbach ehr Köln Biersdorf Bahnhof verk Obererbach Biersdorf Ort Bonn-Bad Godesberg Daaden 0180 t6 „Na 99h 66 33* Altenkirchen (Ww) or Bonn-Mehlem Stichw /Anruf Rolandseck Unkel Büdingen (Ww) Hattert Oberwinter Ingelbach Enspel /Anruf aus dem Festnetz, HachenburgUnnau-Korb Bad BodendorfRemagen Erpel (Rhein) *20 ct Ahrweiler Markt Heimersheim Rotenhain Bad Neuenahr Walporzheim Linz (Rhein) Ahrweiler bei Mobilfunk max. 60 ct Nistertal-Bad MarienbergLangenhahn VRS Dernau Rech Leubsdorf (Rhein) Westerburg Willmenrod Mayschoß Sinzig Berzhahn Altenahr Bad Hönningen Wilsenroth Kreuzberg (Ahr) Bad Breisig Rheinbrohl Siershahn Frickhofen Euskirchen Ahrbrück Wirges Niederzeuzheim Brohl Leutesdorf NeuwiedEngers Dernbach Hadamar Köln MontabaurGoldhausenGirod Steinefrenz Niederhadamar Namedy Elz Andernach Vallendar Weißenthurm Urmitz Rheinbrücke Staffel Miesenheim Dreikirchen Elz Süd Plaidt Niedererbach Jünkerath Mendig KO-Lützel Limburg (Lahn) KO-Ehrenbreitstein Diez Ost Gießen UrmitzKO-Stadtmitte Thür Kruft Diez Eschhofen Lissendorf Kottenheim KO-Güls Niederlahnstein Lindenholzhausen Winningen (Mosel) BalduinsteinFachingen -

Vom Bahnhof Engeln Durch Das Nettetal Nach Mayen Und Weiter Über Alte Bahntrassen Zur Mosel
Radfahren Vom Bahnhof Engeln durch das Nettetal nach Mayen und weiter über alte Bahntrassen zur Mosel 48,7km 4:00h 680m 1075m Schwierigkeit mittel Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie; Deutschland: ©GeoBasis-DE / BKG 2019, LDBV Österreich: ©1996-2019 here. All rights reserved., ©BEV 2012, ©Land Vorarlberg, Italien: ©1994-2019 ©Autonome Provinz Bozen – Südtirol Abteilung Natur, Landschaft und Raumetwicklung, © Cartago S.R.L., Schweiz: Geodata ©swisstopo, ©BAFU - Bundesamt für Umwelt Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie; OpenStreetMap: ©OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) Mitwirkende, CC-BY-SA (www.creativecommons.org) 1 / 7 Radfahren Vom Bahnhof Engeln durch das Nettetal nach Mayen ... Wegeart Höhenprofil Asphalt 0,7km Schotterweg 0km Unbekannt 48km Tourdaten Beste Jahreszeit Bewertungen Radtour Schwierigkeit mittel Autoren Strecke 48,7 km Kondition Erlebnis Dauer 4:00 h Technik Landschaft Community Aufstieg 680 m Höhenlage Tour (1) Abstieg 1075 m Weitere Tourdaten Bis auf zwei kleinere Steigungen in Mayen und Münstermaifeld geht es größtenteils bergab. Eigenschaften mit Bahn und Bus Vom Bahnhof Engeln führt die Tour zunächst in den geologische Highlights erreichbar Nachbarort Weibern mit seinem Steinmetzbahnhof (Museum). Entlang des Weiberner Bachs verläuft die Streckentour kulturell / historisch Route über Wirtschaftswege weiter nach Morswiesen, Auszeichnungen wo auf die schwach befahrene Landstraße gewechselt Einkehrmöglichkeit wird. familienfreundlich Dieser Straße folgen Sie durch das Nettetal bis kurz vor die Riedener Mühlen - hier empfiehlt sich ein Zwischenstopp an der Heilquelle Volkesfeld, wo Michael Hergarten kostenlos quellfrisches Mineralwasser probiert werden Aktualisierung: 28.01.2019 kann. Weiter durch das Nettetal radeln Sie auf der Straße zum Schloss Bürresheim (Besichtigung möglich). Kurz darauf biegen Sie an der Hammesmühle (Einkehr Diese Tour vom Bahnhof Engeln hinab ins Moseltal möglich) rechts ab in einen parallelen Wirtschaftsweg. -

Competition Figures
2017 Competition figures Publishing details Deutsche Bahn AG Economic, Political & Regulatory Affairs Potsdamer Platz 2 10785 Berlin No liability for errors or omissions Last modified: May 2018 www.deutschebahn.com/en/group/ competition year's level. For DB's rail network, the result of these trends was a slight 0.5% increase in operating performance. The numerous competitors, who are now well established in the market, once again accounted for a considerable share of this. Forecasts anticipate a further increase in traffic over the coming years. To accommodate this growth while making a substantial contribution to saving the environment and protecting the climate, DB is investing heavily in a Dear readers, modernised and digitalised rail net- work. Combined with the rail pact that The strong economic growth in 2017 we are working toward with the Federal gave transport markets in Germany and Government, this will create a positive Europe a successful year, with excellent competitive environment for the rail- performance in passenger and freight ways so that they can help tackle the sectors alike. Rail was the fastest- transport volumes of tomorrow with growing mode of passenger transport high-capacity, energy-efficient, in Germany. Rising passenger numbers high-quality services. in regional, local and long distance transport led to substantial growth in Sincerely, transport volume. In the freight mar- ket, meanwhile, only road haulage was able to capitalise on rising demand. Among rail freight companies, the volume sold remained at the -

Eighth Annual Market Monitoring Working Document March 2020
Eighth Annual Market Monitoring Working Document March 2020 List of contents List of country abbreviations and regulatory bodies .................................................. 6 List of figures ............................................................................................................ 7 1. Introduction .............................................................................................. 9 2. Network characteristics of the railway market ........................................ 11 2.1. Total route length ..................................................................................................... 12 2.2. Electrified route length ............................................................................................. 12 2.3. High-speed route length ........................................................................................... 13 2.4. Main infrastructure manager’s share of route length .............................................. 14 2.5. Network usage intensity ........................................................................................... 15 3. Track access charges paid by railway undertakings for the Minimum Access Package .................................................................................................. 17 4. Railway undertakings and global rail traffic ............................................. 23 4.1. Railway undertakings ................................................................................................ 24 4.2. Total rail traffic ......................................................................................................... -

Participating Hotels - Fixed Members' Rate Northern Europe -10%
participating hotels - Fixed Members' Rate Northern Europe -10% Hotel Code Hotel Name Country Brand H7309 ibis Yerevan Center ARMENIA IBIS H5210 ibis Bregenz AUSTRIA IBIS H1917 ibis Graz AUSTRIA IBIS H5174 ibis Innsbruck AUSTRIA IBIS H1722 ibis Linz City AUSTRIA IBIS H3748 ibis Salzburg Nord AUSTRIA IBIS H3747 ibis Wien City AUSTRIA IBIS H8564 ibis Wien Hauptbahnhof AUSTRIA IBIS H2736 ibis Wien Messe AUSTRIA IBIS HB3Y1 ibis Styles Klagenfurt am Woerthersee AUSTRIA IBIS STYLES HB426 ibis Styles Parndorf Neusiedler See AUSTRIA IBIS STYLES H9034 ibis Styles Wien City AUSTRIA IBIS STYLES HB1C2 ibis Styles Wien Messe Prater AUSTRIA IBIS STYLES H5742 Hotel Mercure Graz City AUSTRIA MERCURE HOTEL HA0Q7 Hotel Mercure Raphael Wien AUSTRIA MERCURE HOTEL H0984 Hotel Mercure Salzburg City AUSTRIA MERCURE HOTEL H9959 Hotel Mercure Vienna First AUSTRIA MERCURE HOTEL H1568 Hotel Mercure Wien City AUSTRIA MERCURE HOTEL H5358 Hotel Mercure Wien Westbahnhof AUSTRIA MERCURE HOTEL H0781 Hotel Mercure Wien Zentrum AUSTRIA MERCURE HOTEL H1276 Hotel Am Konzerthaus Vienna - MGallery AUSTRIA MGALLERY H6154 Novotel Wien City AUSTRIA NOVOTEL H8565 Novotel Wien Hauptbahnhof AUSTRIA NOVOTEL H3720 Novotel Suites Wien City Donau AUSTRIA NOVOTEL SUITES H6599 SO/ Vienna AUSTRIA SO BY SOFITEL HA1L0 ibis Baku City AZERBAIDJAN IBIS HA593 Fairmont Baku Flame Towers AZERBEIJAN FAIRMONT HB5M6 Adagio Access Brussels Delta BELGIUM ADAGIO ACCESS H1453 ibis Antwerpen Centrum BELGIUM IBIS H1047 ibis Brugge Centrum BELGIUM IBIS 1 page of 25 / 20.07.2021 participating hotels - Fixed -

Übersicht Der Betriebsstellen Und Deren Abkürzungen Aus Der Richtlinie 100
Übersicht der Betriebsstellen und deren Abkürzungen aus der Richtlinie 100 XNTH `t Harde HADB Adelebsen KAHM Ahrweiler Markt YMMBM 6,1/60,3 Bad MGH HADH Adelheide MAIC Aich/Nbay KA Aachen Hbf MAD Adelschlag MAI Aichach KASZ Aachen Schanz NADM Adelsdf/Mittelfr TAI Aichstetten KAS Aachen Süd RADN Adelsheim Nord XCAI Aidyrlia KXA Aachen Süd Gr TAD Adelsheim Ost XSAL Aigle KAW Aachen West AADF Adendorf XFAB Aigueblanche KAW G Aachen West Gbf XUAJ Adjud XFAM Aime-la-Plagne KXAW Aachen West Gr XCAD Adler MAIN Ainring KAW P Aachen West Pbf DADO Adorf (Erzg) MAIL Aipl KAW W Aachen West Wk DADG Adorf (V) DB-Gr XIAE Airole KAG Aachen-Gemmenich DAD Adorf (Vogtl) XSAI Airolo XDA Aalborg TAF Affaltrach TAIB Aischbach XDAV Aalborg Vestby XSAA Affoltern Albis MAIT Aitrang TA Aalen XSAW Affoltern-Weier XFAX Aix-en-Prov TGV XBAAL Aalter MAGD Agatharied XFAI Aix-les-Bains XSA Aarau AABG Agathenburg XMAJ Ajka XSABO Aarburg-Oftring XFAG Agde XMAG Ajka-Gyartelep XDAR Aarhus H RAG Aglasterhausen LAK Aken (Elbe) XDARH Aarhus Havn XIACC Agliano-C C XOA Al XMAA Abaliget XIAG Agrigento Centr. XIAL Ala XCAB Abdulino RA Aha XIAO Alassio HABZ Abelitz EAHS Ahaus XIALB Alba KAB Abenden HAHN Ahausen XIALA Alba Adriatica MABG Abensberg WABG Ahlbeck Grenze XUAI Alba Iulia XMAH Abrahamhegy WABO Ahlbeck Ostseeth XIAT Albate Camerlata NAHF Aburg Hochschule HAHM Ahlem RAL Albbruck NAH G Aburg-Goldbach EAHL Ahlen (Westf) XIAB Albenga EDOBZ Abzw Dbw EAHLG Ahlen Gbf AAL Albersdorf HACC Accum EAHLH Ahlen Notbstg EABL Albersloh XFAC Acheres Triage HAHO Ahlhorn RAR Albersweiler(Pf) RAH Achern HAH Ahlshausen XFAL Albertville RAH H Achern Bstg HALT Ahlten FAG Albig RAH F Achern (F) FATC Ahnatal-Casselbr LALB Albrechtshaus RAHG Achern DB/SWEG FHEH Ahnatal-Heckersh FALS Albshausen XFAH Achiet FWEI Ahnatal-Weimar RAM Albsheim(Eis) HACH Achim MAHN Ahrain TAOM Albst.-Onstmett. -

PDF Herunterladen
Integrierter 2020 Bericht Deutsche Bahn Integrierter Bericht 2020 Ein starkes Team für eine starke Schiene Deutsche Bahn Zum interaktiven Auf einen Blick Kennzahlenvergleich √ Veränderung Ausgewählte Kennzahlen 2020 2019 absolut % FINANZKENNZAHLEN IN MIO. € Umsatz bereinigt 39.902 44.431 – 4.529 – 10,2 Umsatz vergleichbar 40.197 44.330 – 4.133 – 9,3 Ergebnis vor Ertragsteuern – 5.484 681 – 6.165 – Jahresergebnis – 5.707 680 – 6.387 – EBITDA bereinigt 1.002 5.436 – 4.434 – 81,6 EBIT bereinigt – 2.903 1.837 – 4.740 – Eigenkapital per 31.12. 7.270 14.927 – 7.657 – 51,3 Netto-Finanzschulden per 31.12. 29.345 24.175 + 5.170 + 21,4 Bilanzsumme per 31.12. 65.435 65.828 – 393 – 0,6 Capital Employed per 31.12. 41.764 42.999 – 1.235 – 2,9 Return on Capital Employed (ROCE) in % – 7,0 4,3 – – Tilgungsdeckung in % 0,8 15,3 – – Brutto-Investitionen 14.402 13.093 + 1.309 + 10,0 Netto-Investitionen 5.886 5.646 + 240 + 4,3 Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 1.420 3.278 – 1.858 – 56,7 LEISTUNGSKENNZAHLEN Reisende in Mio. 2.866 4.874 –2.008 –41,2 SCHIENENPERSONENVERKEHR Pünktlichkeit DB-Schienenpersonenverkehr in Deutschland in % 95,2 93,9 – – Pünktlichkeit DB Fernverkehr in% 81,8 75,9 – – Reisende in Mio. 1.499 2.603 –1.104 –42,4 davon in Deutschland 1.297 2.123 –826 –38,9 davon DB Fernverkehr 81,3 150,7 –69,4 –46,1 Verkehrsleistung in Mio. Pkm 51.933 98.402 –46.469 –47,2 Betriebsleistung in Mio. Trkm 677,8 767,3 –89,5 –11,7 SCHIENENGÜTERVERKEHR Beförderte Güter in Mio. -

EUROPEAN AGREEMENT on IMPORTANT INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT LINES and RELATED INSTALLATIONS (AGTC) United Nations
ECE/TRANS/88/Rev.6 ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE EUROPEAN AGREEMENT ON IMPORTANT INTERNATIONAL COMBINED TRANSPORT LINES AND RELATED INSTALLATIONS (AGTC) DONE AT GENEVA ON 1 FEBRUARY 1991 __________________ United Nations 2010 Note: This document contains the text of the AGTC Agreement including the procès-verbal of rectification as notified in Depositary Notification C.N.347.1992.TREATIES-7 dated 30 December 1992. It also contains the following amendments to the AGTC Agreement: (1) Depositary Notifications C.N.345.1997.TREATIES-2 and C.N.91.1998.TREATIES-1. Entry into force on 25 June 1998. (2) Depositary Notification C.N.230.2000.TREATIES-1 and C.N.983.2000.TREATIES-2. Entry into force on 1 February 2001. (3) Depositary Notification C.N.18.2001.TREATIES-1 and C.N.877.2001.TREATIES-2. Entry into force on 18 December 2001. (4) Depositary Notification C.N.749.2003.TREATIES-1 and C.N.39.2004.TREATIES-1. Entry into force on 16 April 2004. (5) Depositary Notification C.N.724.2004.TREATIES-1 and C.N.6.2005.TREATIES-1. Entry into force on 7 April 2005. (6) Depositary Notification C.N. 646.2005.TREATIES-1 and C.N.153.2006.TREATIES-1. Entry into force on 20 May 2006. (7) Depositary Notification C.N.594.2008.TREATIES-3 and C.N. 76.2009.TREATIES-1. Entry into force on 23 May 2009. (8) Depositary Notification C.N.623.2008.TREATIES-4 and C.N 544.2009.TREATIES-2. Entry into force on 10 December 2009. The present document contains in a single, non-official document the consolidated text of the AGTC Agreement including the basic instrument, its amendments and corrections that have come into force by the dates indicated.