„...Dahin Wieein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

20 Dokumentar Stücke Zum Holocaust in Hamburg Von Michael Batz
„Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke zum Holocaust in „Hört damit auf!“ „Hört damit auf!“ 20 Dokumentar stücke Hamburg Festsaal mit Blick auf Bahnhof, Wald und uns 20 Dokumentar stücke zum zum Holocaust in Hamburg Das Hamburger Polizei- Bataillon 101 in Polen 1942 – 1944 Betr.: Holocaust in Hamburg Ehem. jüd. Eigentum Die Versteigerungen beweglicher jüdischer von Michael Batz von Michael Batz Habe in Hamburg Pempe, Albine und das ewige Leben der Roma und Sinti Oratorium zum Holocaust am fahrenden Volk Spiegel- Herausgegeben grund und der Weg dorthin Zur Geschichte der Alsterdorfer Anstal- von der Hamburgischen ten 1933 – 1945 Hafenrundfahrt zur Erinnerung Der Hamburger Bürgerschaft Hafen 1933 – 1945 Morgen und Abend der Chinesen Das Schicksal der chinesischen Kolonie in Hamburg 1933 – 1944 Der Hannoversche Bahnhof Zur Geschichte des Hamburger Deportationsbahnhofes am Lohseplatz Hamburg Hongkew Die Emigration Hamburger Juden nach Shanghai Es sollte eigentlich ein Musik-Abend sein Die Kulturabende der jüdischen Hausgemeinschaft Bornstraße 16 Bitte nicht wecken Suizide Hamburger Juden am Vorabend der Deporta- tionen Nach Riga Deportation und Ermordung Hamburger Juden nach und in Lettland 39 Tage Curiohaus Der Prozess der britischen Militärregierung gegen die ehemalige Lagerleitung des KZ Neuengam- me 18. März bis 3. Mai 1946 im Curiohaus Hamburg Sonderbehand- lung nach Abschluss der Akte Die Unterdrückung sogenannter „Ost“- und „Fremdarbeiter“ durch die Hamburger Gestapo Plötzlicher Herztod durch Erschießen NS-Wehrmachtjustiz und Hinrichtungen -

Information Issued by The
Vol. XV No. 10 October, 1960 INFORMATION ISSUED BY THE. ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN t FAIRFAX MANSIONS, FINCHLEY ROAD (Comer Fairfax Road), Offict and Consulting Hours : LONDON, N.W.3 Monday to Thursday 10 a.m.—I p.m. 3—6 p.m. Talephona: MAIda Vala 9096'7 (General Officel Friday 10 a.m.—I p.m. MAIda Vale 4449 (Employment Agency and Social Services Dept.} 'Rudolf Hirschfeld (Monlevideo) a few others. Apart from them, a list of the creators of all these important German-Jewish organisations in Latin America would hardly con tain a name of repute outside the continent. It GERMAN JEWS IN SOUTH AMERICA it without any doubt a good sign that post-1933 German Jewry has been able to produce an entirely new generation of vigorous and success I he history of the German-Jewish organisations abroad '"—to assert this would be false—they ful leaders. =8ins in each locality the moment the first ten consider themselves as the sons of the nation In conclusion two further aspects have to be r^Ple from Germany disembark. In the few which has built up the State of Israel, with the mentioned : the relationship with the Jews around thp "if- ^^^^^ Jewish groups were living before consciousness that now at last they are legitimate us, and the future of the community of Jews from ne Hitler period the immigrants were helped by members of the national families of the land they Central Europe. Jewish life in South America ne earlier arrivals. But it is interesting that this inhabit at present. -
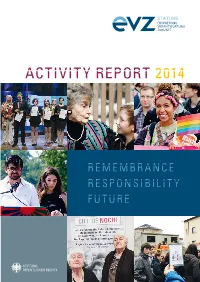
Activity Report 2014
ACTIVITY REPORT 2014 REMEMBRANCE RESPONSIBILITY FUTURE ACTIVITY REPORT 2014 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................. 6 GREETING ............................................................................................................................................................................................. 8 THE FOUNDATION EVZ .............................................................................................................................................................. 10 This report contains Fields of Activity ..................................................................................................................................................................................... 12 QR codes that can be What Was Funded .................................................................................................................................................................................. 14 scanned using a smartphone. These codes PHOTOGRAPHY COMPETITION ........................................................................................................................................... 16 are linked to additional information and/or films. FIELD OF ACTIVITY 1: THE CRITICAL EXAMINATION OF HISTORY ............................................................ 21 German Premiere for the Concert Drama Defiant Requiem in Berlin ........................................................... -

Handreichung: Oberrabbiner Dr. Joseph Zwi Carlebach. Ein Leben
Handreichung Oberrabbiner Dr. Joseph Zwi Carlebach Ein Leben zwischen Religion, Entrechtung und Deportation Hamburg Impressum Herausgeber: Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburger Straße 31, 22083 Hamburg Verantwortlich: Stephanie Fleischer, Archivpädagogik der BSB im Staatsarchiv Hamburg Kattunbleiche 19, 22041 Hamburg Dr. Helge Schröder, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Referat Gesellschaft (LIF 14), Beratungsfeld Gesellschaft-Geschichte-PGW Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg Unter Mitarbeit von Dr. Beate Meyer (IGdJ) und Dr. Heidi Martini (Sankt-Ansgar-Schule Hamburg) Gestaltung/Layout: Behörde für Schule und Berufsbildung, V 231-4 Druck: Druckerei Zollenspieker Kollektiv GmbH, Hamburg Titelabbildung: Porträt von Dr. Joseph Zwi Carlebach, mit freundlicher Genehmigung des Joseph Carlebach Instituts an der Bar Ilan Universität, Israel © Behörde für Schule und Berufsbildung, Hamburg 2019, alle Rechte vorbehalten Inhalt 1. Einleitung 4 2. Das Material im Überblick 8 3. Biographie: Dr. Joseph Zwi Carlebach (1883–1942) 11 4. Stammbaum der Familie Carlebach 12 5. Station I: Entrechtung 13 6. Station II: Enteignung 23 7. Station III: Die Kindertransporte 27 8. Station IV: Anstieg der Selbstmordrate in der jüdischen Bevölkerung 39 9. Station V: „Wiedergutmachung“ 47 10. Literatur- und Quellenverzeichnis 54 3 1. Einleitung Die Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur prägen bis heute in Deutsch- land das Bewusstsein der Menschen und ihre Wahrnehmung von Geschichte. Das gilt nicht zuletzt für den Schulunterricht, in dem nicht nur im Fach Geschichte immer wieder Bezüge zu dieser dunklen Phase der deutschen Geschichte hergestellt werden. Als „Königsweg“ der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Folgen hat sich dabei die Beschäftigung mit den Berichten von Zeitzeugen erwiesen, die in dieser Zeit auf unterschiedliche Weise zu Opfern wurden. -

The Latvian Jewish Courier, Vol. 34, No. 2
“I BELIEVE IN THE SUN EVEN WHEN IT IS NOT SHINING” A SAFE AND RESTOraTIVE ROSH HASHANAH TO ALL OUR MEMBERS! July/August 2020 | Tammuz/Av, 5780 JEWISH SURVIVORS OF LATVIA, INC. Volume 34, No. 2 THE DAY OF REMEMBRANCE FOR THE VICTIMS OF THE HOLOCAUST IN LATVIA At the monument to the burnt Gogolshul synagogue on July 4, 2020 This year, due to the Coronavirus quarantine, the Council the site of the Gogolshul synagogue, burned in 1941. of Jewish Communities of Latvia could not organize their Together with the Jewish community and several Riga usual rally that day, but instead gathered at the monument of residents, the President of Latvia Egils Levits, the Chairman of former Gogolshul in Riga to commemorate the Jewish victims the Saeima Inara Murniece, Prime Minister Krishjanis Karinsh, of genocide in Latvia. We always remember that on this day, Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkevichs, and other Latvian seventy-nine years ago, the Nazis ordered all the synagogues officials and representatives of the diplomatic corps took part in in Riga to be burned. Jews were locked and burned alive in the the ceremony. most notorious of them: The Great Choral synagogue on Gogol Participants of the memorial event also laid flowers at the Street. We will never forget this terrible crime. monument to the Saviors of the Jews. After the ceremony, On the eve of the Day of Remembrance of the victims of the the President of Latvia Egils Levits talked with the leaders of Jewish Genocide in Latvia on July 3rd, the leaders of the Council the Jewish community of Latvia—Arkady Suharenko, Dmitry of Jewish Communities of Latvia laid flowers at the memorial on Krupnikov, Benjamin Kajem, and David Kagan. -

Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden Under German Occupation: 1915-1918
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 8-2010 Shattered Communities: Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden under German Occupation: 1915-1918 Tracey Hayes Norrell [email protected] Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Part of the Diplomatic History Commons, European History Commons, History of Religion Commons, Military History Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Norrell, Tracey Hayes, "Shattered Communities: Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden under German Occupation: 1915-1918. " PhD diss., University of Tennessee, 2010. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/834 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Tracey Hayes Norrell entitled "Shattered Communities: Soldiers, Rabbis, and the Ostjuden under German Occupation: 1915-1918." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in History. Vejas G. Liulevicius, Major Professor We have read this dissertation and recommend -

Tätigkeitsbericht 2017 1
Tätigkeitsbericht 2017 1 Inhaltsverzeichnis Baden-Württemberg (BL) ...................................... 5 Oldenburger Münsterland ................................. 180 Freiburg .................................................................. 6 Osnabrück .......................................................... 184 Karlsruhe .............................................................. 11 Ostfriesland ........................................................ 187 Konstanz ............................................................... 14 Nordrhein-Westfalen (BL) ................................. 189 Oberschwaben Sitz Ravensburg ........................... 23 Aachen ............................................................... 190 Rhein-Neckar ........................................................ 27 Bielefeld ............................................................. 194 Stuttgart ............................................................... 33 Bonn ................................................................... 199 Bayern (BL)........................................................... 37 Dortmund ........................................................... 202 Augsburg und Schwaben ...................................... 38 Duisburg-Mülheim-Oberhausen ........................ 211 Franken Sitz Nürnberg ......................................... 40 Düsseldorf .......................................................... 214 München .............................................................. 42 Gelsenkirchen ................................................... -

General Conference, Universität Hamburg, 22 – 25 August 2018
NEW OPEN POLITICAL ACCESS JOURNAL RESEARCH FOR 2018 ECPR General Conference, Universität Hamburg, 22 – 25 August 2018 EXCHANGE EDITORS-IN-CHIEF Alexandra Segerberg, Stockholm University, Sweden Simona Guerra, University of Leicester, UK Published in partnership with ECPR, PRX is a gold open access journal seeking to advance research, innovation and debate PRX across the breadth of political science. NO ARTICLE PUBLISHING CHARGES THROUGHOUT 2018–2019 General Conference bit.ly/introducing-PRX 22 – 25 August 2018 General Conference Universität Hamburg, 22 – 25 August 2018 Contents Welcome from the local organisers ........................................................................................ 2 Mayor’s welcome ..................................................................................................................... 3 Welcome from the Academic Convenors ............................................................................ 4 The European Consortium for Political Research ................................................................... 5 ECPR governance ..................................................................................................................... 6 ECPR Council .............................................................................................................................. 6 Executive Committee ................................................................................................................ 7 ECPR staff attending ................................................................................................................. -

Reichskommissariat Ostland from Wikipedia, the Free Encyclopedia
Create account Log in Article Talk Read Edit View history Reichskommissariat Ostland From Wikipedia, the free encyclopedia "Ostland" redirects here. For the province of the Empire in Warhammer 40,000, see Ostland (Warhammer). Navigation Reichskommissariat Ostland (RKO) was the civilian occupation regime established by Main page Germany in the Baltic states (Estonia, Latvia, and Lithuania), the north-eastern part of Reichskommissariat Ostland Contents Poland and the west part of the Belarusian SSR during World War II. It was also known Reichskommissariat of Germany Featured content [1] initially as Reichskommissariat Baltenland ("Baltic Land"). The political organization Current events ← → for this territory—after an initial period of military administration before its establishment— 1941–1945 Random article was that of a German civilian administration, nominally under the authority of the Reich Donate to Wikipedia Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but was in reality Interaction controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar. Help The main political objective, which the ministry laid out in the framework of National Flag Emblem About Wikipedia Socialist policies for the east established by Adolf Hitler, were the complete annihilation Community portal of the Jewish population and the settlement of ethnic Germans along with the expulsion or Recent changes Germanization of parts of the native population -
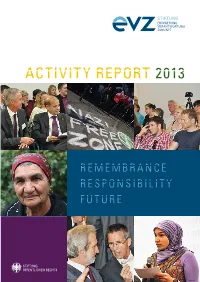
Activity Report 2013
ACTIVITY REPORT 2013 REMEMBRANCE RESPONSIBILITY FUTURE ACTIVITY REPORT 2013 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ................................................................................................................................................................................. 6 GREETING ............................................................................................................................................................................................. 8 THE FOUNDATION “REMEMBRANCE, RESPONSIBILITY AND FUTURE” (EVZ) ................................ 10 Fields of Activity ..................................................................................................................................................................................... 12 What Was Funded .................................................................................................................................................................................. 14 PHOTOGRAPHY COMPETITION ........................................................................................................................................... 16 FIELD OF ACTIVITY 1: A CRITICAL EXAMINATION OF HISTORY ................................................................ 20 International Travelling Exhibition: “Forced Labour: The Germans, the Forced Labourers, and the War” ......................................................................................................................................... 22 Roma Conference in Berlin ............................................................................................................................................................. -

Heritage at Risk
HERITAGE AT RISK HERITAGE AT RISK H@R WORLD REPORT 2016-2019 ON MONUMENTS AND SITES IN DANGER WORLD REPORT 2016-2019 ON MONUMENTS AND SITES IN DANGER ICOMOS is dedicated to the development of common doc- trines, the evolution and circulation of knowledge, the crea- tion of improved conservation techniques, and the promotion of cultural heritage significance. As an official advisory body to the World Heritage Committee for the implementation of the UNESCO World Heritage Convention, ICOMOS evaluates nomi- nations and advises on the state of conservation of properties inscribed on the World Heritage List. ICOMOS has built a solid philosophical, doctrinal and managerial framework for the sus- tainable conservation of heritage around the world. The ICOMOS Heritage at Risk Reports, first published in 2000, are part of this framework. From a strictly preservation-based approach this publication series offers world-wide information 2016about the dangers that are threatening our cultural heritage, in order to provide help in the case of risks and to promote practi- 2016-2019 cal measures to avert or at least allay these risks. The Heritage at Risk Reports are also addressed to the world public as an urgent appeal to commit itself to saving our heritage. Available also on the Internet, the reports furthermore serve as data base 2019for the ICOMOS Global Monitoring Network. 783945 880678 www.icomos.org ISBN 978-3-945880-67-8 9 HERITAGE AT RISK HERITAGE AT RISK WORLD REPORT 2016-2019 ON MONUMENTS AND SITES IN DANGER PATRIMOINE EN PÉRIL PATRIMONIO EN PELIGRO EDITED BY CHRISTOPH MACHAT AND JOHN ZIESEMER Published by hendrik Bäßler verlag · berlin Heritage at Risk edited by ICOMOS President: Toshiyuki Kono Secretary General: Peter Philips Treasurer General: Laura Robinson Vice Presidents: Leonardo Castriota, Alpha Diop, Rohit Jigyasu, Grellan D. -

"Reichskristallnacht" in Schleswig-Holstein
Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein Der Novemberpogrom im historischen Kontext Veröffentlichungen des Landesarchivs Schleswig-Holstein Band 109 Die „Reichskristallnacht“ in Schleswig-Holstein Der Novemberpogrom im historischen Kontext Herausgegeben von Rainer Hering Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Impressum Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Die Online-Version dieser Publikation ist auf den Verlagswebseiten frei verfügbar (Open Access). Die Deutsche Nationalbibliothek hat die Netzpublikation archiviert. Diese ist dauerhaft auf dem Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar: Archivserver der Deutschen Nationalbibliothek – https://portal.dnb.de/ Hamburg University Press – http://hup.sub.uni-hamburg.de/purl/HamburgUP_LASH109_Pogromnacht ISBN 978-3-943423-30-3 (Print) ISSN 1864-9912 (Print) © 2016 Hamburg University Press, Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Deutschland Produktion: Elbe-Werkstätten GmbH, Hamburg, Deutschland http://www.elbe-werkstaetten.de/ Covergestaltung: nach einem Entwurf von Atelier Bokelmann, Schleswig Inhaltsverzeichnis Rainer Hering Einleitung ...........................................................................................................................................7