Pariser Historische Studien Bd. 89 2008
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exile and Acculturation: Refugee Historians Since the Second World War
ANTOON DE BAETS Exile and Acculturation: Refugee Historians since the Second World War two forms, intended and unin- tended. Within the domain of historical writing, both exist. A famous example of intended historiographical contact was the arrival B - of the German historian Ludwig Riess ( ), a student of Leopold von Ranke, in Japan. On the recommendation of the director of the bureau of historiography, Shigeno Yasutsugu, Riess began to lecture at the Im- perial University (renamed Tokyo Imperial University in ) in . He spoke about the Rankean method with its emphasis on facts and critical, document- and evidence-based history. At his suggestion, Shigeno founded the Historical Society of Japan and the Journal of Historical Scholarship. Riess influenced an entire generation of Japanese historians, including Shigeno himself and Kume Kunitake, then well known for their demystification of entire areas of Japanese history.1 However, this famous case of planned acculturation has less well-known aspects. First, Riess, who was a Jew and originally a specialist in English history, went to Japan, among other reasons, possibly on account of the anti-Semitism and Anglo- phobia characteristic of large parts of the German academy at the time. Only in did he return from Japan to become an associate professor at the University of Berlin.2 Second, Riess and other German historians (such as Ernst Bernheim, whose Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie, published in , was popular in Japan) were influ- ential only because Japanese historical methodology focused before their arrival on the explication of documents.3 Riess’s legacy had unexpected I am very grateful to Georg Iggers, Shula Marks, Natalie Nicora, Claire Boonzaaijer, and Anna Udo for their helpful criticism. -

Soziologie in Österreich Nach 1945 Fleck, Christian
www.ssoar.info Soziologie in Österreich nach 1945 Fleck, Christian Veröffentlichungsversion / Published Version Sammelwerksbeitrag / collection article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: SSG Sozialwissenschaften, USB Köln Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Fleck, C. (1988). Soziologie in Österreich nach 1945. In C. Cobet (Hrsg.), Einführung in Fragen an die Soziologie in Deutschland nach Hitler 1945-1950 (S. 123-147). Frankfurt am Main: Cobet. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-235170 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the above-stated vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder conditions of use. -

Jahrbuch Für Forschungen Zur Geschichte Der Arbeiterbewegung, 2008/II, S.126-142
Die Novemberrevolution in der Geschichtswissenschaft der DDR: Die Kontroversen des Jahres 1958 und ihre Folgen im internationalen Kontext1 Mario Keßler Die deutsche Novemberrevolution von 1918 galt als eine ungeliebte Revolution. Keine der Parteien der Weimarer Republik vermochte sich mit ihren Ergebnissen zu identifizieren. Die Nazis und die konservativ-nationalistische Rechte lehnten die Revolution in Bausch und Bogen ab, doch auch die republiktreuen Parteien, vor allem die SPD, taten sich mit ihrem Erbe schwer. Bereits im Jahre 1921 hatte Eduard Bernstein in einem frühen Rückblick auf die Revolution „jedes unüber- legte Eingreifen in die Grundlagen der volkswirtschaftlichen Unternehmungs- und Verkehrsverhältnisse“, das zum Kern der sozialen Forderungen geworden war, entschieden zurückgewiesen,2 und acht Jahre später hatte der damalige Reichskanzler Hermann Müller in einem Erinnerungsbuch zur Novemberrevolu- tion alle Forderungen einer Nationalisierung der Schlüsselindustrien als in der Tendenz „Experimente nach russischem Muster“ be- und verurteilt.3 Die KPD hatte hingegen 1929 in ihrer „Illustrierten Geschichte der deutschen Revolution“ festgestellt: „Alle Voraussetzungen für den Sieg der proletarischen Revolution waren im November 1918 gegeben, bis auf eine – bis auf die in den Massen verwurzelte revolutionäre Partei und die eigene revolutionäre Erfahrung der Massen.“ Die Arbeiterräte seien zumeist „nach den Absichten der reformisti- schen Führer zusammengeflickt“ worden. Anfänglich politische Machtorgane der Revolution, wären sie unter dem Einfluss der Reformisten zu bloß formellen Kontrollorganen der noch nicht zerstörten alten Staatsmacht degradiert worden.4 Den gegensätzlichen Auffassungen von SPD- und KPD-Autoren war somit die Fixierung auf das sowjetische Experiment, als abschreckendes Beispiel oder als Vorbild, jedenfalls als Maßstab für die sich im November 1918 spontan in Deutschland bildenden Räte gemeinsam. -

Obituary Manfred Kossok (1930-1993)
Obituary Manfred Kossok (1930-1993) FRIEDRICH KATZ* ENRIQUE SEMO** Early in 1993, Manfred Kossok, one of Germany's leading historians of Latin America, died in Leipzig. For most of his life, he taught history at the Karl Marx University of Leipzig in what was the German Democratic Re public. Kossok was a student of Walter Markov, the dean of East Germany's historians. Markov, a specialist in the history of the French Revolution, had spent 11 years in a Nazi prison, where the library contained a huge number of books on colonial problems and especially German colonial ventures. This may have been the basis for Markov's interest in colonial problems, which led him to set up a workshop at the University of Leipzig to examine the history of Asia, Africa, and Latin America. Kossok be came the main Latin Americanist in that group, and after studying with Markov, he went to the University of Cologne to study the colonial his tory of Latin America with Richard Konetzke, the dean of German Latin American historians. Refusing an offer to teach at Cologne, Kossok returned to East Ger many, where he first wrote a dissertation on the social and economic organization of the Rio de la Plata in the colonial period. He then wrote a second dissertation (Habilitationsschrift) that was published under the title 1m Schatten der heiligen Allianz (In the Shadow of the Holy Alliance, 1964). On the basis of a huge number of unpublished archival sources from Germany, Austria, France, Britain, Spain, and Russia, Kossok pro ceeded to analyze the reasons for the failure of the Holy Alliance's efforts to reconquer Spanish America for Spain. -

243 Mitteilungen DEZEMBER 2019 JOSEF VOGL: AUFBRUCH in DEN OSTEN Österreichische Migranten in Sowjetisch-Kasachstan
DÖW DOKUMENTATIONSARCHIV DES ÖSTERREICHISCHEN WIDERSTANDES FOLGE 243 Mitteilungen DEZEMBER 2019 JOSEF VOGL: AUFBRUCH IN DEN OSTEN Österreichische Migranten in Sowjetisch-Kasachstan Hintergründe und Akteure der organisierten Gruppenemigration in die Sowjetrepublik Kasachstan in den 1920er-Jahren sowie die spätere stalinistische Verfolgung von Österreichern und Österreicherinnen in Kasachstan stehen im Fokus der Publikation von Josef Vogl. Der vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) herausgegebene Band mit zahlreichen Kurzbiogra- fien ist im November 2019 im mandelbaum verlag erschienen. Grundlage war ein vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geför- dertes Projekt, das Archivarbeiten in Kasachstan ermöglichte. Josef Vogl war 1982 bis 2006 Mitarbeiter des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts und arbeitete anschließend bis zu sei- ner Pensionierung am DÖW. Gemeinsam mit dem Historiker Barry McLoughlin veröffentlichte er 2013 die ebenfalls vom DÖW her- ausgegebene Publikation „‚... Ein Paragraf wird sich finden‘. Gedenkbuch der österreichischen Stalin-Opfer (bis 1945)“. Im März 1926 gründete eine Gruppe von mehr als 200 österreichischen Auswande- rern eine Kolonie am Fluss Syrdar’ja in Josef Vogl der Nähe von Kzyl-Orda, der damaligen Aufbruch in Hauptstadt von Kasachstan. Armut und den Osten der Mangel an Arbeitsplätzen waren die ausschlaggebenden Motive für die Emig- Österreichische ration. Die Regierung in Österreich ge- Migranten in währte finanzielle Unterstützung, um Sowjetisch- Arbeitslose und lästige Demonstranten Kasachstan loszuwerden. Die sowjetische Seite war indessen an Devisen und Agrartechnik Herausgegeben interessiert. Trotz umfangreicher Kredite vom DÖW ging die Kolonie aufgrund des unfruchtba- ren Landes und innerer Streitigkeiten be- reits 1927 zugrunde. Wien–Berlin: Archivmaterialien aus Wien, Berlin, Mos- mandelbaum kau und kasachischen Archiven erlaubten verlag 2019 es, die traurigen Schicksale der wagemuti- gen Kolonisten und ihrer Familien nach- 296 Seiten, zuzeichnen. -

Reformation History and Political Mythology in the German Democratic Republic, 1949–89
Robert Walinski-Kiehl Reformation History and Political Mythology in the German Democratic Republic, 1949–89 It is perhaps ironic that a Marxist state such as the former German Democratic Republic (GDR), which rejected all notions of divinity and the supernatural, should have paid so much atten- tion to the history of the sixteenth-century Reformation. Many of the key events of the Lutheran Reformation had occurred of course in the Saxon-Thuringian territories which were now enclosed within its borders, but this alone does not account for the intense interest that was displayed by the GDR in sixteenth- century history. Geographical proximity was of less importance than the fact that the nineteenth-century pioneer of Marxism, Frederick Engels, had shown a keen interest in events during the Reformation era. His 1850 study, The Peasant War in Germany, represented the first attempt to write history from a historical materialist perspective.1 In the GDR’s search to construct a viable, Marxist-based historical discipline that was distinct from, and in opposition to, its Western ‘bourgeois’ variant, Engels’ work acquired a special status. However, in the GDR, the Reformation era was more than just a topic of historiographical interest; it can be seen to have constituted an important founda- tion myth for this communist state. Recently, scholars have begun to focus more closely on the cultural significance of politi- cal myths for modern states. While formerly political myths were perceived rather prosaically as fictions, propaganda or simply lies, in the last few years they have been viewed in a more sophis- ticated light. -

Exilerfahrung in Wissenschaft Und Politik
Dokserver des Zentrums Digitale Reprints für Zeithistorische Forschung Potsdam http://zeitgeschichte-digital.de/Doks Mario Keßler Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Historiker in der frühen DDR http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.911 Reprint von: Mario Keßler, Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Historiker in der frühen DDR, Böhlau Köln, 2001 (Zeithistorische Studien. Herausgegeben vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Band 18), ISBN 3-412-14300-6 Copyright der digitalen Neuausgabe (c) 2017 Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. (ZZF) und Autor, alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk wurde vom Autor für den Download vom Dokumentenserver des ZZF freigegeben und darf nur vervielfältigt und erneut veröffentlicht werden, wenn die Einwilligung der o.g. Rechteinhaber vorliegt. Bitte kontaktieren Sie: <[email protected]> Zitationshinweis: Mario Keßler (2001), Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Historiker in der frühen DDR, Dokserver des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.911 Ursprünglich erschienen als: Mario Keßler, Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigrierte Historiker in der frühen DDR, Böhlau Köln, 2005 (Zeithistorische Studien. Herausgegeben vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Band 18), ISBN 3-412-14300-6 http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.911 Zeithistorische Studien Herausgegeben vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam Band 18 Corrigenda • S. 10, Zeile 16/17: statt: Kuczyński, Alfred Meusel, Hans Mottek, Arnold Reisberg und Leo Stern waren assimilierte Juden lies: Kuczyński, Hans Mottek, Arnold Reisberg und Leo Stern waren assimilierte Juden S. 147, Zeile 15/16: statt: Has-homer Hatzair lies: Ha-shomer Hatzair Copyright (c) Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam e.V. -

Walter Markov, Alfred Anderle, Ernst Werner (Hrsg.) Kleine Enzyklopädie – Weltgeschichte: Die Länder Der Erde Von a – Z
Markov, Walter akademischer Titel: Prof. Dr. phil. habil. Dr. phil. h. c. Prof. in Leipzig: 1947-1948 Dozent am Historischen Institut. 1948-1949 Professor mit vollem Lehrauftrag für mittlere und neuere Geschichte. 1949-1969 o. Professor für mittlere und neuere Geschichte. 1969-1974 o. Professor für allgemeine Geschichte der Neuzeit. Fakultät: 1947-1951 Philosophische Fakultät I – Philologisch-Historische Abteilung (1920-1951) 1951-1969 Philosophische Fakultät (1951-1969) 1969-1974 Fakultät für Philosophie und Geschichtswissenschaft - Sektion Geschichte (1969-1992) Lehr- und Französische Revolution und Revolutionsgeschichte. Jakobiner und Sansculotten. Forschungsgebiete: Geschichte der nationalen Befreiungsbewegungen in Asien und Afrika. weitere Vornamen: Karl Hugo Lebensdaten: geboren am 05.10.1909 in Graz. gestorben am 03.07.1993 in Summt am See bei Berlin. Vater: Franz Markov (Kaufm. Angestellter) Mutter: Isabella Markov (Sprachlehrerin) Konfession: ev.-luth. Lebenslauf: 1915-1919 ev. Privatschule in Graz/Österreich. 1919-1925 Slowenisches Humanistisches Gymnasium Ljubljana/Jugoslawien. 1925-1926 Serbische 3. Realgymnasium in Beograd. 1926-1927 Kroatische Humanistische Gymnasium in Sušak (heute Rijeka) mit Abitur 20.06.1927. 1927-1934 Studium d. Geschichte, Politische Geographie, Weltwirtschaft, Kirchen- u. Religions- geschichte an den Universitäten Leipzig, Köln, Berlin, Hamburg u. Bonn. 1934 Promotion u. Gründung einer studentischen Widerstandsgruppe an der Universität Bonn, Hrsg. illegaler Zeitschrift „Sozialistische Republik“. Techn. Ltr. des KPD-Unterbez. Bonn. 1934-1935 Wiss. Assistent am Orientalischen Seminar, Abt. Slawistik der Universität Bonn sowie Bibliothekar am Historischen Institut. 1935-1936 Verhaftung u. Verurteilung zu 12 Jahren Zuchthaus wegen Vorbereitung zum Hochverrat. 1936-1945 Zuchthaus Siegburg. 1945-1946 Repressalien der Besatzungsmacht wegen antifaschistischer Aktivitäten in FDJ, AStA und Kulturbund zur Erneuerung Deutschlands. -

Maciej Górny, the Nation Should Come First. Marxism and Historiography in East Central Europe (Warsaw Studies in Contemporary History, Vol
Maciej Górny, The Nation Should Come First. Marxism and Historiography in East Central Europe (Warsaw Studies in Contemporary History, vol. 1), Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main/Bern etc. 2013, 302 pp., Hardcover, 57,95 €. “Among the Czech political parties only the Communist Party of Czechoslovakia, comprising workers irrespective of nationality, has always stood for the concept of the Slovaks being a separate nation bound by history and interests to close co-operation with a brotherly Czech nation. This is one of the reasons why the Communists so largely gained the confidence of the Slovak people”. These words were written not by a historian, but by a politician, the Sudeten German political émigré and com- munist deputy in the pre-war Czechoslovak parliament Gustav Beuer, in a book marking his return from wartime exile in London to Prague and then on to East Berlin in 1946.1 Nonetheless, Beuer’s his- torically-grounded visions of and hopes for the ‘New Czechoslovakia’, and the way he chose to ex- press them here, are closely related to the key themes addressed in Maciej Górny’s fascinating new comparative, four-way study of the relationship between national traditions and Marxist(-Leninist) historiographies in the post-1945 Czech, Slovak, Polish and East German contexts. Marxism as an academic discipline, as Górny reminds us, had its roots in the late nineteenth-century ‘cult of science’. 2 It reached its apogee in the Soviet-controlled Eastern bloc of the 1960ies, when, in its official Leninist guise, it claimed to have caught up with and overtaken Western social science methodologies when it came to establishing general laws of historical development. -

Francia. Forschungen Zur Westeuropäischen Geschichte
&ƌĂŶĐŝĂ͘&ŽƌƐĐŚƵŶŐĞŶnjƵƌǁĞƐƚĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ ,ĞƌĂƵƐŐĞŐĞďĞŶǀŽŵĞƵƚƐĐŚĞŶ,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚWĂƌŝƐ ;/ŶƐƚŝƚƵƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĂůůĞŵĂŶĚͿ ĂŶĚϭϵͬϯ;ϭϵϵϮͿ K/͗10.11588/fr.1992.3.57530 ZĞĐŚƚƐŚŝŶǁĞŝƐ ŝƚƚĞ ďĞĂĐŚƚĞŶ ^ŝĞ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŝŐŝƚĂůŝƐĂƚ ƵƌŚĞďĞƌƌĞĐŚƚůŝĐŚ ŐĞƐĐŚƺƚnjƚ ŝƐƚ͘ ƌůĂƵďƚ ŝƐƚ ĂďĞƌ ĚĂƐ >ĞƐĞŶ͕ ĚĂƐ ƵƐĚƌƵĐŬĞŶ ĚĞƐ dĞdžƚĞƐ͕ ĚĂƐ ,ĞƌƵŶƚĞƌůĂĚĞŶ͕ ĚĂƐ ^ƉĞŝĐŚĞƌŶ ĚĞƌ ĂƚĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ ĞŝŐĞŶĞŶ ĂƚĞŶƚƌćŐĞƌ ƐŽǁĞŝƚ ĚŝĞ ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ njƵ ƉƌŝǀĂƚĞŶ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚͲ ŬŽŵŵĞƌnjŝĞůůĞŶ ǁĞĐŬĞŶ ĞƌĨŽůŐĞŶ͘ ŝŶĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ ƵŶĞƌůĂƵďƚĞ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͕ ZĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŽĚĞƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĞŝŶnjĞůŶĞƌ /ŶŚĂůƚĞ ŽĚĞƌ ŝůĚĞƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŽǁŽŚů njŝǀŝůͲ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚůŝĐŚ ǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘ Allan Mitchell A FLIGHT ATDUSK: OTTO PFLANZE’S NEW BIOGRAPHY OF BISMARCK It is a rare and wise old bird that can admit a false start, return to its perch, and then soar off to greater heights. That feat has been adroitly performed by Otto Pflanze, who required nearly a quarter of a Century to remedy some manifest defects of the opening installment of his Bismarck biography and to add two further volumes completing the project. The result is a magnificently produced trilogy published by Princeton University Press, which represents on balance the most thorough and satisfactory treatment of the German chancellor available in any language1. Beginning in the early 1960s, as Pflanze now acknowledges, a »new departure« in historio- graphy became apparent; indeed, »a revolution began in the Interpretation of German history«2. An older generation of scholars, like Gerhard Ritter and Hans Rothfels, was succeeded by a younger, in the vanguard of which were Helmut Böhme and Hans-Ulrich Wehler. The elders had stressed the primacy of foreign policy, the skill of Bismarck’s statecraft, and the largely positive contributions of his political career. -

The Interpreters of Europe and the Cold War: Interpretive Patterns in French, German, and Polish Historiography and Literary Studies
The Interpreters of Europe and the Cold War: Interpretive patterns in French, German, and Polish historiography and literary studies Barbara Picht / Europa-Universität iadrina Fran!furt #$der% &his postdoctoral project e(amines the "irst two postwar decades, as many societies gradually found their European and national *places* and had to legitimi+e these culturally and historically against the backdrop of the ,old -ar rivalry of systems and ideologies. It investigates academic self-designs in postwar Europe, with the focus on literature and historiography as the central discourses in constructing national identities. &he project selects a historian and a literary scholar each from France, the Federal /epublic, the G0/ and Poland, whose wor! figured signi"icantly in the discursive processes of the postwar period1 Fernand Braudel and /obert 2inder in France, -erner ,on+e and Ernst /obert ,urtius in -est Germany, -alter 2ar!ov and -erner 3rauss in East Germany, and $s!ar 4alecki and ,+esła) 2iłos+ in Poland and, respectively, in U6 e(ile. 6tri!ingly, we find that the ,old -ar played a rather marginal part in these historians7 and literary scholars7 agendas. Even into the 89:;s, they argued ta!ing the idea of an undivided Europe for granted. -hat BERLI=ER 3$<<EG KALTER KRIEG > BERLI= ,EN&ER FOR ,$<0 -?R 6&U0IES @;8A Barbara Picht The Interpreters of Europe and the Cold War !ind of historical thin!ing *encountered* the ,old -ar in their wor!B 4ow could they hold fast to understandings of Europe and the nation that, from today7s perspective, seem far more suited to either the pre- and interwar periods or even the decades following 89C9 than to the height of he ,old -arB In star! contrast to what one might e(pect, these thin!ers sought neither to undermine the systems7 frontiers nor to construct a political alternative to the bipolar logic of the time. -
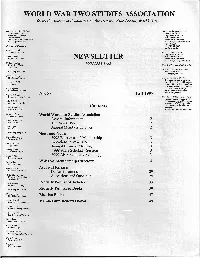
Fall 1997 Rutgers University, Newark H-WAR: Tile Military History Netwon (Sponsored by H·Net: H"Mlmitics Allan R
WORLD WAR TWO STUDIES ASSOCIATION (formerly American Committee on the History ofthe Second World War) Donald S. Detwiler, Chairman Mark P. Parillo, Seerewry and Department of History Newsleller Editor Southern lIlinois Univ~jty Departmenl of Hislory at Carbondale 208 Eisenhower Hall Carbondale, Illinois 62901-4519 Kansas Stale Univ~ity [email protected]/ Manhattan, Kansas 6650&- 1002 785-532-0374 Permanent Directors FAX 785-532-7004 pari/[email protected] Charles F. Delzell Vanderbilt University Robin Higham, Archivist Department of Hislory Arthur L Funk 208 Eisenhower Hall Gainesville, Florida NEWSLETTER Kansas Slate University Manhattan, Kansas 66506- 1002 H. Stuart Hughes University of California. ISSN 0885-5668 The WWTSA is affiliated with: San Diego American Historical Association Terms expiring 1997 400 A Street, S.E. Washington, D. C. 20003 James L. Collins. Jr. Middleburg, Virginia Comite international d'histoire de la deuxieme guerre mondiale John Lewis Gaddis Henry Rousso, General Secretary Yale University Institut d'histoire du temps present (Centre national de la recherche Robin Higham seienlifique [CNRSJ) Kansas Slate University 44. rue de l'Amiral Mouehc7. 75014 Paris, France Warren F. Kimball No. 58 Fall 1997 Rutgers University, Newark H-WAR: Tile Military History Netwon (sponsored by H·Net: H"mlmitics Allan R. Milieu & Social Sciences OnLine). which Ohio State Univcrsiry supports the WWTSA's website on the internet at the following Agnes F. Peterson Contents address (URL): Hoover Institution hllp:Jlh-net2,msu.edul-Mlarlwwfsa Russell F. Weigley Temple University World War Two Studies Association Roberta Wohlstetter General Information 2 Pan Heuristics The Newsletter 2 Janet Ziegler UCLA Annual Membership Dues 2 Terms expiring 1998 News and Notes Martin Blumenson Washington, D.C.