Soziologie in Österreich Nach 1945 Fleck, Christian
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Exile and Acculturation: Refugee Historians Since the Second World War
ANTOON DE BAETS Exile and Acculturation: Refugee Historians since the Second World War two forms, intended and unin- tended. Within the domain of historical writing, both exist. A famous example of intended historiographical contact was the arrival B - of the German historian Ludwig Riess ( ), a student of Leopold von Ranke, in Japan. On the recommendation of the director of the bureau of historiography, Shigeno Yasutsugu, Riess began to lecture at the Im- perial University (renamed Tokyo Imperial University in ) in . He spoke about the Rankean method with its emphasis on facts and critical, document- and evidence-based history. At his suggestion, Shigeno founded the Historical Society of Japan and the Journal of Historical Scholarship. Riess influenced an entire generation of Japanese historians, including Shigeno himself and Kume Kunitake, then well known for their demystification of entire areas of Japanese history.1 However, this famous case of planned acculturation has less well-known aspects. First, Riess, who was a Jew and originally a specialist in English history, went to Japan, among other reasons, possibly on account of the anti-Semitism and Anglo- phobia characteristic of large parts of the German academy at the time. Only in did he return from Japan to become an associate professor at the University of Berlin.2 Second, Riess and other German historians (such as Ernst Bernheim, whose Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie, published in , was popular in Japan) were influ- ential only because Japanese historical methodology focused before their arrival on the explication of documents.3 Riess’s legacy had unexpected I am very grateful to Georg Iggers, Shula Marks, Natalie Nicora, Claire Boonzaaijer, and Anna Udo for their helpful criticism. -

243 Mitteilungen DEZEMBER 2019 JOSEF VOGL: AUFBRUCH in DEN OSTEN Österreichische Migranten in Sowjetisch-Kasachstan
DÖW DOKUMENTATIONSARCHIV DES ÖSTERREICHISCHEN WIDERSTANDES FOLGE 243 Mitteilungen DEZEMBER 2019 JOSEF VOGL: AUFBRUCH IN DEN OSTEN Österreichische Migranten in Sowjetisch-Kasachstan Hintergründe und Akteure der organisierten Gruppenemigration in die Sowjetrepublik Kasachstan in den 1920er-Jahren sowie die spätere stalinistische Verfolgung von Österreichern und Österreicherinnen in Kasachstan stehen im Fokus der Publikation von Josef Vogl. Der vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) herausgegebene Band mit zahlreichen Kurzbiogra- fien ist im November 2019 im mandelbaum verlag erschienen. Grundlage war ein vom Zukunftsfonds der Republik Österreich geför- dertes Projekt, das Archivarbeiten in Kasachstan ermöglichte. Josef Vogl war 1982 bis 2006 Mitarbeiter des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts und arbeitete anschließend bis zu sei- ner Pensionierung am DÖW. Gemeinsam mit dem Historiker Barry McLoughlin veröffentlichte er 2013 die ebenfalls vom DÖW her- ausgegebene Publikation „‚... Ein Paragraf wird sich finden‘. Gedenkbuch der österreichischen Stalin-Opfer (bis 1945)“. Im März 1926 gründete eine Gruppe von mehr als 200 österreichischen Auswande- rern eine Kolonie am Fluss Syrdar’ja in Josef Vogl der Nähe von Kzyl-Orda, der damaligen Aufbruch in Hauptstadt von Kasachstan. Armut und den Osten der Mangel an Arbeitsplätzen waren die ausschlaggebenden Motive für die Emig- Österreichische ration. Die Regierung in Österreich ge- Migranten in währte finanzielle Unterstützung, um Sowjetisch- Arbeitslose und lästige Demonstranten Kasachstan loszuwerden. Die sowjetische Seite war indessen an Devisen und Agrartechnik Herausgegeben interessiert. Trotz umfangreicher Kredite vom DÖW ging die Kolonie aufgrund des unfruchtba- ren Landes und innerer Streitigkeiten be- reits 1927 zugrunde. Wien–Berlin: Archivmaterialien aus Wien, Berlin, Mos- mandelbaum kau und kasachischen Archiven erlaubten verlag 2019 es, die traurigen Schicksale der wagemuti- gen Kolonisten und ihrer Familien nach- 296 Seiten, zuzeichnen. -
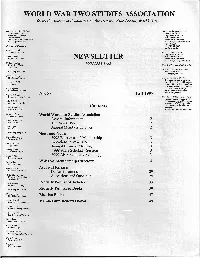
Fall 1997 Rutgers University, Newark H-WAR: Tile Military History Netwon (Sponsored by H·Net: H"Mlmitics Allan R
WORLD WAR TWO STUDIES ASSOCIATION (formerly American Committee on the History ofthe Second World War) Donald S. Detwiler, Chairman Mark P. Parillo, Seerewry and Department of History Newsleller Editor Southern lIlinois Univ~jty Departmenl of Hislory at Carbondale 208 Eisenhower Hall Carbondale, Illinois 62901-4519 Kansas Stale Univ~ity [email protected]/ Manhattan, Kansas 6650&- 1002 785-532-0374 Permanent Directors FAX 785-532-7004 pari/[email protected] Charles F. Delzell Vanderbilt University Robin Higham, Archivist Department of Hislory Arthur L Funk 208 Eisenhower Hall Gainesville, Florida NEWSLETTER Kansas Slate University Manhattan, Kansas 66506- 1002 H. Stuart Hughes University of California. ISSN 0885-5668 The WWTSA is affiliated with: San Diego American Historical Association Terms expiring 1997 400 A Street, S.E. Washington, D. C. 20003 James L. Collins. Jr. Middleburg, Virginia Comite international d'histoire de la deuxieme guerre mondiale John Lewis Gaddis Henry Rousso, General Secretary Yale University Institut d'histoire du temps present (Centre national de la recherche Robin Higham seienlifique [CNRSJ) Kansas Slate University 44. rue de l'Amiral Mouehc7. 75014 Paris, France Warren F. Kimball No. 58 Fall 1997 Rutgers University, Newark H-WAR: Tile Military History Netwon (sponsored by H·Net: H"mlmitics Allan R. Milieu & Social Sciences OnLine). which Ohio State Univcrsiry supports the WWTSA's website on the internet at the following Agnes F. Peterson Contents address (URL): Hoover Institution hllp:Jlh-net2,msu.edul-Mlarlwwfsa Russell F. Weigley Temple University World War Two Studies Association Roberta Wohlstetter General Information 2 Pan Heuristics The Newsletter 2 Janet Ziegler UCLA Annual Membership Dues 2 Terms expiring 1998 News and Notes Martin Blumenson Washington, D.C. -
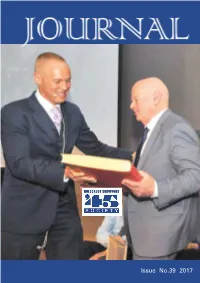
Issue No.39 2017 Contents
Issue No.39 2017 contents THE MIRACLE OF ISRAEL REMEMBERING JACK KAGAN CHAIM FERSTER YOM HA’ AZTMAUT Michael Kagan Page 60-62 Arron Ferster Page 123-124 Aubrey Rose Page 3-5 THE FACE TO OSWIECIM. 70 YEARS SINCE THE BOYS ARRIVE IN WINDEMERE JEWISH HUMOUR Michael Kagan Page 63-64 Page 123-128 Aubrey Rose Page 6-8 MINIA JAY '45 Aid Society GHETTO MENTALITY Denise Kienwald Page 64 The Boys, Triumph over Adversity Michael Etkind Page 9-11 Esther Gilbert Page 130-131 I WAS THERE NEVER AGAIN, L’CHAIM I SURVIVED SAMUEL AND BENJAMIN Robert Sherman Page 12-13 6 MILLION DIDN'T NURTMAN Page 132-138 THE HOLOCAUST THE CLEARING IN THE FOREST Sam Gontarz Page 65-78 BUNCE COURT SCHOOL Sam Dresner 2017 Page 13 Barbara Barnett Page 139-141 MY RETURN TO LODZ (LITZMANSTADT AS IT WAS JUDITH SHERMAN STORY THEN CALLED) FOR THE COMMEMORATIONOF THE Second/Third Generation Speaker Programme Page 14-15 60TH ANNIVERSARY OF THE LIQUIDATION OF LODZ Sue Bermange Page 142-143 GHETTO JANUSZ MAKUCH, CREATOR OF THE JEWISH Sam Gontarz Page 79-80 MEMORY QUILT GOES ON DISPLAY AT CULTURAL FESTIVAL IN KRAKOW LONDON JEWISH MUSEUM Page 16 HOLOCAUST EDUCATION - TRAINING SESSIONS Page 144 THIS IS THE STORY OF ITA JAKUBOWWICZ FOR SECOND/THIRD GENERATION SPEAKERS Page 16-18 Geraldine Jackson Page 81-82 'HOW CAN WE TURN AWAY REFUGEES?' ASKS HOLOCAUST SURVIVOR UPDATED BIO ON ETTA GROSS ZIMMERMAN SECOND GENERATION, LEARNING TO PRESENT Page 145 Page 19 OUR PARENTS STORIES Gaynor Harris Page 84 THE BOYS VISIT THE MEMORY QUILT EXHIBITED AT IN EVERY GENERATION THE UK HOLOCAUST CENTRE. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 81, 1961
its ' r BOSTON \ SYMPHONY ORCHESTRA FOUNDED IN 1881 BY •f HENRY LEE HIGGINSON 4tf!%\ \ilPM- SANDERSSANDERb THEATRE oA^'H // *¥ iVfi Hl/lPM'/ (Harvard University) V^#\kA%T^^~ '"«.«•» te ! &' * r^ / /^ v. I \- v .^?:~.. EIGHTY-FIRST SEASON 1961-1962 Qharles <Jttunch Qonducts the Boston Symphony entire Champion of Ravel, Charles Munch reveals a full flowering of the "Daphnis and Chloe" score. A sumptuous work with a wealth of sensuous beauty. Organ, Dr. Munch also presents the charming, urbane "Concerto in G Minor for de Strings and Timpani" by Poulenc; and the witty Stravinsky ballet, "Jeu Cartes." In Living Stereo and Monaural Hi-Fi. RCA VICTOR THE MOST TRUSTED NAME IN SOUND EIGHTY-FIRST SEASON, 1961-1962 Boston Symphony Orchestra CHARLES MUNCH, Music Director Richard Burgin, Associate Conductor CONCERT BULLETIN with historical and descriptive notes by John S. BURK The TRUSTEES of the BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, Inc. Henry B. Cabot President Talcott M. Banks Vice-President Richard C. Paine Treasurer Abram Berkowitz John T. Noonan Theodore P. Ferris Mrs. James H. Perkins Francis W. Hatch Sidney R. Rabb Harold D. Hodgkinson Charles H. Stockton C. D. Jackson John L. Thorndike E. Morton Jennings, Jr. Raymond S. Wilkins Henry A. Laughlin Oliver Wolcott TRUSTEES EMERITUS Philip R. Allen Lewis Perry Edward A. Taft Palfrey Perkins Thomas D. Perry, Jr., Manager Norman S. Shirk James J. Brosnahan Assistant Manager Business Administrator Leonard Burkat Rosario Mazzeo Music Administrator Personnel Manager SYMPHONY HALL BOSTON 15 LSi Boston Symphony -

Award Drafted on 3
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Denial to Claimant [REDACTED] Claimed Account Owner: Leo Stern1 Claim Number: 500360/RT This Certified Denial is to the claim of [REDACTED] (the “Claimant”) to a Swiss bank account potentially owned by the Claimant’s relative, Leo (Karl) Stern (the “Claimed Account Owner”). All denials are published, but where a claimant has requested confidentiality, as in this case, the names of the claimant, any relatives of the claimant other than the account owner, and the bank have been redacted. Information Provided by the Claimant The Claimant submitted a claim stating that Leo Stern, who was Jewish, resided in Ostrava, Czechoslovakia (now Czech Republic) between 1914 and 1939, when he was deported. The Claimant further stated that Leo Stern could escape from the transport and fled to Lwow, (formerly Poland, later Union of Soviet Socialist Republics, now Lviv, Ukraine) where he later perished. The Claimant further stated that his relative was the owner of a forest in Austria and a lumber mill in Jablunkov, Czechoslovakia. The Claimant also stated that his relative rented an additional lumber mill in Kaschau (Kosice), Czechoslovakia (now Kosice, Slovakia). The CRT notes that the Claimant provided documents which show that his relative resided in Ostrava, that he had a lumber mill in Jablunkov and was the owner of a forest in Austria. The Claimant did not provide any documents which would establish a connection between his relative and Kosice. The CRT’s Investigation The CRT matched the name of Leo (Karl) Stern to the names of all account owners in the Account History Database and identified accounts belonging to individuals whose names match, or are substantially similar to, the name of the Claimed Account Owner. -

Claims Resolution Tribunal
CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL In re Holocaust Victim Assets Litigation Case No. CV96-4849 Certified Denial to Claimant [REDACTED] in re Accounts of Leopold Stern and Accounts of Leo Stern and Account of Willy Fritz (Power of Attorney Holder Leo Stern)1 and Account of the Estate of Leo Stern Claim Number: 203958/MBC2 This Certified Denial is based on the claim of [REDACTED], née [REDACTED] (the Claimant ) to accounts of herself, Hugo Paradies, Alma Paradies, née Hirschberg, Hede Stern, née Hirschberg, and Leopold (Leo) Stern. The CRT did not locate an account belonging to [REDACTED], Hannelore Paradies, Hugo Paradies, Alma Paradies, Alma Hirschberg, Hede Stern, or Hede Hirschberg in the Account History Database prepared pursuant to the investigation of the Independent Committee of Eminent Persons ( ICEP or ICEP Investigation ), which identified accounts probably or possibly belonging to Victims of Nazi Persecution, as defined in the Rules Governing the Claims Resolution Process, as amended (the Rules ). This Denial is to the published accounts of Leopold Stern ( Account Owner 1 ) at the [REDACTED] ( Bank 1 ), to the published account of Leopold Stern ( Account Owner 2 ) at the [REDACTED]( Bank 2 ), to the published account of Leopold Stern ( Account Owner 3 ) and to the published account of Willy Fritz ( Account Owner 4 ), both at the [REDACTED] ( Bank 3 ), and to the published accounts of two individuals named Leo Stern ( Account Owner 5 and "Account Owner 6") and the unpublished account of the Estate of Leo Stern ("Account Owner 7"),3 all at the [REDACTED] ( Bank 4 ). 1 In an effort to locate any and all accounts that might have belonged to the Claimant s relative, the CRT has reviewed and analyzed all accounts whose owners or power of attorney holders names are substantially similar to that of the Claimant s relative, even if the Claimant did not specifically claim that particular account and even if the Claimant could not identify the owner of the account as her relative. -
Hodder & Stoughton Spring 2021 Translation Rights Guide
Hodder & Stoughton Spring 2021 Translation Rights Guide TABLE OF CONTENTS 2021 SPRING HIGHLIGHTS……………………………………………………………………….…1 FICTION………………………………………………………………………………………………………2 CRIME & THRILLER……………………………………………………………………………………16 LITERARY……………………………………………………………………………………………….…23 NON-FICTION……………………………………………………………………………………………25 LIFESTYLE …………………………………………………………………………………………………41 FOOD………………………………………………………………………………………………..………45 FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: Rebecca Folland, Rights Director: [email protected] Melis Dagoglu, Head of Rights: [email protected] Grace McCrum, Senior Rights Manager: [email protected] More information on our Partner Agents: Albania, Bulgaria & Macedonia - Anthea Agency - [email protected] Brazil - Riff Agency- [email protected] China and Taiwan - The Grayhawk Agency - [email protected] Czech Republic & Slovakia - Kristin Olson Agency- [email protected] Greece - OA Literary Agency - [email protected] Hungary, Croatia, Serbia, Slovenia - Katai and Bolza Literary Agency - [email protected] Indonesia - Maxima Creative Agency – [email protected] Japan - Tuttle-Mori Agency - [email protected] Korea - Eric Yang Agency - [email protected] Romania - Simona Kessler International - [email protected] Thailand and Vietnam - The Grayhawk Agency - [email protected] Turkey - AnatoliaLit Agency - [email protected] 2021 SPRING HIGHLIGHTS FICTION: THE FAIR BOTANISTS by Sara Sheridan (p.2) A bewitching and immersive story set in Edinburgh centring around the highly sought after bloom, the Agave Americana plant, which has the city stirring with excitement and secrets ready to un- fold…we’ve teamed up with the Edinburgh Botanical Gardens, and can’t wait for readers to fall in love with these characters and the city. SEVENTEEN by John Brownlow (p.16) An electrifying thriller about hitman, Seventeen, who is assigned to kill his predecessor...until sud- denly the hunter becomes the hunted. -

General Issues
BIBLIOGRAPHY GENERAL ISSUES RELIGIONS AND PHILOSOPHY DANIEL, JOHN. Labor, Industry and the Church. A study of the inter- relationships involving the church, labor and management. Con- cordia Publishing House, Saint Louis 1957. xi, 229 pp. $ 3.00. From the point of view of his Lutheran convictions the author of this book views the fundamental social-economic and ethical questions of today. He observes that the relations between the church, the workers and the management are confused by prejudices on both sides and wishes to contribute to a better mutual understanding. A picture is given of the organisations of the employers and workers, the form of the state and the economic life, work, wages, leisure time etc. An attempt is made to find an answer in the Bible to numerous questions. GLUM, FRIEDRICH. Jean Jacques Rousseau. Religion und Staat. Grundlegung einer demokratischen Staatslehre. Verlag W. Kohlham- mer, Stuttgart 1956. 418 pp. DM 24.00 The author has given us a new interpretation of the political writings. Already in his short introductory biography it becomes clear that he does not follow established opinions. In a thorough discussion of the work of Rousseau, including his corre- spondence, and often in a critical examination of the literature on the subject, he draws a picture of a Rousseau whose theories were in essentials intended for a Christian- inspired democracy - a democracy which in the later writings assumes outspoken conservative traits. One chapter deals extensively with Rousseau's critics whose opinions are reproduced in a detailed form. LUKACS, GEORG. Der junge Hegel und die Probleme der kapitalis- tischen Gesellschaft. -

Negotiated History? Bilateral Historical Commissions in Twentieth-Century Europe
7 Negotiated history? Bilateral historical commissions in twentieth-century Europe Marina Cattaruzza and Sacha Zala !is chapter sets out to describe the various processes and circumstances which led to the establishment of bilateral historical commissions charac- terised by the participation of historians from two di"erent countries, and to outline their general typology.1 Because of the limited interest researchers have shown in the matter up until now, we are unable here to deal with the vast case-history involving this type of historical commission. However, we still think it is worth making a start, and bringing a historiographical perspective to bear on this neglected (though far from unimportant) aspect of the organisation of historical knowledge, in which di"erent national traditions come face to face and where the relationship between history and politics is crucial. A nation and its history are inextricably bound together, and this bond can be anything but unproblematic. !ere is nothing new about the problems bound up with the various national sensibilities: they had already been recognised in the mid-nineteenth century by one of the #rst great historians to make scienti#c research on themes of international history. In fact, when publication of his Englische Geschichte was about to begin in 1859, the German historian Leopold von Ranke stated cryptically that since he was writing the history of a nation which was not his own, he could not claim to have written a national history, since ‘that would be a contradiction in itself’.2 Bilateral commissions composed of representatives of historians from two countries with various aims, came into being because of the awareness of the strong national roots of historiographical practice, and in this sense, can be seen as a kind of attempt to redress the balance. -
Annual Report
Live generously. It does a world of good. Annual Report‘05 The Mission of the Jewish Federation of Greater Seattle is to ensure Jewish survival and enhance the quality of Jewish life by meeting needs locally, in Israel and worldwide. Table of Contents Dear Friends: A Letter From Our Leadership ...............................................................................4 Greatest Needs Fund ..................................................................................................................... 5 Benefi ciary Agencies ..................................................................................................................... 6 2005 Annual Community Campaign ...........................................................................................7 Planned Giving and Endowments ................................................................................................8 Israel and Overseas ....................................................................................................................... 9 Jewish Education Council ........................................................................................................... 10 Young Leadership Division ......................................................................................................... 11 Women’s Philanthropy ............................................................................................................... 12 Building Community ................................................................................................................. -

Tragic Pages: How the GDR, FRG and Japan Processed Their War History--Lessons for Education Forpeace
DOCUMENT RESUME ED 359 120 SO 023 027 AUTHOR Aspeslagh, Robert TITLE Tragic Pages: How the GDR, FRG and Japan Processed Their War History--Lessons for Education forPeace. Peace Education Miniprints No. 39. INSTITUTION Lund Univ. (Sweden). Malmo School of Education. REPORT NO ISSN-1101-6418 PUB DATE Nov 92 NOTE 41p. PUB TYPE Viewpoints (Opinion/Position Papers, Essays, etc.) (120) Information Analyses (070) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. DESCRIPTORS Foreign Countries; Higher Education; *History Instruction; *Peace; Political Socialization; Secondary Education; *World War II IDENTIFIERS East Germany; *Germany; "Japan; Peace Education;West Germany ABSTRACT This document describes the ways in which Japanand the German nations have taught the history ofWorld War II. According to the document, the former German Democratic Republic (GDR)took a pro-communist and anti-fascist approach to the subject.At the same time, the Western Allies pressured the FederalRepublic of Germany (FRG) to institute a political educationsystem designed to prevent the Germans from starting anewon the track toward fascism. In recent years, the FRG took greater responsibility for the War, and themass media were instrumental in bringing informationto the German public. Japanese teaching about the War downplays the nation'saggression in Asia and the Pacific and emphasizes the atomicbombings of Hiroshima and Nagasaki by the United States. The documentargues that there is a continued need for peace education concerning World WarII, but there is also a need to avoid negative politicizationof the issue. Eighteen endnotes are included along with 47references. (LBG) *********************************************************************** Reproductions supplied by EDRSare the best that can be made from the original document.