LEONARDO DATI, Trophaeum Anglaricum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Online Library of Liberty: the Historical, Political, and Diplomatic Writings, Vol
The Online Library of Liberty A Project Of Liberty Fund, Inc. Niccolo Machiavelli, The Historical, Political, and Diplomatic Writings, vol. 1 (Life of Machiavelli, History of Florence) [1532] The Online Library Of Liberty This E-Book (PDF format) is published by Liberty Fund, Inc., a private, non-profit, educational foundation established in 1960 to encourage study of the ideal of a society of free and responsible individuals. 2010 was the 50th anniversary year of the founding of Liberty Fund. It is part of the Online Library of Liberty web site http://oll.libertyfund.org, which was established in 2004 in order to further the educational goals of Liberty Fund, Inc. To find out more about the author or title, to use the site's powerful search engine, to see other titles in other formats (HTML, facsimile PDF), or to make use of the hundreds of essays, educational aids, and study guides, please visit the OLL web site. This title is also part of the Portable Library of Liberty DVD which contains over 1,000 books and quotes about liberty and power, and is available free of charge upon request. The cuneiform inscription that appears in the logo and serves as a design element in all Liberty Fund books and web sites is the earliest-known written appearance of the word “freedom” (amagi), or “liberty.” It is taken from a clay document written about 2300 B.C. in the Sumerian city-state of Lagash, in present day Iraq. To find out more about Liberty Fund, Inc., or the Online Library of Liberty Project, please contact the Director at [email protected]. -

Le Signorie Dei Rossi Di Parma Tra XIV E XVI Secolo
Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo a cura di Letizia Arcangeli e Marco Gentile Firenze University Press 2007 Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo / a cura di Letizia Arcangeli e Marco Gentile. – Firenze : Firenze University Press, 2007. (Reti medievali E-book. Quaderni ; 6) ISBN (print) 978-88-8453- 683-9 ISBN (online) 978-88-8453- 684-6 945.44 © 2007 Firenze University Press Università degli Studi di Firenze Firenze University Press Borgo Albizi, 28 50122 Firenze, Italy http://epress.unifi.it/ Printed in Italy Indice Letizia Arcangeli e Marco Gentile, Premessa 7 Abbreviazioni 13 Gabriele Nori, «Nei ripostigli delle scanzie». L’archivio dei Rossi di San Secondo 15 Marco Gentile, La formazione del dominio dei Rossi tra XIV e XV secolo 23 Nadia Covini, Le condotte dei Rossi di Parma. Tra conflitti interstatali e «picciole guerre» locali (1447-1482) 57 Gianluca Battioni, Aspetti della politica ecclesiastica di Pier Maria Rossi 101 Francesco Somaini, Una storia spezzata: la carriera ecclesiastica di Bernardo Rossi tra il «piccolo Stato», la corte sforzesca, la curia romana e il «sistema degli Stati italiani» 109 Giuseppa Z. Zanichelli, La committenza dei Rossi: immagini di potere fra sacro e profano 187 Antonia Tissoni Benvenuti, Libri e letterati nelle piccole corti padane del Rinascimento. La corte di Pietro Maria Rossi 213 Letizia Arcangeli, Principi, homines e «partesani» nel ritorno dei Rossi 231 Indice onomastico e toponomastico 307 L. Arcangeli, M. Gentile (a cura di), Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo, ISBN (print) 978-88-8453- 683-9, ISBN (online) 978-88-8453- 684-6, © 2007 Firenze University Press. -

Niccolo Machiavelli
HISTORICAL, POLITICAL, AND DIPLOMATIC WRITINGS OF NICCOLO MACHIAVELLI TRANSLATED FROM THB ITALIAN BY CHRISTIAN E. DETMOLD IN FOUR VOLUMES VOL. I. BOSTON JAMES R. OSGOOD AND COMPANY I882 Copynghf, 1882, CHRISTIANE. DETMOLD. BY - All rights reserved. UNIVERSITYPRESS: JOHN WILSONAND SON, CAMBRIDGS. C 0 R RI G EN’D A. -----t VOLUMEI. Page 143, lines 9 and 10 from top, instead of “ state their wishes to the rioters,” read, “learn the wishes of the rioters.” VOLUME11. Page 52. ‘1 THE PRINCE?”chapter 16, 3d line, instead of the words, ‘1 indulged in so that you will no longer be feared, will prove injurious. For liberality worthily exercised, as it should he, will not be recognized,” read, ‘1 practised so that you are not repufed liberal, will injure you. For iibitralit’y worthily exercised, as it should he, will not be known ,’ ’ &c. * K0.m. * This erroneous translation resulted from a difference in the text of the Testine Edition (1550),which wah used by me in the translation of “The Prince.” Page 39, chap. 16, 2d and 3d lines, read “ Knndimnnco la liheralita usata in modo, ahe tu non sia tem~to,ti offeiitle.” It should be, ‘I che tu non sia tenato.” c. E. I). TRANSLATOR’S PREFACE. INoffering the present translation of Machiavelli’s principal historical, political, and diplomatic writings, my original object was simply to afford to the general reader the opportunity of judging for himself of the character of the man, and of those of his works upon which his reputation for good or for evil mainly depends. -
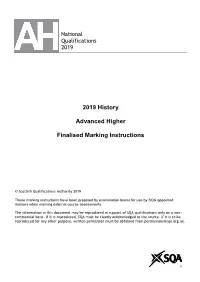
2019 History Advanced Higher Finalised Marking Instructions
National Qualifications 2019 2019 History Advanced Higher Finalised Marking Instructions © Scottish Qualifications Authority 2019 These marking instructions have been prepared by examination teams for use by SQA appointed markers when marking external course assessments. The information in this document may be reproduced in support of SQA qualifications only on a non- commercial basis. If it is reproduced, SQA must be clearly acknowledged as the source. If it is to be reproduced for any other purpose, written permission must be obtained from [email protected]. © General marking principles for Advanced Higher History This information is provided to help you understand the general principles you must apply when marking candidate responses to questions in this paper. These principles must be read in conjunction with the detailed marking instructions, which identify the key features required in candidate responses. (a) Marks for each candidate response must always be assigned in line with these general marking principles and the detailed marking instructions for this assessment. (b) Marking should always be positive. This means that, for each candidate response, marks are accumulated for the demonstration of relevant skills, knowledge and understanding, they are not deducted from a maximum on the basis of errors or omissions. (c) If a specific candidate response does not seem to be covered by either the principles or detailed marking instructions, and you are uncertain how to assess it, you must seek guidance from your team leader. (d) Marking must be consistent. Never make a hasty judgement on a response based on length, quality of hand writing or a confused start. -

A to Z of Renaissance Art by Lilian H
OTHER A TO Z GUIDES FROM THE SCARECROW PRESS, INC. 1. The A to Z of Buddhism by Charles S. Prebish, 2001. 2. The A to Z of Catholicism by William J. Collinge, 2001. 3. The A to Z of Hinduism by Bruce M. Sullivan, 2001. 4. The A to Z of Islam by Ludwig W. Adamec, 2002. 5. The A to Z of Slavery & Abolition by Martin A. Klein, 2002. 6. Terrorism: Assassins to Zealots by Sean Kendall Anderson and Stephen Sloan, 2003. 7. The A to Z of the Korean War by Paul M. Edwards, 2005. 8. The A to Z of the Cold War by Joseph Smith and Simon Davis, 2005. 9. The A to Z of the Vietnam War by Edwin E. Moise, 2005. 10. The A to Z of Science Fiction Literature by Brian Stableford, 2005. 11. The A to Z of the Holocaust by Jack R. Fischel, 2005. 12. The A to Z of Washington, D.C. by Robert Benedetto, Jane Dono- van, and Kathleen DuVall, 2005. 13. The A to Z of Taoism by Julian F. Pas, 2006. 14. The A to Z of the Renaissance by Charles G. Nauert, 2006. 15. The A to Z of Shinto by Stuart D. B. Picken, 2006. 16. The A to Z of Byzantium by John H. Rosser, 2006. 17. The A to Z of the Civil War by Terry L. Jones, 2006. 18. The A to Z of the Friends (Quakers) by Margery Post Abbott, Mary Ellen Chijioke, Pink Dandelion, and John William Oliver Jr., 2006 19. -
Il Passato Riscoperto Cap 04 Notizie Storiche 1400-1450
Il passato riscoperto CENNI SULLA STORIA DELLA CHIESA DI S. CALOCERO CAPITOLO 4 - IL 1400-1450 LE COMPAGNIE DI VENTURA- GLI SFORZA Dalla descrizione delle chiese di Galbiate LA CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA IN GALBIATE Nei frammenti pittorici (Sant'Antonio, Sant'Apollonia e altra Santa) ritrovati nel 1921 sulla facciata occidentale è riconoscibile la stessa mano di un pittore viandante operante nella prima metà del Quattrocento. Tale pittore è anche autore di Madonna col Bambino in trono affrescata sul pilastro della navata nella Chiesa di San Calocero a Civate e Madonna col Bambino in trono fra San Cristoforo e un altro Santo dipinto sulla parere sinistra della Chiesa di San Dionigi alla Rocca di Valmadrera. L'autore dell'affresco si è probabilmente avvalso dello stesso cartone per la Vergine, e, con leggere modifiche, per il Bambino; simile è la decorazione per il dossale del trono. Sulla contro facciata occidentale si incontra per prima l'immagine di Sant'Apollonia; il contrasto rispetto all'analoga figura dipinta sulla facciata è marcato: là l'incarnato è di un bel rosa acceso, qui il viso è di una tonalità grigio−cinerea; nell'altra figura la veste era di un rosso fiammante, qui l'abito è bianco, solo con profilature gialle. Assegnabile al tardo Trecento. La stessa tecnica con il volto dipinto a colore giallo−cinereo si trova in due Santi monaci affiancati. Madonna in trono con il Bambino e San Pietro è attribuibile al primo Quattrocento e per quanto presentianalogie con la Madonna in trono con il Bambino di San Calocero, è opera di un frescante di formazione culturale e tecnica non molto elevate. -

SFORZA Und ATTENDOLI (III)
Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848) 10.10.2012, 18.4.2015, 14.7.2018 SFORZA und ATTENDOLI (III) XII.5573 = XII.6197 = XIV.30663 Sforza dei Signori di Pesaro, Ginevra, * ca.1440 Ancona (natürliche Tochter, legitimiert), + 16.7.1503 in Bologna, oo (b) Bentivogli Giovanni (1443-1509); oo (a) 05.1464 Sante Bentivogli (1424-1463), Herr von Bologna. XIII./XV. Sforza Alessandro, * 29.10.1409 Cotignola (Naturale e legittimato, da Lucia Terziani [* Morsciano, + Milano 1461]), + 3.4.1473 Pesaro; oo (a) 1444 Costanza da Varano (1428- 1447), oo (b) 1448 Sveva di Montefeltro (1434-1478). Er war der mittlere der drei außerehelichen Söhne des Muzio Attendolo Sforza aus seiner Beziehung mit Lucia Terziani. Er wurde zunächst Gregorio getauft, wurde dann aber zu Ehren von Papst Alexander (V) umbenannt. Sein älterer Bruder war Francesco Sforza, seit 1450 Herzog von Mailand, sein jüngerer Bosio Sforza, Graf von San Fiora. Er war Condottieri im Dienst der Kirche, im Dienst seines Bruders Franceso und im Dienst des Königs von Neapel. Er war kirchlicher Vikar von Ancona seit dem Jahr 1434 und Gouverneur von Assisi seit dem Jahr 1439. Seit dem Jahr 1445 war er kirchlicher Vikar und Herr von Pesaro. Zudem war er Herzog von Sora, wobei er das Lehen sofort wieder verlor. Weiters war er Herr von Gradara und Castelnuova seit dem Jahr 1463. Er wurde auch Lieutenant des Königreichs von Neapel im Jahr 1463. XIV./XVI. Attendoli Muzio -

MALVEZZI (I-III) Inkl
Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848) 26.4.2012, 7.4.2016 MALVEZZI (I-III) inkl. ZENZIFABRI (II) VII.175 Malvezzi Camilla, ~ 11.1.1573, + post 16421; oo (contratto di dote a Bologna 27.11.1592, rog. dai notai Guidastri e Grati) 3.6.1593 Vitelli Nicolo (1571-1595). 14.1.1591 riceve dal testamento del nonno Lucio Malvezzi alcuni legati (rog. not. Cristoforo Guidastri); (post 1642) la sua eredita viene divisa fra Angiola Vitelli Legnani e Camilla Fantuzzi Spada2; quella eredita, fede in chi cantino i suoi beni3; prende in affitto beni del patrimonio Vitelli4; riporta quietanza dell'amministrazione dell' entrate alla casa dal marchese Chiappino suo figlio5; scritture diverse ad essa appartenenti6; venduti alla marchesa Girolama Bandini Vitelli, nuora: ricevute7; Ottavio Malvezzi debitore di scudi 6.000 alla marchesa Camilla Malvezzi Vitelli, che cede il credito al senatore Giovanni del cardinal Agnolo Niccolini8; (ante 1640) Chiappino di Niccolo Vitelli vende e dà in solutum beni per scudi 36.687 alla marchesa Cammilla Malvezzi sua madre 9. Lettera del 19.1.1636 di Camilla Malvezzi Vitelli a destinatario ignoto; Camilla, una delle 17 donne che fanno parte della Congregazione della Penitenza, domanda (probabilmente a un sacerdote) il permesso di allestire una via crucis dentro le mura della Congregazione stessa10; di una lettere „a sigillo volante“ di Camilla a Virgilio Spada parla ZARRI11. Promuovo ed eseguisce la traslazione del corpo del B. Giacomo alla Cappella Vitelli12. In uno di due voti dipinti dallo Sguazzino nella chiesa nell' sotterraneo della Cattedrale si legge: Trovandosi la Città di Bologna nell'anno 1630 miserabilmente oppressa dalla peste, Camilla Malvezzi Vitelli per la preservazione da quel contagio della famiglia de' Malvezzi fece voto al S.Florido13; P. -

Quaderni Del Borgoantico-17 Alla Scoperta Dell’Identità Storica Di Villa Lagarina
Quaderni del Borgoantico 17 2016 Quaderni del Borgoantico-17 alla scoperta dell’identità storica di Villa Lagarina 3 Quando la cultura si fa sentimento Giacomo Bonazza & Redazione 5 Antonia Marzani e la casa in Contrada Santa Maria a Trento Roberto Codroico 9 … Cento anni fa a Villa Lagarina… Giovanni Bezzi 39 Mille anni storia Paolo Cont 62 “… considerato di quanta importanza sii la cordiale fratellanza et unione ferma et stabile…” Antonio Passerini 72 Allegre brigate in gita a Castellano fra svaghi boscherecci e atmosfere galanti Liliana De Venuto 83 1966-2016 Cinquant’anni dall’ultima alluvione dell’Adige Sandro Aita 86 La famiglia Marzani di Pomarolo Robero Adami 94 Due divertenti sceneggiate di Giambattista Azzolini Francesco Laterza 99 Pari opportunità Lia Cinà 102 Poesie Lia Cinà 10 3 Guido Riolfatti, calzolaio (“calier”) per mestiere campione di “balonzina” e pittore per passione Sandro Giordani 106 Baldo Bruno una vita intensa e avventurosa dedicata al lavoro, alla solidarietà, allo sport e alla famiglia Sandro Giordani 113 Album fotografico a cura di Sandro Giordani Foto di copertina: Palazzo Madernini - Marzani, restauro Madonna col bambino Si coglie l’occasione per invitare le famiglie di Villa Lagarina e di Piazzo che possiedono documenti, fotografie e altro materiale di interesse storico a mettersi in contatto con l’Associazione Borgoantico (Sandro Giordani) in modo che gli stessi possano servire per ricostruire altri pezzi di storia del paese ed essere pubblicati sui prossimi numeri della rivista. Quaderni del Borgoantico -

Le Difficoltà Politiche E Finanziarie Degli Ultimi Anni Di Dominio
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by AIR Universita degli studi di Milano Le difficoltà politiche e finanziarie degli ultimi anni di dominio di Maria Nadia Covini Negli ultimi anni di dominio, e in particolare nei mesi che precedettero la morte di Filippo Maria Visconti, si intravvedono vari segnali di crisi politica e istituzionale. La famosa biografia del duca scritta dal segretario Pier Candido Decembrio si conclude con il tragico parallelismo tra la decadenza personale dell’anziano duca e la fine della dinastia, travolta dagli eventi1. Da tempo Fi- lippo Maria si era appartato e isolato nei suoi castelli, aveva perso il contatto con i sudditi, si era affidato a segretari e favoriti che erano diventati molto potenti. L’isolamento del principe contribuì ad aggravare le difficoltà politiche emerse negli anni Quaranta, anni di impegni bellici e di crescita abnorme dei bisogni finanziari2. A partire da una rassegna delle fonti esistenti che, come ben noto, sono scarse e residuali, analizziamo alcuni segni di crisi e di distan- ziamento tra istituzioni ducali e società. Abbreviazioni ASMi = Archivio di Stato di Milano. RV = I registri viscontei, a cura di C. Manaresi, Milano 1915. ACV, Decreti = Gli atti cancellereschi viscontei, I, Decreti e Carteggio interno, a cura di G. Vittani, Milano 1920. ACV, Carteggio extra dominium = Gli atti cancellereschi viscontei, II, Carteggio extra domi- nium, a cura di G. Vittani, Milano 1929. PFV, III = La politica finanziaria dei Visconti, a cura di C. Santoro, III, Milano 1983. Cengarle, Feudi e feudatari = Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. -

Archivio Sforzesco Avanti Il Principato
VS 3 Archivio di Stato di Milano ARCHIVIO SFORZESCO AVANTI IL PRINCIPATO Per la richiesta indicare: Fondo: Carteggio Visconteo - sforzesco Pezzo: Numero della busta Archivio Sforzesco avanti il Principato (1411 - 1450) Sezione Livello: 2 Altre denominazioni: Denominazione in GG II 926: Archivio Sforzesco avanti il Principato, noto anche come l'Archivio del conte Sforza Produttore fondo: Milano, Cancelleria ducale (sec. XV - sec. XVI) Codice: ASMI0500030 Consistenza: scatole 19 (in GG: 20 scatole); le scatole 34 e 35 sono accorpate Note alla data: In GG: 1441 - 1450; con lacune cronologiche Contenuto: Oltre alla corrispondenza fra il condottiero e il governo milanese, il carteggio privato e quello con altri stati italiani, si trovano notizie inerenti ai capitoli, alle convenzioni e agli accordi stipulati tra lo Sforza e le varie comunità locali del dominio Visconteo. Diversi atti riguardano esclusivamente la Repubblica Ambrosiana. La scatola 22 contiene documenti relativi a dazi e spese della città di Lodi. Nella seconda metà dell'Ottocento Luigi Osio pubblicò nei suoi "Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi" materiale proveniente dalle raccolte da lui formate per il Diplomatico, che venne poi ricollocato in questa sezione ad opera del Fumi nei primi anni del Novecento. Caterina Santoro ha utilizzato documentazione proveniente dalle scatole 26 e 27 per il terzo volume dei regesti riguardanti la politica finanziaria dei Visconti. Storia archivistica: Come spiega Luigi Fumi, "un numero rilevante di atti anteriori alla assunzione di Francesco Sforza a duca di Milano non avevano ancora una serie distinta. Sparsi, come e più dei Viscontei, nelle diverse parti dell'archivio, in maggior copia si trovarono sotto la serie detta degli Atti della Repubblica Ambrosiana. -

Lettere Sconosciute a Cosimo Dei Medici: Inventario E Regesto (Con Tre Inediti) *
Raffaella Maria Zaccaria Lettere sconosciute a Cosimo dei Medici: inventario e regesto (con tre inediti) * È stata recentemente recuperata dall’Archivio di Stato di Firenze una raccolta di 28 lettere –che porta la segnatura Acquisti e Doni 383-, rimaste finora sconosciute, indirizzate a Cosimo dei Medici1, comprese tra il 1434 e il 1440 -con la sola eccezione di una datata 1457-, già di proprietà dell’antiquario H. P. Kraus di New York. Le carte -descritte analiticamente nel Catalogo 204 della Libreria Kraus, al numero 1302- facevano parte di un ingente lotto di importanti documenti, manoscritti e stampe, dei secoli XV-XVIII, molti dei quali di area fiorentina, ma non solo, destinati ad un’asta che avrebbe dovuto tenersi a Londra nel corso del 19973. * Il testo di questo contributo è stato pubblicato su “Interpres”, XIX, 2000, pp.152-174 (poi in R. M. Zaccaria, Studi sulla trasmissione archivistica. Secoli XV-XVI, Lecce, Conte Editore, 2002, pp.47-71). 1 Su Cosimo dei Medici (1389-1464) mi limito a segnalare: F. C. Pellegrini, Sulla repubblica fiorentina al tempo di Cosimo il Vecchio, Pisa, Nistri, 1889; C. S. Gutkind, Cosimo de’ Medici, Pater Patriae. 1389-1464, Oxford, The Clarendon Press, 1938 (nuova edizione Firenze, Giunti-Martello, 1982); Un’altra Firenze. L’epoca di Cosimo il Vecchio: riscontri tra cultura e società nella storia fiorentina, Firenze, Vallecchi, 1971; A. Molho, Cosimo dei Medici: “Pater Patriae or Padrino” ?, in “Stanford Italian Review”, I, 1979, pp.5-33; Cosimo ‘Il Vecchio’ de’ Medici. 1389- 1464. Essays in Commemoration of the 600th Anniversary of Cosimo de’ Medici’s Birth, including papers delivered at the Society for Renaissance Studies Sexcentenary Symposium at the Warburg Institute, London, 19 May 1989, ed.