Übersetzung, Nachdichtung Oder Umdichtung?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

What's Wrong with the Study of China/Countries
Asian Studies II (XVIII), 1 (2014), pp. 151–185 What’s Wrong with the Study of China/Countries Hans KUIJPER* Abstract In this paper 1 the thesis is submitted that there is something fundamentally amiss in Western Sinology (Zhōngguóxué, as distinct from Hànxué, which is a kind of old- fashioned philology): ‘China experts’ either pretend to be knowledgeable about everything related to China, in which case they cannot be taken seriously, or–– eventually––admit not to be scientific all-rounders with respect to the country, in which case they cannot be called ‘China experts’. The author expects no tenured professor of Chinese Studies/History to share this view. Having exposed the weakness, indeed the scandal of old-style Sinology, he also points out the way junior Sinologists should go. The fork in that road is two-pronged: translating or collaborating. Keywords: Sinology, area/country studies, complexity, scientific collaboration, e-research Izvleček V tem članku avtor predstavi tezo, da je nekaj bistveno narobe v zahodni sinologiji (Zhōngguóxué, za razliko od Hànxué, ki je nekakšna staromodna filologija): »Kitajski strokovnjaki« se bodisi pretvarjajo, da so dobro obveščeni o vsem v zvezi s Kitajsko, in v tem primeru jih ni mogoče jemati resno, ali pa na koncu priznajo, da niso vsestransko znanstveni o državi, in jih v tem primeru ne moremo imenovati »Kitajske strokovnjake«. Avtor pričakuje, da nihče od univerzitetnih profesorjev kitajskih študij ali kitajske zgodovine ne deli tega stališča z njim. Z izpostavljenostjo šibkosti, kar je škandal za sinologijo starega sloga, opozarja tudi na pot, po kateri naj bi šli mladi sinologi. Na tej poti sta dve smeri, in sicer prevajanje ali sodelovanje. -

Hartmut Walravens (Hg.): Erwin Ritter Von Zach (1872�1942), Gesammelte Rezen- Sionen: Chinesische Geschichte, Religion Und Philosophie in Der Kritik
278 Viatcheslav Vetrov Hartmut Walravens (Hg.): Erwin Ritter von Zach (18721942), Gesammelte Rezen- sionen: Chinesische Geschichte, Religion und Philosophie in der Kritik. (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zu Berlin; 22). Wiesbaden: Harrassowitz, 2005. 170 S. Hartmut Walravens (Hg.): Erwin Ritter von Zach (18721942), Gesammelte Rezen- sionen: Chinesische Sprache und Literatur in der Kritik. (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zu Berlin; 26). Wiesbaden: Harrassowitz, 2006. 200 S. Viatcheslav Vetrov Das Werk und Schicksal des Sinologen Erwin Ritter von Zach (18721942), eines der „wenigen ganz Großen seines Faches“,1 ist jedem an der chinesischen Klassik interessierten Wissenschaftler wohl bekannt. Von seiner Größe und Anziehungs- kraft zeugen allein schon die zahlreichen ihm gewidmeten Publikationen, die in den letzten siebzig Jahren entstanden sind.2 Von Zachs Arbeiten werden meistens gelobt und energisch weiterempfohlen, manchmal aber auch vehement kritisiert. Das Urteil ist stets mit einer bestimmten Haltung zu seiner Persönlichkeit verbunden. Während Alfred Hoffmann und Zoltán Károlyi im Jahr 1963 den Fleiß und die Schaffenskraft hervorhoben, wodurch von Zach „eine ungeahnte Fülle dichterischen Denkens und Fühlens der Chinesen erschlossen“ habe, den Mut dieses Mannes angesichts des tragischen Todes auf dem torpedierten Schiff Van Imhoff bewunderten sowie Zeug- nisse von Bekannten und Freunden heranzogen, die von Zach als „immer gütig und charmant, liebenswürdig, großzügig und edel gegen jedermann“ charakterisieren (S. 3, 6), schreibt Monika Motsch gut vierzig Jahre später einen Aufsatz zu von Zach als Übersetzer, in welchem sie ihr Unverständnis darüber äußert, wieso sich ein Mann, der ihrer Meinung nach nicht künstlerisch genug veranlagt war, der Übersetzung von Dichtern und nicht der Philosophie oder Geschichte gewidmet hatte.3 Die von ihr selbst gestellte Frage: „What kind of man was Erwin Ritter von Zach and what were his ideas about translation?“ (S. -
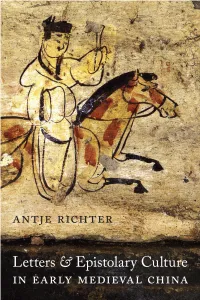
2013 Uwpr. Intro.Pdf
Letters and Epistolary Culture in Early Medieval China Antje Richter University of Washington Press Not for Distribution A China Program Book university of washington press Seattle and London this book is made possible by a collaborative grant from the andrew w. mellon foundation. This book was supported in part by the China Studies Program, a division of the Henry M. Jackson School of International Studies at the University of Washington. Press © 2013 by the University of Washington Press 17 16 15 14 13 5 4 3 2 1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, Washingtonincluding photocopy, recording, or any information storage or retrieval system, without permissionof in writingDistribution from the publisher. for University of Washington Press PO Box 50096, Seattle, WA 98145, USA www.washington.edu/uwpress Not Library of CongressUniversity Cataloging-in-Publication Data Richter, Antje. Letters and epistolary culture in early medieval China / Antje Richter. pages cm “A China Program book.” Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-295-99277-8 (hardback : alk. paper) ISBN 978-0-295-99278-5 (pbk. : alk. paper) 1. Letter writing, Chinese. 2. Chinese letters—History and criticism. 3. Chinese literature—220–589—History and criticism. I. Title. PL2400.R53 2013 808.6’0951—dc23 2012046994 The paper used in this publication is acid-free and meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences— Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48–1984.∞ What’s your guess? Can I still get a letter by Sunday? It should be possible. -

(Shijing): on “Filling out the Missing Odes” by Shu Xi
Righting, Riting, and Rewriting the Book of Odes (Shijing): On “Filling out the Missing Odes” by Shu Xi Thomas J. MAZANEC University of California, Santa Barbara1 A series of derivative verses from the late-third century has pride of place in one of the foundational collections of Chinese poetry. These verses, “Filling out the Missing Odes” by Shu Xi, can be found at the beginning of the lyric-poetry (shi 詩) section of the Wenxuan. This essay seeks to understand why such blatantly imitative pieces may have been held in such high regard. It examines how Shu Xi’s poems function in relation to the Book of Odes, especially their use of quotation, allusion, and other intertextual strategies. Rather than imitate, borrow, or forge, the “Missing Odes” seek to bring the idealized world of the Odes into reality by reconstructing canonical rites with cosmic implications. In so doing, they represent one person’s attempt to stabilize the chaotic political center of the Western Jin in the last decade of the third century. The “Missing Odes” reveal that writing, rewriting, ritualizing, and anthologizing are at the heart of early medieval Chinese ideas of cultural legitimation. Introduction If one were to open the Wenxuan 文選, the foundational sixth-century anthology compiled by Crown Prince Xiao Tong 蕭統 (501–531), and turn to the section on shi- poetry 詩 in hopes of understanding early medieval lyricism, the first pages would present one with a curious series of six poems, different in style and tone from the more famous works that follow. This set of tetrametric verses by Shu Xi 束皙 (ca. -

Schriftsteller, Redakteur, Philologe Bibliographie : Autor 1904 Zabel, Eugen
Report Title - p. 1 of 707 Report Title Zabel, Eugen (Königsberg, Ostpreussen 1851-1924 Berlin) : Schriftsteller, Redakteur, Philologe Bibliographie : Autor 1904 Zabel, Eugen. Auf der sibirischen Bahn nach China. (Berlin : Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur, 1904). https://archive.org/stream/aufdersibirisch00zabegoog#page/n9/mode/2up. [WC] Zabel, Rudolf = Zabel, Carl Hugo Rudolf (Wollin, Sachsen 1876-1939 Berlin) : Journalist Vossische Zeitung, Ostaiatischer Lloy Shanghai, Schriftsteller, Forschungsreisender Bibliographie : Autor 1902 Zabel, Rudolf. Deutschland in China. (Leipzig : G. Wigand, 1902). [WC] 1902 Zabel, Rudolf. Die deutsche China-Expedition von 1897. (Leipzig : G. Wigand, 1902) = (Bremen : Europäischer Hochschul-Verlag, 2011). [WC] 1902 Zabel, Rudolf. Durch die Mandschurei und Sibirien : Reisen und Studien. Mit 146 Abbildungen, zumeist nach photographischen Aufnahmen des Verfassers, teilweise gezeichnet von C. Arriens, und dem Portät des Verfassers. (Leipzig : G. Wigand, 1902). Zach, Erwin von = Zach, Erwin Ritter von (Wien 1872-1942 westlich von Sumatra, auf dem Weg nach Ceylon, als das Schiff durch Japan torpediert wird) : Diplomat, Sinologe Biographie 1890-1895 Erwin von Zach studiert Medizin und Naturwissenschaften an der Universität Wien. Nebenbei beschäftigt er sich mit Mathematik und Chinesisch. [Umas,Wal 8] 1895-1897 Erwin von Zach studiert Chinesisch, Tibetisch und Mandschu an der Universität Leiden. [Umas] 1897 Erwin von Zach geht nach London um das Qualifikations-Examen für den Dienst der Chinese Imperial Maritime Customs in Beijing zu erlangen. [Leh,Umas] 1897-1900 Erwin von Zach ist im Dienst der Chinese Imperial Maritime Customs, zuerst in Beijing dann in Shantou (Jiangxi). [Leh,Wal 8] 1900-1902 Erwin von Zach ist Dolmetscher am österreichisch-ungarischen Konsulat in Beijing. [Hof,Wal 8] 1902 Erwin von Zach wird Konsularattaché am österreichisch-ungarischen Konsulat in Beijing. -

The Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai : Ancient-Style Poems
The Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai Ancient-Style Poems (koshi) and Regulated Verse (risshi) John Timothy WIXTED, Harbert, Michigan ‘Matching-rhyme’ 次韻 (jiin) poetry is poetry in Chinese or Sino-Japanese that uses the exact same rhyme words, in the exact same order, as those of an earlier poem. For the purposes of this study, the term includes reference to the ‘original’ composition that served as the model for the matching poem, whether it was intended to be used as a model or not.1 This article treats the ‘ancient-style poems’ 古詩 (koshi, gŭshī) and ‘regu- lated verse’ 律詩 (risshi, lǜshī) written when Mori Ōgai participated in the following: Matching-Rhyme Exchange: Ōgai Matching Ōgai (as part of a debate with Imai Takeo 今井武夫) 69 Matching-Rhyme Exchange with Hayakawa Kyōjirō 早川恭次郎 87 Matching-Rhyme Exchange with Noguchi Neisai 野口寧齋 109 Matching-Rhyme Exchange with Yu Shufen 俞樹棻 117 The kanshi Ōgai wrote in the debate with Imai Takeo (fl. 1889) are ancient- style poems. The rest of the above are in regulated verse. An additional match- 1 This article has been preceded by its pair, “The Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai: Quatrains (zekku),” JH 16 (2013): 109–68. For background to both, see John Timothy WIXTED: “Sociability in Poetry: An Introduction to the Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai,” in Ôgai – Mori Rintarô: Begegnungen mit dem japanischen homme de lettres, Klaus KRACHT, ed., Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2014: 189–217. The three are referred to col- lectively as ‘this study.’ In the last-mentioned article, note should have been made of the criticism of matching-rhyme poetry voiced by the important poet-critic, Yuan Haowen 元 好問; for extended treatment, see idem: Poems on Poetry: Literary Criticism by Yuan Hao- wen (1190–1257), Calligraphy by Eugenia Y. -
Vasilii Mikhailovich Alekseev and Russian Sinology
T’OUNG PAO T’oung Pao 97 (2011) 344-370 www.brill.nl/tpao Vasilii Mikhailovich Alekseev and Russian Sinology Christoph Harbsmeier* (University of Oslo) Vasilii Mikhai lovich Alekseev1 (1881-1951) is best known to readers of French and English through his by now curiously outdated but refreshingly thoughtful discussion of the underlying principles of Chi- nese literature, La littérature chinoise: six conférences au Collège de France et au Musée Guimet .2 e first few dozen pages of that book are among the weakest that I have seen from Alekseev’s pen. Its merits lie in the persistence with which he asks fundamental questions such as what exactly should count as Chinese literature and why its global status is what it is and should be what it should be. He asks squarely why Chi- nese poetry, rich and abundant as it was, has never had much formative impact on the West. But in this context he does not mention what he could not know: that apparently more than a million copies of his own * I would like to thank Michael Heim of the University of California, Los Angeles, for his generous help with this article. I have written the present essay—originally designed as a review article of the recently published Rabochaia bibliografiia kitaista. Kniga ruko- vodstvo dlia izuchaiushchikh iazyk i kul’turu Kitaia (see below), but then much expanded— on the basis of my personal collection of Alekseev’s books. I do not own, and have so far had no access to, the following collections of essays: Literatura i kultura Kitaia. -

Asian Studies Modern Confucianism and Chinese
ASIAN STUDIES MODERN CONFUCIANISM AND CHINESE MODERNITY Volume II (XVIII), Issue 1 Ljubljana, May 2014 ASIAN STUDIES, Volume II (XVIII), Issue 1, Ljubljana, May 2014 Editor-in-chief: Jana S. Rošker Editor of the issue: Jana S. Rošker Assistant and managing editor: Nataša Visočnik Proof reader: Chikako Shigemori Bučar Editorial Board: Raoul David Findeisen, Nataša Vampelj Suhadolnik, Beatrix Mesce, Mingchang Lin, Tamae K. Prindle, Ana Jelnikar, Nataša Visočnik, Yuriko Sunakawa, Tamara Ditrich, Bart Dessein, Mitja Sje, Jeff Kingstone, Geir Sigurðsson, Ivana Buljan, Andrej Ule, Shaun Richard O’Dwyer, Mislav Ježić, Zouli Wang, Jana S. Rošker, Mark James Hudson All articles are double blind peer-reviewed. The journal is accessable online in Open Journal System data base: http://revije.ff.uni-lj.si/as. The editors of this anthology would like to thank the Chiang Ching-kuo Foundation for the publication support. © University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2014. All rights reserved. Published by: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani/Ljubljana University Press, Faculty of Arts, University of Ljubljana For: Oddelek za azijske in afriške študije/Department of Asian and African Studies For the publisher: Branka Kalenić Ramšak, Dean of Faculty of Arts Ljubljana, 2014, First edition Number printed: 200 copies Graphic Design: Janez Mlakar Printed by: Birografika Bori, d. o. o. Price: 7,00 EUR ISSN 2232-5131 This publication is indexed in the Cobiss database. This journal is published three times per year. Yearly subscription: 18 EUR, (Account No.: 50100-603-40227) Ref. No.: 001-033 ref. »Za revijo« Adress: Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386 (0)1 24 11 450, +386 (0)24 11 444 faks: +386 (0)1 42 59 337 This journal is published with the support of the Slovenian Research Agency (ARRS). -

Zur Geschichte Der Sinologie Im Deutschsprachigen Raum Von Hartmut Walravens
Zur Geschichte der Sinologie im deutschsprachigen Raum von Hartmut Walravens Bei der Gründung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 1845 waren zwei Vertreter der Sinologie und Zentralasienwissenschaften beteiligt, Carl Friedrich Neumann und Hans Conon von der Gabelentz, die in der Folge auch in der Zeitschrift der Gesellschaft publizierten, wie sie auch bereits bei der Vorgängerin, der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Pate gestanden hatten. In der Folge entwickelte sich die Sinologie zu einer bedeutenden Sektion innerhalb der DMG, wenn auch mit einem Zeitverzug gegenüber den älteren etablierten Fächern. Hier sind besonders die Namen Erich Haenisch, Werner Eichhorn, Wolfgang Bauer, Günther Debon und Herbert Franke, der 1965 bis 1971 1. Vorsitzender der DMG war, zu nennen. So wird im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung des Faches gegeben, wobei es manche Berührungspunkte mit der DMG gibt, auch wenn sie aus Raumgründen nicht detailliert angesprochen sind. Nach der Entdeckung des Seewegs nach Ostasien bildeten sich im 17. und 18. Jahrhundert die Anfänge einer Chinawissenschaft heraus, die heute vielfach Protosinologie genannt wird. Obwohl Deutschland wenig direkten Kontakt zu China hatte, gab es doch eine intensive Beschäftigung insbesondere mit der chinesischen Sprache und Schrift sowie der chinesischen Geschichte. Ein Beitrag des Tiroler Jesuitenmissionars MARTIN MARTINI S.J. (1614–1661, aus Trient) ist hier von großer Bedeutung – er übersetzte nämlich eine chinesische Darstellung zur chinesischen Frühgeschichte, Sinicae historiae decas prima (Monachii 1658), eigentlich gedacht als Hintergrundmaterial zu seinem hervorragenden Novus Atlas sinensis (Amsterdam 1655). Diese den Originaltexten entsprechende recht trockene Präsentation erregte in Europa Aufsehen, denn ein Teil der beschriebenen Ereignisse schien sich vor dem nach der Bibel berechneten Datum der Sintflut abgespielt zu haben. -

The Manchu-Language Archives of the Qing Dynasty and the Origins of the Palace Memorial System
The Manchu-Language Archives of the Qing Dynasty and the Origins of the Palace Memorial System Elliott, Mark C. Late Imperial China, Volume 22, Number 1, June 2001, pp. 1-70 (Article) Published by The Johns Hopkins University Press DOI: 10.1353/late.2001.0002 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/late/summary/v022/22.1elliott.html Access Provided by Harvard University at 08/17/12 2:39PM GMT Manchu-Language Archives 1 THE MANCHU-LANGUAGE ARCHIVES OF THE QING DYNASTY AND THE ORIGINS OF THE PALACE MEMORIAL SYSTEM Mark C. Elliott One of the more noteworthy recent trends in scholarship on late imperial Chinese and Inner Asian history is the growing recognition of the importance of Manchu as a research language. This change owes principally to two de- velopments. One is the opening, beginning in the late 1970s, of the First His- torical Archives of China (FHA) to general scholarly use. This liberalization inaugurated an ongoing process of discovery that has enabled historians to gain a first-hand familiarity with the variety and nature of the more than 10,000,000 items on deposit there, most of which are from the Qing period (1636–1912).1 Fuller information has emerged concerning that portion of the Qing archives not in the Chinese script—meaning primarily, though not ex- clusively, materials in Manchu—which puts us in a better position to appreci- ate the significance of these sources. In consequence, opinion has shifted away from the old view that Manchu materials are of little relevance for Qing his- tory after 1644,2 toward the view that documents written in a language so 1 Research for this article was made possible by grants from the Committee on Scholarly Communica- tion with China, the American Council of Learned Societies/Social Science Research Council, and the Japan Society for the Promotion of Science. -

The Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai : Quatrains (Zekku)
The Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai Quatrains (zekku) John Timothy WIXTED, Harbert, Michigan ‘Matching-rhyme’ 次韻 (jiin) poetry is poetry in Chinese or Sino-Japanese that uses the exact same rhyme words, in the exact same order, as those of an earlier poem. For the purposes of this study, the term includes reference to the ‘original’ composition that served as the model for the matching poem, whether it was intended to be used as a model or not.1 This article treats the ‘quatrains’ 絕句 (zekku, juéjù) that were written when Mori Ōgai participated in the following: Matching-Rhyme Exchange with Ishiguro Tadanori 石黒忠悳 113 Matching-Rhyme Exchange over an Unsigned Newspaper Critique 137 Matching-Rhyme Exchange with Ichimura Sanjirō 市村瓚次郎 142 Matching-Rhyme Exchange with Jinbo Tōjirō 神保濤次郎 145 Matching-Rhyme Exchange with Su Shoushan 宿壽山 149 Matching-Rhyme Exchange with the Taishō Emperor 大正天皇 157 Matching-Rhyme Exchange with Araki Torasaburō 荒木寅三郎 160 All ‘quatrains’ (zekku) are composed of four lines, and the lines are normally seven or five characters each. The poems treated below are all seven-character zekku (except for one five-character one). Hence they are twenty-eight kanji in length. The term zekku is used to refer to the poetic genre that came to maturity in China in the second half of the seventh century. There had been four-line poems in earlier centuries that did not follow the genre’s prescribed 1 The article is to be followed by its pair, “The Matching-Rhyme Kanshi of Mori Ōgai: An- cient-Style Poems (koshi) and Regulated Verse (risshi)” [古詩 and 律詩], forthcoming in JH. -

Report Title - P
Report Title - p. 1 of 282 Report Title A birthday book for Brother Stone : for David Hawkes, at eighty. Ed. by Rachel May and John Minford. (Hong Kong : Chinese University Press, 2003). A brief biography of his emincence Ignatius Cardinal Kung Pin-Mei : hppt://www.cardinalkungfoundation.org/biography/. A brief chronology of Chinese Canadian history : https://www.sfu.ca/chinese-canadian-history/chart_en.html. A brief history of Chinese immigration to America : http://www.ailf.org/awards/ahp_0001_essay01.htm. A brief history of Sino-Norwegian diplomatic relations. http://www.norway.cn/News_and_events/Bilateral-cooperation/History/history/#.VVw_vEY72So. A century of travels in China : critical essays on travel writing from the 1840s to the 1940s. Ed. by Douglas Kerr and Julia Kuehn. (Hong Kong : Hong Kong University Press, 2007). www.oapen.org/download?type=document&docid=448539. [AOI] A life journey to the East : sinological studes in memory of Giuliano Bertuccioli (1923-2001). Ed. by Antonino Forte and Federico Masini. (Kyoto : Scuola italiana di studi sull'Asia orientale, 2002). (Essays / Italien School of East Asian Studies ; vol. 2). [WC] A long history of China-Sweden relationship. http://en.people.cn/90001/90776/90883/7001796.html. A mes frères du village de garnison : anthologie de nouvelles taiwanaises contemporaines. Choisis et éd. par Angel Pino et Isabelle Rabut ; traduit du chinois par Olivier Bialais [et al.]. (Paris : Bleu de Chine, 2001). [KVK] A modern buddhist bible : essential readings from East and West. Ed. by Donald S. Lopez. (Boston : Beacon Press, 2002). = Modern buddhism : readings for the unenlightened. Ed. by Donald S. Lopez. (London : Penguin, 2002).