Berlin 1957-1994
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Newsletter of the Royal Pioneer Corps Association MAY 2008
ThePioneerThe Newsletter of the Royal Pioneer Corps Association MAY 2008 www.royalpioneercorps.co.uk A PROUD RETURN Good turnout as Bicester Town welcomes home the regiment ThePioneer e are currently preparing for this year's he following is a message from Brigadier CB Reunion Weekend which, once again, will Telfer CBE, Chairman of the RPC Association... W coincide with 23 Pnr Regt's Open Day. A T It is time for me to stand down as your booking form for the weekend is attached, Chairman and to pass the baton to my successor. accommodation will be granted on a first come By the time you read this that will have been done. first served basis. During these last few years we have Also attached are the usual draw tickets for the undertaken significant changes to the way in Derby Draw, please give this your support as it which we do business as an Association. The helps to fund Association functions. However, if merging of our resources with the other you find that you are unable to sell these tickets Associations within the RLC has been completed and do not wish to purchase them yourself with the result that systems and staffing support please let me know and future tickets will not be are now in place which will ensure that our sent to you. affairs will be efficiently managed for the future. Front Cover The last ‘extended’ Newsletter was very well The way in which benevolent needs are met CO 23 Pioneer Regiment RLC received especially the complete book ”It don't and the way in which members can keep in leads the Regiment through cost you a Penny”, the complementary messages touch through Association events is as well Bicester town centre were appreciated. -

Who Were the Prusai ?
WHO WERE THE PRUSAI ? So far science has not been able to provide answers to this question, but it does not mean that we should not begin to put forward hypotheses and give rise to a constructive resolution of this puzzle. Great help in determining the ethnic origin of Prusai people comes from a new branch of science - genetics. Heraldically known descendants of the Prusai, and persons unaware of their Prusai ethnic roots, were subject to the genetic test, thus provided a knowledge of the genetics of their people. In conjunction with the historical knowledge, this enabled to be made a conclusive finding and indicated the territory that was inhabited by them. The number of tests must be made in much greater number in order to eliminate errors. Archaeological research and its findings also help to solve this question, make our knowledge complemented and compared with other regions in order to gain knowledge of Prusia, where they came from and who they were. Prusian people provinces POMESANIA and POGESANIA The genetic test done by persons with their Pomesanian origin provided results indicating the Haplogroup R1b1b2a1b and described as the Atlantic Group or Italo-Celtic. The largest number of the people from this group, today found between the Irish and Scottish Celts. Genetic age of this haplogroup is older than that of the Celt’s genetics, therefore also defined as a proto Celtic. 1 The Pomerania, Poland’s Baltic coast, was inhabited by Gothic people called Gothiscanza. Their chronicler Cassiodor tells that they were there from 1940 year B.C. Around the IV century A.D. -

Grubbing out the Führerbunker: Ruination, Demolition and Berlin's Difficult Subterranean Heritage
Grubbing out the Führerbunker: Ruination, demolition and Berlin’s difficult subterranean heritage BENNETT, Luke <http://orcid.org/0000-0001-6416-3755> Available from Sheffield Hallam University Research Archive (SHURA) at: http://shura.shu.ac.uk/24085/ This document is the author deposited version. You are advised to consult the publisher's version if you wish to cite from it. Published version BENNETT, Luke (2019). Grubbing out the Führerbunker: Ruination, demolition and Berlin’s difficult subterranean heritage. Geographia Polonica, 92 (1). Copyright and re-use policy See http://shura.shu.ac.uk/information.html Sheffield Hallam University Research Archive http://shura.shu.ac.uk Grubbing out the Führerbunker: Ruination, demolition and Berlin’s difficult subterranean heritage Luke Bennett Reader in Space, Place & Law, Department of the Natural & Built Environment, Sheffield Hallam University, Norfolk 306, Howard St, Sheffield, S1 1WB, United Kingdom. [email protected] Abstract This article presents a case study examining the slow-death of the Berlin Führerbunker since 1945. Its seventy year longitudinal perspective shows how processes of ruination, demolition and urban renewal in central Berlin have been affected by materially and politically awkward relict Nazi subterranean structures. Despite now being a buried pile of rubble, the Führerbunker’s continued resonance is shown to be the product of a heterogeneous range of influences, spanning wartime concrete bunkers’ formidable material resistance, their affective affordances and evolving cultural attitudes towards ruins, demolition, memory, memorialisation, tourism and real estate in the German capital. Keywords Ruin – Demolition – Bunkers – Subterranean – Berlin – Nazism – Heritage – Materiality 1 On 30th April 1945 Adolf Hitler committed suicide in the Führerbunker, a reinforced concrete structure buried 8.5 metres beneath the ministerial gardens flanking the Reich Chancellery in central Berlin. -

Nicolaus Copernicus Immanuel Kant
NICOLAUS COPERNICUS IMMANUEL KANT The book was published as part of the project: “Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland” in the part of the activity concerning the publishing of the book “On the Trail of Outstanding Historic Personages. Nicolaus Copernicus – Immanuel Kant” 2 Jerzy Sikorski • Janusz Jasiński ON THE TRAIL OF OUTSTANDING HISTORIC PERSONAGES NICOLAUS COPERNICUS IMMANUEL KANT TWO OF THE GREATEST FIGURES OF SCIENCE ON ONCE PRUSSIAN LANDS “ElSet” Publishing Studio, Olsztyn 2020 PREFACE The area of former Prussian lands, covering the southern coastal strip of the Baltic between the lower Vistula and the lower Nemunas is an extremely complicated region full of turmoil and historical twists. The beginning of its history goes back to the times when Prussian tribes belonging to the Balts lived here. Attempts to Christianize and colonize these lands, and finally their conquest by the Teutonic Order are a clear beginning of their historical fate and changing In 1525, when the Great Master relations between the Kingdom of Poland, the State of the Teutonic Order and of the Teutonic Order, Albrecht Lithuania. The influence of the Polish Crown, Royal Prussia and Warmia on the Hohenzollern, paid homage to the one hand, and on the other hand, further state transformations beginning with Polish King, Sigismund I the Old, former Teutonic state became a Polish the Teutonic Order, through Royal Prussia, dependent and independent from fief and was named Ducal Prussia. the Commonwealth, until the times of East Prussia of the mid 20th century – is The borders of the Polish Crown since the times of theTeutonic state were a melting pot of events, wars and social transformations, as well as economic only changed as a result of subsequent and cultural changes, whose continuity was interrupted as a result of decisions partitions of Poland in 1772, 1793, madeafter the end of World War II. -

Wire April 2013
THE wire April 2013 www.royalsignals.mod.uk The Magazine of The Royal Corps of Signals We are proud to inform you of the new Armed Forces Hindu Network The centre point for all Hindu activities across MoD Its purpose is to: • Inform members of development in the wider Armed Forces. • Provide an inclusive platform for discussions and meetings for serving Hindus. • Keep the Hindu community in the Armed Forces, including civilian sta, informed on: - Cultural & Spiritual matters and events. - Seminars with external speakers. (Membership is free) For further information, please contact: Captain P Patel RAMC (Chairman) Email: [email protected] Mobile: 07914 06665 / 01252 348308 Flight Lieutenant V Mungroo RAF (Dep Chair) Deputy Chairman Email: [email protected] WO1 AK Chauhan MBE (Media & Comms) Email: [email protected] Mobile: 07919 210525 / 01252 348 308 FEBRUARY 2013 Vol. 67 No: 2 The Magazine of the Royal Corps of Signals Established in 1920 Find us on The Wire Published bi-monthly Annual subscription £12.00 plus postage Editor: Mr Keith Pritchard Editor Deputy Editor: Ms J Burke Mr Keith Pritchard Tel: 01258 482817 All correspondence and material for publication in The Wire should be addressed to: The Wire, RHQ Royal Signals, Blandford Camp, Blandford Forum, Dorset, DT11 8RH Email: [email protected] Contributors Deadline for The Wire : 15th February for publication in the April. 15th April for publication in the June. 15th June for publication in the August. 15th August for publication in the October. 15th October for publication in the December. Accounts / Subscriptions 10th December for publication in the February. -

BAOR July 1989
BAOR ORDER OF BATTLE JULY 1989 “But Pardon, and Gentles all, The flat unraised spirits that have dared On this unworthy scaffold to bring forth So great an object….” Chorus, Henry V Act 1, Prologue This document began over five years ago from my frustration in the lack of information (or just plain wrong information) regarding the British Army of The Rhine in general and the late Cold War in particular. The more I researched through books, correspondence, and through direct questions to several “Old & Bold” on Regimental Association Forums, the more I became determined to fill in this gap. The results are what you see in the following pages. Before I begin a list of acknowledgements let me recognize my two co-authors, for this is as much their work as well as mine. “PM” was instrumental in sharing his research on the support Corps, did countless hours of legwork, and never failed to dig up information on some of my arcane questions. “John” made me “THINK” British Army! He has been an inspiration; a large part of this work would have not been possible without him. He added the maps and the color formation signs, as well as reformatting the whole document. I can only humbly say that these two gentlemen deserve any and all accolades as a result of this document. Though we have put much work into this document it is far from finished. Anyone who would like to contribute information of their time in BAOR or sources please contact me at [email protected]. The document will be updated with new information periodically. -

Interesting Facts About Berlin
Interesting facts about Berlin Whether sightseeing or the alternative scene, galleries or gourmet restaurants, music or fashion – the German capital is never short of new experiences. The legendary nightlife, the attractive and unusual shopping opportunities but also its unique history attract more and more visitors from inside Germany and further afield. Last year almost 11 million people visited Berlin. But what actually makes Berlin so attractive? Its diversity, opposites and the infinite opportunities that thrill visitors from all over the world. Did you know that... ... with an area of 892 square kilometres, Berlin is nine times bigger than Paris? ... Berlin’s city limit is approximately 234 kilometres long? The length from East-West is 45 kilometres (as the crow flies) and from North-South 38 kilometres (as the crow flies). ... Berlin has the same geographic East-West width as London and the same geographic North-South length as Naples? ... the total length of the bus lines in the German capital is over 1,675 kilometres? The tram network covers more than 295 kilometres: add to this the S-Bahn network at 330 kilometres in length and the U-Bahn network at approximately 145 kilometres. ... with the new Berlin Hauptbahnhof (Central Station), the city has become a proper central rail hub for the first time in its history - and the largest in Europe? ... the first set of traffic lights in Europe was put into service in Potsdamer Platz in 1924? A replica of the lights can still be admired there today. ... to date six US presidents have made historic speeches here since the war? Who can forget John F. -
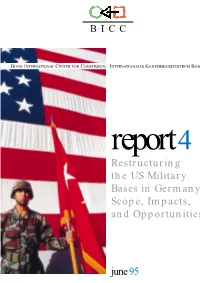
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options. -

Besprechungen Und Anzeigen 453 Das Litauische Recht Nach Der
Besprechungen und Anzeigen 453 das litauische Recht nach der Eroberung des größten Teils der Kiever Rus’ durch das li- tauische Großfürstentum beeinflusst hatte, lässt sich kaum als „ausländisch“ bezeichnen. Es ließen sich noch mehr Beispiele anführen. So wirken die nachgezeichneten Einflüsse zumindest für die ältere Privatrechtsgeschichte anachronistisch. Der Vf. kommt immerhin seiner Aufgabe, die wichtigsten Daten der allgemeinen politi- schen Geschichte, der äußeren Rechtsgeschichte und der ausgewählten Beispiele aus den früheren Forschungen zu den zivilrechtlichen Quellen aus der baltischen Region zusam- menzuführen, relativ fleißig nach. Für einen Einstieg in das Thema und als eine zusam- menfassende Erläuterung älterer Forschungen nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch, Polnisch, Weißrussisch und Litauisch ist das Buch gut brauchbar. Tartu Marju Luts-Sootak Pietro Umberto Dini: Aliletoescvr. Linguistica baltica delle origini. Teorie e contesti linguistici nel Cinquecento. Books & Company. Livorno 2010. 844 S. ISBN 978-88-7997- 115-7. (€ 50,–.) This volume by the Italian Baltist Pietro Umberto D i n i reveals new horizons not only in the studies of Baltic languages, but also in the spread of humanist ideas in the culture of the Baltic region. The monograph is appealing and relevant for scholars of various fields of human sciences. This recent work has an intriguing title and extends over an imposing number of pages. The large size of this book meets the eye, as well as the research mentioned in the intro- duction at the Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen and the W. F. Bessel Award of the Alexander von Humboldt-Stiftung, which undoubtedly contributed to the preparation of this monograph. -

Berlin Divided Berlin United
COMPANION GUIDE BEGLEITBUCH BERLIN DIVIDED BERLIN GETEILT BERLIN UNITED BERLIN VEREINT Copyright © 2019 Bibi LeBlanc Culture To Color, LLC All Rights Reserved No part of this book may be used or reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of the author. First Edition Cover Design & Interior by Bibi LeBlanc CultureToColor.com To Order in Bulk Contact Publisher: CultureToColor.com For more information visit: CultureToColor.com COMPANION GUIDE Discover the sights of Berlin with the photography and links to background information for destinations, people, and events. BEGLEITBUCH Entdecken Sie die Sehenswürdigkeiten Berlins mit Fotografien und Links zu Hintergrundinformationen der Orte, Persönlichkeiten und Ereignisse. WELCOME TO BERLIN WILLKOMMEN IN BERLIN GETEILTES DEUTSCHLAND GERMANY DIVIDED KAISER WILHELM MEMORIAL CHURCH PHOTO CREDIT: Bibi LeBlanc Photography RESOURCES: https://www.visitberlin.de/en/kaiser-wilhelm- memorial-church SIEGESSÄULE VICTORY COLUMN PHOTO CREDIT: Bibi LeBlanc Photography RESOURCES: https://www.berlin.de/en/attractions-and- sights/3560160-3104052-victory-column.en.html - BERLINER MAUER BERLIN WALL PHOTO CREDIT: LEFT: Bibi LeBlanc Photography RIGHT: https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall RESOURCES: https://www.history.com/topics/cold-war/berlin-wall ALEXANDERPLATZ, WELTZEITUHR & FERNSENTURM ALEXANDERPLATZ, WORLD CLOCK & TV TOWER PHOTO CREDIT: BIBI LEBLANC RESOURCES: • https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/the-history-of- the-world-clock-in-1-minute • -

Things, That Endure
CULTURE, PHILOSOPHY AND ARTS RESEARCH INSTITUTE Ancient Baltic Culture THINGS, THAT ENDURE Edited by Dr. Elvyra Usačiovaitė Vilnius 2009 KULTŪROS, FILOSOFIJOS IR MENO INSTITUTAS Senovės baltų kultūra TAI, KAS IŠLIEKA Vilnius 2009 UDK 008(=88) Se91 Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Redakcinė kolegija: akademikas Algirdas GAIŽUTIS Vilniaus pedagoginis universitetas prof, habil, dr. Juris URTANAS Latvijos kultūros akademija habil, dr. Saulius AMBRAZAS Lietuvių kalbos institutas habil, dr. Nijolė LAURINKIENĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas akademike Janina KURSYTĖ Latvijos universitetas dr. Radvile RACĖNAITĖ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas dr. Elvyra USAČIOVAITĖ Kultūros, filosofijos ir meno institutas dr. Eugenijus SVETIKAS Lietuvos istorijos institutas Sudarė dr. E. Usačiovaitė. Leidinys apsvarstytas ir rekomenduotas spaudai Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos © Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009 © Viršelio nuotrauka, Vilmantė Matuliauskienė, 2009 © „Kronta“ leidykla, 2009 ISBN 978-609-401-027-9 Turinys Elvyra Usačiovaitė. Įvadas............................................................9 Gintaras Beresnevičius Vietos ir spalvos Lietuvos religinės geografijos bruožai XIII-XIV a.................... 31 Elvyra Usačiovaitė. Kristupas Hartknochas apie prūsų religiją.........................................................................39 Pranas Vildžiūnas. Auxtheias Vissagistis - supagonintas krikščionių Dievas........................................................................69 -

AUKCJA VARIA (28) 16 Lutego (Sobota) 2019, Godz
AUKCJA VARIA (28) 16 lutego (sobota) 2019, godz. 17.00 w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego w Gdańsku, ul. Długa 2/3 WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA: od 28 stycznia 2019 r. Gdańsk, ul. Długa 2/3 poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15 tel. (58) 301 05 54 Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl 1 Artysta nieokreślony (2 poł. XVIII w.) Pejzaż włoski olej, płótno dublowane, 45,5 × 75 cm cena wywoławcza: 5 000 zł 2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 2 Artysta nieokreślony (2 poł. XVIII w.) Pejzaż włoski z ruinami i posągiem olej, płótno dublowane, 45,5 × 75 cm cena wywoławcza: 5 000 zł AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO 3 3 Thomas Bush Hardy (1842 Sheffield–1897 Londyn) Żaglowce na morzu olej, płótno, 51 × 76 cm sygn. p. d.: T… Hardy cena wywoławcza: 3 000 zł 4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 4 Carl Saltzmann (1947–1923) Statki na redzie, 1898 r. olej, płótno, 53,5 × 117 cm sygn. i dat. l. d.: C. Saltzmann 98 cena wywoławcza: 1 900 zł AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO 5 5 Zbigniew Litwin (1914–2001) Łodzie na plaży, 1968 r. akwarela, papier, 36 × 51 cm sygn. i dat. p. d.: ZLitwin 1968 cena wywoławcza: 2 600 zł • 6 J. Makowski (XX w.) Jastarnia olej, tektura, 21 × 31 cm sygn. p. d.: J. Ma- kowski/Jastarnia cena wywoławcza: 1 000 zł 6 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 7 Marian Mokwa (1889 Malary – 1987 Sopot) Port olej, płótno, 50 × 80 cm sygn. p. d.: Mokwa cena wywoławcza: 10 000 zł • AUKCJA VARIA (28) | MALARSTWO 7 8 Stanisław Gibiński (1882 Rzeszów – 1971 Katowice) Przy ognisku akwarela, tektura, 34 × 48,5 cm sygn.