Schriftlicher Beitrag Mit Arbeitsbericht (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Gefangenen ,;." I '8(
Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Paul Carell . Günter Böddeker 10'. J.i (),8,' Die Gefangenen ,;." i '8(, Leben und Überleben deutscher Soldaten hinter Stacheldraht SNO BIBLIOTHEK DER ZEITGESCHICHTE ULLSTEIN Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Rheinwiesenlager Der Obergefreite Hans Friedhelm sah, wie 14jährige Flakhelfer verhungerten. Der Volkssturmmann Werner Ebenbachersah, wie deutsche Solda ten in den Schlamm fielen und erstickten, weil ihnen die Kraft fehlte, sich zu erheben. Der Panzerjäger J ürgen C. Otto sah, wie deutsche Soldaten Kame raden in Jauchegruben warfen. Der Fahnenjunker Benno Tins beneidete einen Kameraden, einen 20jährigen Fliegersoldaten, um dessen Blinddarmschmerzen, weil sie den Transport in ein Lazarett bedeuteten. Der Heeresverpflegungsamtsleiter Marzell Oberneder lebte mona telang mit fünf Kameraden in einer selbst gegrabenen Lehmgrube, die drei Quadratmeter groß war. Der Leutnant WiIIi WiIIers vom Magdeburger Pionierbataillon 4 kampierte rund zwei Monate in einem Ackerloch. Er sah die in den Schlammboden getretenen Hunger-Toten, von denen zuweilen ein Arm, ein Bein aus dem Boden ragte. Dies alles hat sich zugetragen im Frühjahr und Sommer 1945 am deutschen Rhein. An den Ufern des Stromes und seiner Nebenflüsse, zwischen Rheinberg in der Nähe von Wesel im Norden und Bad Kreuznach im Süden, waren mehr als eine halbe Million Soldaten der Deutschen Wehrmacht auf Äckern und Wiesen zusammengetrieben, von Drahtverhauen eingezäunt, allesamt Gefangene der Amerikaner. Die Weltgeschichte kennt keine größere Ballung von Gefangenen auf so wenigen Quadratkilometern. Hier auf den feuchten Wiesen der Rheinniederung pferchten die Sieger aus Amerika die Soldaten der geschlagenen deutschen Armeen zusammen. Drei Namen stehen vor allen für alle Zeiten als geographische Standortbestimmung der Wiesenlager in den Chroniken der Kriegsgefangenengeschichte: Rheinberg, Wickrath und Remagen. -

Conrad Von Hötzendorf and the “Smoking Gun”: a Biographical Examination of Responsibility and Traditions of Violence Against Civilians in the Habsburg Army 55
1914: Austria-Hungary, the Origins, and the First Year of World War I Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) Samuel R. Williamson, Jr. (Guest Editor) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 23 uno press innsbruck university press Copyright © 2014 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Design by Allison Reu Cover photo: “In enemy position on the Piave levy” (Italy), June 18, 1918 WK1/ALB079/23142, Photo Kriegsvermessung 5, K.u.k. Kriegspressequartier, Lichtbildstelle Vienna Cover photo used with permission from the Austrian National Library – Picture Archives and Graphics Department, Vienna Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press by Innsbruck University Press ISBN: 9781608010264 ISBN: 9783902936356 uno press Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Ferdinand Karlhofer, Universität Innsbruck Assistant Editor Markus Habermann -

German Prisoners of War in Canada, 1940–1946: an Autobiography-Based Essay
Canadian Military History Volume 27 Issue 2 Article 19 2018 German Prisoners of War in Canada, 1940–1946: An Autobiography-Based Essay Franz-Karl Stanzel Follow this and additional works at: https://scholars.wlu.ca/cmh Part of the Military History Commons Recommended Citation Stanzel, Franz-Karl "German Prisoners of War in Canada, 1940–1946: An Autobiography-Based Essay." Canadian Military History 27, 2 (2018) This Feature is brought to you for free and open access by Scholars Commons @ Laurier. It has been accepted for inclusion in Canadian Military History by an authorized editor of Scholars Commons @ Laurier. For more information, please contact [email protected]. Stanzel: German Prisoners of War in Canada German Prisoners of War in Canada, 1940–1946 An Autobiography-Based Essay FRANZ-KARL STANZEL “What is a prisoner of war? He is a man who has tried to kill you and, having failed to kill you, asks you not to kill him.” —Winston Churchill Abstract : The four years I spent in British and Canadian POW Camps offered ample time to study English Literature. This experience in particular had a decisive effect on my later career as university teacher of English literature. It also helped me to become one of the first Anglicists at German and Austrian universities, who included Canadian literature in his syllabus and a founder member of the German Association for Canadian Studies. In this essay based on my war-autobiography, I describe the experience of German POWs in Canada. I was captured in 1942 when serving as third officer of the watch on board U-331 after my vessel was sunk in the Mediterranean by a torpedo fired from a RAF Albacore. -

Phd Rüdiger Ritter University of Bremen, Germany
INTERNATIONAL CONFERENCE „WORLD WAR II PRISONERS IN THE NAZI AND SOVIET CAMPS IN 1939–1948“ 14-15 MAY 2015, ŠILUTĖ PhD Rüdiger Ritter University of Bremen, Germany POW CAMPS DURING WWII AND AFTER IN GERMAN COLLECTIVE MEMORY. A RESEARCH SURVEY POW camps - in the German public that term evokes the idea of Stalin's first prisoner of war camps. The return of German prisoners of war in the Adenauer era in the Federal Republic of Germany is still one of the best known places of memory regarding these camps. But although i was known that there existed additionally to these camps many other prisoner of war camps, this hardly played a role in the public debate. This presentation addresses some distinguishing characteristics of the memory of these places in western Germany. It focuses first on the long silence with regard to the prisoner of war camps in the West German public at all, then to the different types of prisoner of war camps and dealing with them in the public remembering, and finally to the phenomenon of fragmented memories regarding the variety of POW camps. During and after World War II many camps experienced a change of use, when the Allies put an end on the Nazi regime, but the existing camps mutatis mutandis continued to be in use. Silence after the War The silence regarding the POW camps is closely related to the basic structure of dealing with the Second World War and especially with German guilt. Therefore here follows first a brief outline of this process. Here I orient on relevant works by Aleida Assmann, Edgar Wolfrum and other authors. -

75 Jahre Kriegsende in Rheinland-Pfalz Samstag, 29
EINLADUNG ZUR VERANSTALTUNGSREIHE Vor 75 Jahren endete mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa, der Schätzungen zufolge weltweit über 60 Millionen Todesopfer eingefordert hatte. Mit einer Veranstaltungsreihe erinnert die Landeszen- trale für politische Bildung mit unterschiedlichen Kooperati- onspartnern an dieses Ereignis. PROGRAMM © Landeszentrale für politische Bildung RLP © Landeszentrale Veranstaltungsreihe 2020 75 Jahre Kriegsende in Rheinland-Pfalz Samstag, 29. Februar „Die Brücke von Remagen – alles nur Hollywood?“ Linksrheinischer Brückenkopf der Ludendorff-Brücke © Klaus J. Becker Donnerstag, 5. März Samstag, 29. Februar, 8.00 Uhr „Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert in der Endphase des Krieges“ „Die Brücke von Remagen – alles nur Hollywood?“ Sonntag, 15. März Tagesexkursion mit Bus oder individueller Anreise „We’re Going to Hang out the Washing on the Siegfried Line“ Die Einnahme der Brücke von Remagen am 7. März 1945 er- möglichte den ersten alliierten Übergang über den Rhein. Sie Sonntag, 22. März erlangte durch den 1969 erschienenen US-Kriegsfilm „Die „Nierstein Crossing – Silent Crossing“ Brücke von Remagen“ besondere Bekanntheit. Im Rahmen einer Exkursion nach Remagen werden die realen Ereignisse Montag, 23. März / Samstag, 28. März vom März 1945 vorgestellt und durch den Besuch der Wehr- „Frauen und Zwangsarbeit“ technischen Studiensammlung Koblenz verdeutlicht. Samstag, 9. Mai Ablauf: Besichtigung der Ludendorff-Brücke Remagen „Der Krieg war aus“ und der Wehrtechnischen Sammlung Koblenz 8.00 Uhr Ludwigshafen HBF / Busbahnhof Samstag, 9. Mai 8.45 Uhr Worms HBF / Busbahnhof „Was bedeutete die Befreiung vom Faschismus in Mainz?“ 9.45 Uhr Mainz HBF / Fernbusbahnhof 11.30 Uhr Ankunft Rheinwiesenlager Remagen Montag, 18. Mai 12.00 Uhr Ludendorff-Brücke „Stunde Null“? 12.25 Uhr Abfahrt zur Wehrtechnischen Sammlung Koblenz 13.00 Uhr Ankunft Wehrtechnische Sammlung Koblenz Donnerstag, 25. -

Battle for the Ruhr: the German Army's Final Defeat in the West" (2006)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2006 Battle for the Ruhr: The rGe man Army's Final Defeat in the West Derek Stephen Zumbro Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the History Commons Recommended Citation Zumbro, Derek Stephen, "Battle for the Ruhr: The German Army's Final Defeat in the West" (2006). LSU Doctoral Dissertations. 2507. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2507 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. BATTLE FOR THE RUHR: THE GERMAN ARMY’S FINAL DEFEAT IN THE WEST A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Derek S. Zumbro B.A., University of Southern Mississippi, 1980 M.S., University of Southern Mississippi, 2001 August 2006 Table of Contents ABSTRACT...............................................................................................................................iv INTRODUCTION.......................................................................................................................1 -

The Unconditional Surrender of Germany in the American Perspective: the Case of German Prisoners of War (1945-1947)
Review of History and Political Science June 2019, Vol. 7, No. 1, pp. 35-38 ISSN: 2333-5718 (Print), 2333-5726 (Online) Copyright © The Author(s). 2015. All Rights Reserved. Published by American Research Institute for Policy Development DOI: 10.15640/rhps.v7n1a5 URL: https://doi.org/10.15640/rhps.v7n1a5 The Unconditional Surrender of Germany in the American Perspective: The Case of German Prisoners of War (1945-1947) Francesca Somenzari1 Abstract At the end of WWII Germany had to face a difficult situation posed by a military occupation over its territory and by a division into four zones. At the basis of that complete loss of authority for Germany, there is a written agreement that formalized the surrender, also known as Unconditional Surrender. From a juridical point of view, the Unconditional Surrender is a special category of capitulation which leaves open the possibility for the victorious powers of adding further provisions. The case of German Prisoners of War in the U.S. sector (1945-1947) is to be considered and analyzed in the light of the above-mentioned legal framework. Keywords: Germany, prisoners of war, U.S. Army, Unconditional Surrender, 1945 Introduction The twentieth century was a turning-point in the world’s history: two World Wars and a Cold War. The First World War was a catastrophe with no parallel in history; it introduced new kinds of fighting and it didn’t spare innocent civilians. In that period nine million soldiers died in the trenches. Armies invaded countries and slaughtered people. The Second World War systematized this trend. -

German Prisoners of War in Britain, 1940-1948: Policy and Performance
_________________________________________________________________________Swansea University E-Theses German prisoners of war in Britain, 1940-1948: Policy and performance. Clarke, Gillian S How to cite: _________________________________________________________________________ Clarke, Gillian S (2006) German prisoners of war in Britain, 1940-1948: Policy and performance.. thesis, Swansea University. http://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42278 Use policy: _________________________________________________________________________ This item is brought to you by Swansea University. Any person downloading material is agreeing to abide by the terms of the repository licence: copies of full text items may be used or reproduced in any format or medium, without prior permission for personal research or study, educational or non-commercial purposes only. The copyright for any work remains with the original author unless otherwise specified. The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holder. Permission for multiple reproductions should be obtained from the original author. Authors are personally responsible for adhering to copyright and publisher restrictions when uploading content to the repository. Please link to the metadata record in the Swansea University repository, Cronfa (link given in the citation reference above.) http://www.swansea.ac.uk/library/researchsupport/ris-support/ German Prisoners of War in Britain, 1940-1948: Policy and Performance Gillian S. Clarke Submitted to the University of Wales in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Swansea University, 2006 ProQuest Number: 10797986 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. -

Kriegsgefangenschaft in Den Rheinwiesenlagern (1945 Bis 1948)
B L Ä T T E R Nr. 63 ZUM LAND Kriegsgefangenschaft in den Rhein wiesenlagern (1945 bis 1948) In den letzten Monaten des Zweiten Welt- rischen Lagern am Rhein – den sogenannten kriegs – im März, April und Mai 1945 – gerie- Rheinwiesenlagern – interniert. Während es ten Millionen deutscher Soldaten in Kriegs- an Unterkünften, Nahrung und Medizin für gefangenschaft. Die alliierten Streitkräfte alle Menschen in Deutschland mangelte, waren auf eine solch große Zahl von Kriegs- war auch das Leben der Kriegsgefangenen gefangenen in einer so kurzen Zeitspanne gekennzeichnet von Hunger, Krankheiten und nicht ausreichend vorbereitet. Daher wurden völlig unzureichenden hygienischen Verhält- die Soldaten sowie uniformierte oder ver- nissen. dächtige Zivilisten zunächst in proviso- Heute sind die Rheinwiesenlager, ihre Ursachen und Folgen zumeist nicht mehr bekannt. Nach Kriegsende lag das Interesse der deutschen Bevölkerung verstärkt auf den Kriegsgefangenenlagern in der Sowjetunion, in denen noch bis 1955 deutsche Sol- daten interniert waren. Zu- dem führten insbe- sondere politische Entscheidungen dazu, dass For- schungsergebnis- se der Historiker- Kommission unter Leitung von „Regentag“, Bretzenheim 1945, Zeichnung Wilhelm Götting, © VG Bild-Kunst, Bonn 2014, Quelle: Dokumentationszentrum Bretzenheim; Fotografie Remagen, Quelle: Gückelhorn/Kleemann 2013. Prof. Erich Maschke in der Öffentlichkeit der zu diesem Zeitpunkt etwa 300.000 nicht verbreitet wurden. Die Kommission hat- deutschen Männer besser gewährleistet te in den 1960er und 1970er Jahren intensiv werden als im europäischen Kriegsgebiet. Tausende Erlebnisberichte ausgewertet und Insgesamt wurden rund 11 Millionen Deut- dabei erste Hochrechnungen zu den Todes- sche während des Zweiten Weltkriegs und zahlen in den Rheinwiesenlagern gemacht. danach zu Kriegsgefangenen. Davon befan- Die Ergebnisse der Kommission wurden aber den sich etwa 7,7 Millionen in westalliierter nur in der Fachwelt wahrgenommen. -
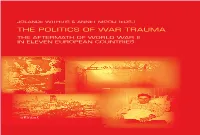
Jolande Withuis & Annet Mooij (Eds.)
STUDIES OF THE NETHERLANDS INSTITUTE FOR WAR DOCUMENTATION THE POLITICS OF WAR TRAUMA THE POLITICSOFWAR JOLANDE WITHUIS & ANNET MOOIJ (EDS.) THE POLITICS OF WAR TRAUMA In 1945, after the Allied victory over Nazi Germany, JolandeDr Martijn Withuis, Eickhoff THE AFTERMATH OF WORLD WAR II Europe had to come to terms with its devas- sociologist,(1967) is a historianis a senior tating losses. Millions of people had lost their researcherwho has published at the IN ELEVEN EUROPEAN COUNTRIES lives. Others were ill, starved and haunted by their Netherlandswidely on the Institute role and experiences in camps and in hiding, during combat forposition War Documentation of academics and bombardments. Nowadays in most Western countries a disaster like that would be met with (NIOD).in the Third Annet Reich. Mooij He is an army of psychotraumatologists. But in 1945 the ais freelance a researcher researcher. at the concept of posttraumatic stress was unknown. SheNetherlands has published Institute How did the medical professionals and the victims severalfor War books Documentation in the themselves perceive their health? What pension fi (NIOD)eld of medical in Amsterdam history. schemes existed? And which categories of victims and a lecturer in were eligible for support? cultural history at The Politics of War Trauma compares the attitudes Radboud University and policies towards the health consequences of WWII in eleven European countries: Austria, Belgium, Nijmegen. Denmark, East-Germany, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland and West-Germany. JOLANDE WITHUIS&ANNETMOOIJ(EDS.) It shows the remarkably asynchronous development of the medical approach to the survivors in these countries. In a truly interdisciplinary and innovative way the book connects aspects of the aftermath of war that are not usually analyzed together. -

The Civil Reintegration of Demobilized Soldiers of the German
FROM SOLDIERS TO CITIZENS: THE CIVIL REINTEGRATION OF DEMOBILIZED SOLDIERS OF THE GERMAN WEHRMACHT AND THE IMPERIAL JAPANESE ARMY AFTER UNCONDITIONAL SURRENDER IN 1945 By BIRGIT SCHNEIDER A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY WASHINGTON STATE UNIVERSITY Department of History MAY 2010 © Copyright by BIRGIT SCHNEIDER, 2010 All Rights Reserved © Copyright by BIRGIT SCHNEIDER, 2010 All Rights Reserved To the Faculty of Washington State University: The members of the Committee appointed to examine the dissertation of BIRGIT SCHNEIDER find it satisfactory and recommend that it be accepted. ___________________________________ Raymond C. Sun, Ph.D., Chair ___________________________________ Noriko Kawamura, Ph.D. ___________________________________ Brigit Farley, Ph.D. ii ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank everyone who has helped me be successful in the Ph.D. program at the History Department at Washington State University and beyond. First and foremost, I would like to thank my committee chair, Raymond Sun, for his constant trust and support, and for many enlightening discussions. I could not have finished this project without him. I would also like to thank my committee members, Noriko Kawamura and Brigit Farley, for their help, insights, and thoughts on my work. I would like to thank Alex D’Erizans, Victor Cheng, Sun Yi, Elise Foxworth, Susanne Klien, Midori Keech, and Vincent Pollard for their critical and supportive questions and comments at the conferences where I presented parts of this dissertation, at GSA, NYCAS, AHA-PCB, JSA-ASEAN, and JSA. Further, I would like to thank Professor Hiroshi Fujino for his tremendous help in getting in contact with Kimura Takuji, and Kimura-san for sharing his thesis with me. -

Rheinland-Pfalz
AUS DEN LÄNDERN Rheinland-Pfalz 117er Ehrenhof 5, 55118 Mainz Tel.: 06131 - 220229, Mail: [email protected] Schirmherr: Hendrik Hering (Landtagspräsident) Landesvorsitzender: Martin Haller (MdL) Landesgeschäftsführer: Carsten Baus Beim parlamentarischen Mitarbeitende: 12 Hauptamtliche, 663 Ehrenamtliche Abend: Landesvorsitzender Martin Haller Verbände: 2 Bezirksverbände (Mitte) Matthias Lammert (Stellvertreter, links) und Land- Mitglieder: 5.273 tagspräsident Hendrik Hering. Volksbund Spenderinnen/Spender: 13.808 Veranstaltungen: Für mich persönlich ... • 1. Parlamentarischer Abend zu Volksbund-Arbeit mit Refe- … schafft das Projekt „gemeinsamer Geschäftsführer“ mit dem raten des Volksbund-Präsidenten Wolfgang Schneiderhan Landesverband Saar Spielraum: aktuell für die Kooperation und des Landesvorsitzenden Martin Haller vor rund 60 mit der Landeszentrale für politische Bildung beim Doku-Zen- Landtagsabgeordneten trum „Rheinwiesenlager“. Wir schaffen einen Ort, der in der • Ausstellung „Europa, der Krieg und ich – 100 Jahre Volks- Gedenkarbeit im Land dauerhaft Bestand hat. bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ in Koblenz im Zentrum Innere Führung der Bundeswehr, Eröffnung mit Ende 2020 erscheint ein Buch über Kriegsgräberstätten in Generalsekretärin Daniela Schily und rund 100 Gästen Rheinland-Pfalz. Das ist unser zweites wichtiges Kooperations- • Volkstrauertag in Kooperation mit der Stadt Bingen, Motto projekt, hier unterstützt uns die Denkmalschutzbehörde als „Frieden in Europa“, Hauptredner EU-Haushaltskommissar Herausgeber