Carrie Von Thomas Möbius
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dru Tvena I Kulturna Važnost Horora
Društvena i kulturna važnost horora Smrekar, Jana Undergraduate thesis / Završni rad 2019 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Croatian Studies / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:048512 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-09-24 Repository / Repozitorij: Repository of University of Zagreb, Centre for Croatian Studies SVEUČILIŠE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI Jana Smrekar DRUŠTVENA I KULTURNA VAŽNOST HORORA ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2019. SVEUČILIŠE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU Jana Smrekar DRUŠTVENA I KULTURNA VAŽNOST HORORA ZAVRŠNI RAD Mentor: prof. dr. sc. Renato Matić, redoviti profesor Zagreb, 2019. Sažetak Horor-žanr je u znanstvenim krugovima velikim dijelom zapostavljen jer je smatran nižom umjetničkom formom. No, u ovom radu pokazano je da je horor izrazito djelotvoran u bavljenju društvenim anksioznostima. Tjeskobe izražene u djelima iz žanra ovise o društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu u kojem su nastali, te o identitetu i iskustvima autora i publike. Ovaj rad se fokusira na kratki povijesni pregled razvoja žanra, te na komparaciju horora i bajki, prema kojima su horori, naročito oni o odrastanju, moderne bajke, kao i analizu romana Stephena Kinga It i njegove filmske adaptacije kao metafore za cikličko sistemsko nasilje. Horori, zbog svoje simboličke naravi, igraju ključnu ulogu u preispitivanju društvenih struktura i podižu glasove marginaliziranih skupina. Abstract The horror genre is largely ignored in academic circles because it is considered a lower art form. But, this dissertation shows that horror is extremely effective in dealing with societal anxieties. -

Proefschrift Joeri Pacolet.Pdf
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/155632 Please be advised that this information was generated on 2021-09-27 and may be subject to change. Stephen Kings Transcendente Schrijvers Een Post-Jungiaanse Analyse van de Puer Aeternus in Kings Fictie Joeri Frans Pacolet ©Joeri Frans Pacolet, 2015 ISBN/EAN: 978-90-9029533-6 NUR-code: 617 Foto voorzijde: ‘train track’ van Nadia Szopińska (Flickr, creative commons) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of uitgezonden, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, microfilm, opname of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. II Stephen Kings Transcendente Schrijvers Een Post-Jungiaanse Analyse van de Puer Aeternus in Kings Fictie Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op vrijdag 19 februari 2016 om 16.30 uur precies door Joeri Frans Pacolet Geboren op 26 augustus 1981 te Sint-Truiden (België) III Promotor: Prof. dr. J. T. J. Bak Copromotor: Dr. E. J. van Leeuwen (Universiteit Leiden) Manuscriptcommissie: Prof. dr. O. Dekkers Prof. dr. T. D’haen (Katholieke Universiteit Leuven, België) Prof. dr. P.Th.G. -

A Face of Horror in Stephen King's Carrie
Journal of Scientific Computing ISSN NO: 1524-2560 A Face of Horror in Stephen King’s Carrie 1#Dr. SUDHIR V. NIKAM, Head, PG Department of English B.N.N.College, Bhiwandi, Mumbai 2*Mr. RAJKIRAN J. BIRAJE, Shri Shahaji Chhatrapati Mahavidyala, Dasara Chowk, Kolhapur. PhD scholar ( Mumbai University) Modern horror fiction would not be complete without the landmark works and ideas of author Stephen King. When someone thinks of Stephen King, the most popular horror fiction author of the century, it is likely that they would imagine the blood, gore, supernatural elements and suspense for which he is known. The present research paper has purpose to introspect the formula of horror applied in the novel Carrie. It is hard to believe in living in an old orthodox ultra-religious family in a progressive world. Even a sane and rational being would suffer if he is thrown or grown up in such a fanatic family. This is exactly what Stephen King portrays in Carrie. A serious of unfortunate events in the past deeply traumatizes Carrie psychologically and results in Carrie turning into the monster figure of the story. In horror fiction at least one character is given a supernatural power and Carrie falls under this category through the character Carrie white. The relationship between normality and the monster is the key element in every horror story and this is what we can experience in this novel. This paper also talks about anxiety theories made by Freudian and these are reality anxiety and moral anxiety through the characters Carrie and Margaret. -

CARRIE Stephen King
CARRIE Stephen King Această carte este pentru Tabbz, care m-a atras în ea... şi apoi, m-a scos pe cauţiune. PARTEA ÎNTÂI Sport cu sânge Tabletă informativă din săptămânalul "Enterprise", 19 august 1966, Westover (Me.) (abr. ) Maine SEMNALAREA UNEI PLOI CU PIETRE Mai multe persoane de încredere au semnalat faptul că o ploaie de pietre a căzut din bun senin pe Carlin Street, în oraşul Chamberlain, la data de 17 august. Pietrele au căzut mai ales pe casa D-nei Margaret White, deteriorând în mare măsură acoperişul şi avariind două jgheaburi şi un burlan, estimate la aproximativ 25$. D-na White, văduvă, locuieşte cu fetiţa ei în vârstă de trei ani, Carietta. Nu s-a putut lua legătura cu D-na White pentru declaraţii. Nimeni nu a fost într-adevăr surprins când s-a întâmplat, nu cu adevărat, nu la acel nivel subconştient unde colcăie lucruri sălbatice. Ca reacţie exterioară, toate fetele din sala duşurilor au fost şocate, înfiorate, ruşinate sau pur şi simplu bucuroase că White, căţeaua, o luase iarăşi peste bot. Unele dintre ele ar fi putut de asemenea simula surpriza dar, fireşte, pretenţiile le erau neîntemeiate. Carrie învăţase la aceeaşi şcoală cu unele din fete încă din clasa întâi, iar starea începuse să se clădească încă de pe atunci, să se clădească încet şi imuabil, în conformitate cu toate legile ce guvernează natura umană, şi cu statornicia unei reacţii în lanţ apropiindu-se de masa critică. Ceea ce nici una dintre ele nu ştia, bineînţeles, era că acea Carrie White avea puteri telekinezice. Inscripţie scrijelită pe un pupitru din Şcoala Elementară cu clasele V-VIII, Barker Street, Chamberlain: Carrie White mănâncă căcat. -

The Horror of the Failed Female Hero's Journey in Carrie And
Monstrous Journeys: The Horror of the Failed Female Hero’s Journey in Carrie and Ginger Snaps Rebecca Sterling CSUSM Fall 2017 Sterling 1 Introduction One of the most common tropes that permeates the Horror genre is the depiction of women as monsters. Horror films and novels depict women as victims of possession, wielders of dark powers, and villainous hags. In my thesis I focus on the representation of adolescent, menstruating women in the horror genre, using two contemporary texts from North America. My chosen texts are works that overtly depict menstruation and puberty: Stephen King’s Carrie and John Fawcett’s Ginger Snaps. In Carrie and Ginger Snaps, both title characters experience traumatic menarches that lead them to horrific journeys. Both Ginger and Carrie become monsters because of their unusual puberty, which prevents them from becoming part of a female community and finding a place of belonging. Instead of joining groups of likeminded women, Ginger and Carrie eliminate the communities around them; their monstrosity is so destructive that their failures result in the failures of the women around them. The representation of menstrual women in horror suggests that those who do not menstruate normally are ultimately doomed to become outsiders and fail their hero’s journeys, which implies to audiences that there is a “normal” way to menstruate and that women who do not menstruate “normally” can never become functional members of society. In some cases, the social stigmatization of menstruation gives rise to the monstrous potential of women in horror. In Stephen King’s Carrie, Carrietta White begins her period in the school shower and is ruthlessly bullied because of it. -

Psicopatologias Em “O Iluminado”, De Stephen King
Universidade de Brasília Instituto de Letras Departamento de Teoria Literária e Literaturas Programa de Pós-graduação em Literatura PSICODINÂMICA NO GÓTICO CONTEMPORÂNEO: PSICOPATOLOGIAS EM “O ILUMINADO”, DE STEPHEN KING Fábio Ramos Paz Brasília – DF 2019 Universidade de Brasília Instituto de Letras Departamento de Teoria Literária e Literaturas Programa de Pós-graduação em Literatura PSICODINÂMICA NO GÓTICO CONTEMPORÂNEO: PSICOPATOLOGIAS EM “O ILUMINADO”, DE STEPHEN KING Fábio Ramos Paz Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação/Curso de Mestrado no Departamento de Teoria Literária e Literatura do Instituto de Letras da Universidade de Brasília – TEL-UnB, como parte integrante dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Literatura. Orientador: Prof. Dr. Wiliam Alves Biserra Brasília – DF 2019 Ficha catalográfica elaborada automaticamente, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) Ramos Paz, Fábio RP348p Psicodinâmica no Gótico Contemporâneo: Psicopatologias em "O Iluminado", de Stephen King / Fábio Ramos Paz; orientador Wiliam Alves Biserra. -- Brasília, 2019. 127 p. Dissertação (Mestrado - Mestrado em Literatura) -- Universidade de Brasília, 2019. 1. Gótico. 2. Horror. 3. Literatura. I. Alves Biserra, Wiliam, orient. II. Título. PSICODINÂMICA NO GÓTICO CONTEMPORÂNEO: PSICOPATOLOGIAS EM “O ILUMINADO”, DE STEPHEN KING Dissertação defendida no Programa de Pós-graduação do Departamento de Teoria Literária e Literaturas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre aprovada em _______________ pela Banca Examinadora constituída pelos seguintes membros: ________________________________________________ Prof. Dr. Wiliam Alves Biserra (Orientador) ________________________________________________ Prof. Dra. Cintia Carla Moreira Schwantes (Membro interno) ________________________________________________ Prof. Dra. Alessandra Matias Querido (Membro externo) ________________________________________________ Prof. Dr. -
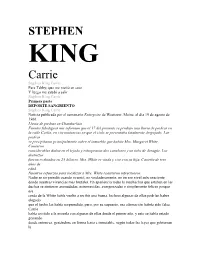
STEPHEN Carrie
STEPHEN KING Carrie Stephen King Carrie Para Tabby, que me metió en esto Y luego me ayudó a salir. Stephen King Carrie Primera parte DEPORTE SANGRIENTO Stephen King Carrie Noticia publicada por el semanario Enterprise de Westover, Maine, el día 19 de agosto de 1966: Lluvia de piedras en Chamberlain Fuentes fidedignas nos informan que el 17 del presente se produjo una lluvia de piedras en la calle Carlin, en circunstancias en que el cielo se presentaba totalmente despejado. Las piedras se precipitaron principalmente sobre el inmueble que habita Mrs. Margaret White. Causaron considerables daños en el tejado y estropearon dos canalones y un tubo de desagüe. Los destrozos fueron evaluados en 25 dólares. Mrs. White es viuda y vive con su hija, Carietta de tres años de edad. Nuestros esfuerzos para localizar a Mrs. White resultaron infructuosos. Nadie se sorprendió cuando ocurrió, no verdaderamente, no en ese nivel subconsciente donde nuestras vivencias más brutales. En apariencia todas la muchachas que estaban en las duchas se sintieron anonadadas, estremecidas, avergonzadas o simplemente felices porque esa cerda de la White había vuelto a recibir una buena. Incluso algunas de ellas podrían haber alegado que el hecho las había sorprendido, pero, por su supuesto, esa afirmación habría sido falsa. Carrie había asistido a la escuela con algunas de ellas desde el primer año, y esto se había estado gestando desde entonces, gestándose en forma lenta e inmutable, según todas las leyes que gobiernan la naturaleza humana, gestándose con la exacta regularidad de una reacción en cadena que se acerca a la mesa crítica. -

Carrie ______Stephen King
CARRIE _________________ STEPHEN KING DOUBLEDAY NEW YORK LONDON TORONTO SYDNEY AUCKLAND Published by Doubleday, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. 666 Fifth Avenue, New York, New York 10103 DOUBLEDAY and the portrayal of an anchor with a dolphin are trademarks of Doubleday, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. ISBN: 0-385-08695-4 LIBRARY OF CONGRESS CATALOG CARD NUMBER: 73-9037 Copyright © 1974 by Stephen King ALL RIGHTS RESERVED PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA FIRST EDITION This is for Tabby, who got me into it----- And then bailed me out of it. CARRIE Part One ____________ Blood Sport News item from the Westover (Me.) weekly Enterprise, August 19, 1966: RAIN OF STONES REPORTED It was reliably reported by several persons that a rain of stones fell from a clear blue sky on Carlin Street in the town of Chamberlain on August 17th. The stones fell principally on the home of Mrs. Margaret White, damaging the roof extensively and ruining two gutters and a downspout valued at approximately $25. Mrs. White, a widow, lives with her three-year-old daughter, Carietta. Mrs. White could not he reached for comment. Nobody was really surprised when it happened, not really, not at the subconscious level where savage things grow. On the surface, all the girls in the shower room were shocked, thrilled, ashamed, or simply glad that the White bitch had taken it in the mouth again. Some of ~hem might also have claimed surprise, but of course their claim was untrue. Carrie had been going to school with some of them since the first grade, and this had been building since that time, building slowly and immutably, in accordance with all the laws that govern human nature, building with all the steadiness of a chain reaction approaching critical mass. -

CARRIE Pressbook(ITA)
METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES e SCREEN GEMS presentano una produzione MISHER FILMS un film di KIMBERLY PEIRCE LO SGUARDO DI SATANA CARRIE CHLOË GRACE MORETZ JUDY GREER PORTIA DOUBLEDAY e JULIANNE MOORE Costumi di LUIS SEQUEIRA Supervisione alle musiche RANDALL POSTER Musiche di MARCO BELTRAMI Montaggio di LEE PERCY, NANCY RICHARDSON Scenografie di CAROL SPIER Direttore della fotografia STEVE YEDLIN Executive Producers J. MILES DALE Tratto dal romanzo di STEPHEN KING Sceneggiatura di ROBERTO AGUIRRE-SACASA Prodotto da KEVIN MISHER Regia di KIMBERLY PEIRCE Durata: 1 ora e 40 minuti Data d’uscita: 16 gennaio 2014 Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia Materiali stampa: www.cristianacaimmi.com/materialicarrie.zip Ufficio Stampa Warner Bros. Pictures Italia Ufficio Stampa Film Riccardo Tinnirello [email protected] Cristiana Caimmi Emanuela Semeraro [email protected] [email protected] Cinzia Fabiani [email protected] Antonio Viespoli [email protected] 1 IL FILM Tutti conoscono il suo nome. Questa è la rivisitazione del classico horror su Carrie White (Chloë Grace Moretz), la timida ragazza emarginata dai suoi compagni di scuola e oppressa da una madre ultra religiosa (Julianne Moore); una ragazza dotata però di straordinari poteri telecinetici con cui spargerà il terrore nella cittadina dove abita, dopo essere stata derisa dai suoi compagni durante il ballo della scuola. Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) e Screen Gems presentano una produzione A Misher Films, un film di Kimberly Peirce, il thriller soprannaturale CARRIE, una rivisitazione del bestseller di Stephen King, con Chloë Grace Moretz (Kick-Ass, Hugo), Judy Greer (Paradiso amaro), Portia Doubleday (Youth in Revolt), l’attrice nominata quattro volte all’Oscar® Julianne Moore (Crazy, Stupid, Love; I ragazzi stanno bene). -

Notice of Names of Persons Appearing to Be Owners of Abandoned Property
NOTICE OF NAMES OF PERSONS APPEARING TO BE OWNERS OF ABANDONED PROPERTY Pursuant to Chapter 523A, Hawaii Revised Statutes, and based upon reports filed with the Director of Finance, State of Hawaii, the names of persons appearing to be the owners of abandoned property are listed in this notice. The term, abandoned property, refers to personal property such as: dormant savings and checking accounts, shares of stock, uncashed payroll checks, uncashed dividend checks, deposits held by utilities, insurance and medical refunds, and safe deposit box contents that, in most cases, have remained inactive for a period of at least 5 years. Abandoned property, as used in this context, has no reference to real estate. Reported owner names are separated by county: Honolulu; Kauai; Maui; Hawaii. Reported owner names appear in alphabetical order together with their last known address. A reported owner can be listed: last name, first name, middle initial or first name, middle initial, last name or by business name. Owners whose names include a suffix, such as Jr., Sr., III, should search for the suffix following their last name, first name or middle initial. Searches for names should include all possible variations. OWNERS OF PROPERTY PRESUMED ABANDONED SHOULD CONTACT THE UNCLAIMED PROPERTY PROGRAM TO CLAIM THEIR PROPERTY Information regarding claiming unclaimed property may be obtained by visiting: http://budget.hawaii.gov/finance/unclaimedproperty/owner-information/. Information concerning the description of the listed property may be obtained by calling the Unclaimed Property Program, Monday – Friday, 7:45 am - 4:30 pm, except State holidays at: (808) 586-1589. If you are calling from the islands of Kauai, Maui or Hawaii, the toll-free numbers are: Kauai 274-3141 Maui 984-2400 Hawaii 974-4000 After calling the local number, enter the extension number: 61589. -

Affirmative Reaction INSIDE U.S
Volume 27 | Issue 5 November 4, 2013 what’s Affirmative Reaction INSIDE U.S. Supreme Court Tackles decision result of the Schuette Associate Professor at the Uni- v. Coalition to Defend Affirma- versity of Michigan (U of M) . "Gotta catch 'em all" Michigan Affirmative Action Case tive Action case carries enor- Ceballo and husband Matthew BY PETER HUBBARD mous weight. If the Supreme Countryman, also a professor NEWS EDITOR vote. Although the amend- Court votes in support of the at U of M, said the ban has cut During these past few de- ment was supported by the Coalition to Defend Affirma- minority enrollment by a third cades, the hot topic of affirma- majority of Michigan’s popula- tive Action, the result will and had a negative effect in tive action has been energeti- tion, many contend that the ban the ability of the state to the classroom. cally disputed from America’s route which opponents of af- decide whether affirmative “As a group, they feel less a classrooms to courtrooms. firmative action took to abol- action is allowed or not by tak- part of things, less able to par- For those who are unaware ish its programs was unconsti- ing the question to the voting ticipate in the give and take of of its meaning, affirmative ac- tutional. population; a decision like this the institution,” Countryman New generation brings tion is a policy that encourages Before passing into the will affect not only Michigan, says. Supported by statistics Pokemon to 3D. the increased representation Supreme Court’s domain, but also Arizona, Califor- from the AP, African-Ameri- Page 18 of women and minority group the case had already trekked nia, Florida, Nebraska, New can and Latino enrollment at members within a popula- through the 6th U.S. -

Društvena I Kulturna Važnost Horora
Društvena i kulturna važnost horora Smrekar, Jana Undergraduate thesis / Završni rad 2019 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Croatian Studies / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:048512 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-09-27 Repository / Repozitorij: Repository of University of Zagreb, Centre for Croatian Studies SVEUČILIŠE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI Jana Smrekar DRUŠTVENA I KULTURNA VAŽNOST HORORA ZAVRŠNI RAD Zagreb, 2019. SVEUČILIŠE U ZAGREBU HRVATSKI STUDIJI ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU Jana Smrekar DRUŠTVENA I KULTURNA VAŽNOST HORORA ZAVRŠNI RAD Mentor: prof. dr. sc. Renato Matić, redoviti profesor Zagreb, 2019. Sažetak Horor-žanr je u znanstvenim krugovima velikim dijelom zapostavljen jer je smatran nižom umjetničkom formom. No, u ovom radu pokazano je da je horor izrazito djelotvoran u bavljenju društvenim anksioznostima. Tjeskobe izražene u djelima iz žanra ovise o društvenom, političkom i ekonomskom kontekstu u kojem su nastali, te o identitetu i iskustvima autora i publike. Ovaj rad se fokusira na kratki povijesni pregled razvoja žanra, te na komparaciju horora i bajki, prema kojima su horori, naročito oni o odrastanju, moderne bajke, kao i analizu romana Stephena Kinga It i njegove filmske adaptacije kao metafore za cikličko sistemsko nasilje. Horori, zbog svoje simboličke naravi, igraju ključnu ulogu u preispitivanju društvenih struktura i podižu glasove marginaliziranih skupina. Abstract The horror genre is largely ignored in academic circles because it is considered a lower art form. But, this dissertation shows that horror is extremely effective in dealing with societal anxieties.