Der Streit Um Den Karl-May-Nekrolog
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kurt Fiedler
Quelle: http://www.uwe-fiedler.eu/KurtFiedler.pdf 02.07.2011, S. 1 von 31 Friedrich Kurt Fiedler Angaben zum Künstler Geb. am 08.03.1894, Eichbusch Nr. 6 (heutige Adresse Eichbuscher Ring 10) Schulbesuch in Rockau bis 1908, Abendschule an der Kunstgewerbeschule Dresden Meisterschüler und Förderstipendiat eines privaten Mäzens an der Kunstgewerbeschule Dresden, Herbst 1911 bis 15.1.1915; 1911/12 bei Prof. Richard Guhr, 1912-1915 bei Prof. Josef Goller Verh. seit 24.12.1920 in Dresden mit Louise Nanny geb. Schuchardt; erste Adresse: Borsbergstraße 30; drei Kinder Grafiker und Zeichner („Von der heiteren Illustration bis zur sachlichen Industriereklame“) in Dresden; ab ca. 1923 bis 1945 mit Unterbrechung um 1929 bis 1931 wohnhaft im Dürerbundhaus Dresden-Blasewitz Mitglied im Bund Deutscher Gebrauchsgraphiker und in Dresden Vorstandsmitglied im Verein bildender Künstler im Kulturbund Nach dem 2. Weltkrieg künstlerischer Mitarbeiter der Landesleitung der SED, in die er als SPDler übernommen worden war Gest. am 11.11.1950, Dresden; zuletzt wohnhaft: Dresden, Schrammsteinstraße 5 Kurt Fiedler, Selbstbildnis 1950 Aus seinem Leben Das Leben der Menschen seiner Generation wurde von zwei Weltkriegen geprägt. Während des ersten kam Kurt Fiedler als Frontsoldat nach Frankreich. Nachdem er sich Französisch im Selbststudium angeeignet hatte, wurde er als Dolmetscher eingesetzt. Im 2. Weltkrieg war er Französisch-Dolmetscher im Kriegsgefangenenlager Zeithain und hatte mehrfach Auseinandersetzungen mit militärischen Vorgesetzten zur menschenun- würdigen Behandlung der sowjetischen Gefangenen. Er wurde im August 1942 aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert. Die Jahre nach der Inflation waren die erfolgreichsten seines Lebens. Für die Dresdner Volkszeitung der SPD entwarf er 1925 den Zeitungskopf. Im Jahre 1929 wurde sein Plakat auf dem Weltreklamekongress Berlin ausgezeichnet. -

Otto Neurath As a Political Writer (1919–1932)
Chapter 4 Science and Socialism: Otto Neurath as a Political Writer (1919–1932) Günther Sandner Abstract In the case of Otto Neurath, there was always a close relationship between science and politics. It is worth noting, however, that he also intervened in politics of the day. The essay focuses on Neurath’s time in Revolutionary Bavaria and Red Vienna and analyzes his articles in two newspapers in the interwar period: the German periodical Economy and Order of Life (a supplement of the Art Guardian) and the Austrian socialist daily Workers’ Newspaper. The examination starts when Neurath definitely became a socialist and member of the Social Democratic Party (SPD) after the war in Germany and ends shortly before his forced migration from Austria in 1934. The two series of articles differed in some respects. While in Economy and Order of Life Neurath focused only socialization, he addressed a number of different topics in the Arbeiter-Zeitung (AZ – Workers’ Newspaper) rang- ing from guild socialism over housing, architecture and settlement to education and the scientific world-conception. The question of his role and his self-image was a common theme in many of these articles. Beyond that, however, there were even approaches to closely related themes that he developed more precisely only in his later life: the question of experts, citizens, and democracy. 4.1 Intellectual Interventions into Politics As most readers of this book would probably agree, Otto Neurath was the most effective political character among the Viennese philosophers of Logical Empiricism. Although there was a politicized left wing within the Vienna Circle (Carnap 1963; Uebel 2005), which included Rudolf Carnap, Philipp Frank, Hans Hahn and – at its periphery – Edgar Zilsel, even among these, nobody ever played a role in politics comparable to that of Otto Neurath. -
![Working-Class Barracks [Proletarierkasernen] and Such 'Elegant Villas'](https://docslib.b-cdn.net/cover/1911/working-class-barracks-proletarierkasernen-and-such-elegant-villas-2201911.webp)
Working-Class Barracks [Proletarierkasernen] and Such 'Elegant Villas'
Schultze-Naumburg's Heimatstil: A Nationalistic Conflict of Tradition and Modernity This paper analyzes the role of nationalism in Paul Schultze-Naumburg's polemical and popular Kulturarbeiten. It focuses on three distinct aspects of the series: the importance of the whole cultural landscape, the value placed in traditions from "around 1800", and the functionalist stand which Schultze-Naumburg took in his arguments. Together these three themes simultaneously defined the German nation, its culture, and its architecture. Far from being another historicist style, the Heimatstil was an image that fully encompassed modern industry and technological progress. Focusing primarily on architecture, this paper analyzes the formation of a nationalistic aesthetic, a Heimatstil, which combined the values of tradition with continual development. One of the primary figures in the heated cultural debates surrounding German architecture at the turn of the century was the architect and critic Paul Schultze-Naumburg (1869-1949).1 His most influential work was a series of very popular and polemical essays and picture books entitled Kulturarbeiten (Cultural Works) published between 1900 and 1917.2 In the first line of the preface of the Kulturarbeiten Schultze-Naumburg explicitly spells out the scope and purpose of the essays: "to work against the terrible devastation of our country in all areas of visible culture" and to offer a hopeful alternative for the future.3 The scope of the "visible culture" that the Kulturarbeiten addressed was an ambitious, all-encompassing view of the entire 1 cultural landscape--material as well as environmental culture. Landscape referred not to nature, but the whole environment, as one might see it from a high lookout. -

Wagner Quarterly 128, March 2013
ISSUE NO 1 CELEBRATING THE MUSIC OF RICHARD WAGNER WAGNER QUARTERLY 128 MARCH 2013 PRESIDENT’S REPORT the breaks. The full title of the workshop was: “Forging Meaning out of Music: Heritage, Complexity and Vision of the Ring.” It was presented by Dr Antony Ernst and Welcome to our first newsletter for 2013. introduced by Lyndon Terracini Artistic Director of Opera Australia. To describe it as a spectacular success would This is to be a very big year for Wagner lovers the world be an understatement. Antony was on his feet – literally over. On 22 May 1813, in Leipzig, Johanna Wagner gave – for well over ten hours over the two days. He provided birth to her ninth child, a boy initially baptised as Wilhelm Richard. Who was to know that this boy was to become one PRESIDENT’S REPORT Continued page 4 of the great musical geniuses of all time, and that by the time he died nearly 70 years later, he would have changed the face of opera in particular, and music in general? THIS ISSUE: It is barely possible to count the number of Wagner ANTONY ERNST SEMINAR - P. 5 festivals and/or Ring Cycles to be performed at various Report and Responses places in the world this year. It would certainly not be possible to attend all of them, no matter how dedicated a Wagnerian one was. And we in Australia are doing our bit, SYDNEY SYMPHONY - P. 7 with the three Melbourne Ring Cycles at the end of the Wagner Lectures 2013 year, and the concert performance of The Flying Dutchman in Sydney in July. -

Oskar Schlemmer's Kitsch (1922): a Contextualisation and Translation
Journal of Aesthetics & Culture ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/zjac20 Oskar Schlemmer’s Kitsch (1922): a contextualisation and translation Emily Brayshaw To cite this article: Emily Brayshaw (2021) Oskar Schlemmer’s Kitsch (1922): a contextualisation and translation, Journal of Aesthetics & Culture, 13:1, 1945239, DOI: 10.1080/20004214.2021.1945239 To link to this article: https://doi.org/10.1080/20004214.2021.1945239 © 2021 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Published online: 29 Jun 2021. Submit your article to this journal View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=zjac20 JOURNAL OF AESTHETICS & CULTURE 2021, VOL. 13, 1945239 https://doi.org/10.1080/20004214.2021.1945239 Oskar Schlemmer’s Kitsch (1922): a contextualisation and translation Emily Brayshaw Faculty of Design, Architecture and Building, University of Technology Sydney, Ultimo, NSW, Australia ABSTRACT KEYWORDS This article contextualises a previously unpublished manuscript on the subject of kitsch Kitsch; Bauhaus; aesthetics; written in 1922 by the Bauhaus practitioner Oskar Schlemmer and provides an original arts and crafts movement; annotated translation as an appendix. The article positions Schlemmer’s manuscript as Deutscher Werkbund; folk a response to debates about the aesthetics of kitsch among his contemporaries in the art German and Austrian intelligentsia, including Austrian architect Adolf Loos; Stuttgart-based art historian and member of the Deutscher Werkbund Gustav Pazaurek; the founding mem ber of the Dürerbund, Ferdinand Avenarius; and the avant-garde satirist Frank Wedekind. Schlemmer’s unpublished manuscript is also located as part of a broader response to the social upheavals of industrialisation and the First World War, where the concept of kitsch figured centrally in discussions among taste-makers about the progress and purpose of art and design in the new century. -

Germanic Neopaganism – a Nordic Art-Religion?
chapter 9 Germanic Neopaganism – A Nordic Art-Religion? Aesthetic imaginaries in stories, paintings, film, and music, ranging from Wagnerian opera to contemporary black metal, Viking metal, Pagan metal, and neofolk music have had a strong impact on Asatru as well as on popular images of Nordic myth and religion. They have even shaped academic contributions to the discourse of Nordic myth. In spite of their professed commitment to aca- demic knowledge, many Asatruers mention fictional books as their main sources of inspiration and knowledge of Nordic religion. Furthermore, Asatruers often perceive their own religious practices as aesthetic activities. All of this can be attributed to the specific appeal of art and fiction in modernity. They are modes that bring to life the historical past, speak to the senses, and allow emotional identification. Artworks can create a sense of identity and community (be it national or otherwise) which goes beyond a purely fact- oriented and intellectual level; they allow the creation of coherent worlds beyond the meager and scat- tered, often contradictory primary sources. This widespread popularity has turned certain aesthetic genres – popular literature and music in particular – into privileged media in Asatru’s path toward respectability. They are media Asatruers themselves use to disseminate their thoughts and connect themselves with broader ideas about culture and identity. In addition, they are mainstream media that provide material for the construction of Heathen religion. At the same time, aesthetic approaches lend themselves to a more playful, individualized manner of conducting a spiritual life. Cont emporary Neopagan religions in par- ticular tend to perceive their spirituality as a creative process, and to assign art, music, literature, and performance spiritual qualities. -

Der Landschaftsmaler Edmund Steppes (1873-1968)
1 DER LANDSCHAFTSMALER EDMUND STEPPES (1873-1968) UND SEINE VISION EINER „DEUTSCHEN MALEREI“ VON DER HOCHSCHULE FÜR BILDENDE KÜNSTE BRAUNSCHWEIG ZUR ERLANGUNG DES GRADES EINES DOKTORS DER PHILOSOPHIE - DR. PHIL. - genehmigte Dissertation von Andreas Zoller geboren am 26. Juli 1957 in Stuttgart Braunschweig 1999 2 Erst-Referent: Professor Dr. Johannes Zahlten Korreferenten: Professor Dr. Heinrich Dilly Professor Dr. Heino R. Möller Tag der mündlichen Prüfung: 24.08.1999 3 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1 EINLEITUNG 1.1 Annäherung...............................................6 1.2 Forschungslage.......................................... 8 1.3 Quellenlage.............................................15 1.4 Vorgehensweise..........................................17 2 ZUM LEBEN VON EDMUND STEPPES 2.1 Kindheit und Jugend (1873-1891) 2.1.1 Lebensstationen..................................21 2.1.2 Jugendjahre in Selbstzeugnissen..................23 2.1.3 Familie Steppes..................................27 2.1.4 Familie von Schleich.............................30 2.1.5 Christine von Stransky und die Spätromantik.....................................32 2.1.6 Resümee..........................................35 2.2 Lehr- und Wanderjahre (1891-1901) 2.2.1 Lebensstationen..................................36 2.2.2 Bezugspersonen...................................39 2.2.3 Der Lugo-Kreis und Edmund Steppes................41 2.2.4 Erste künstlerische Erfolge......................49 2.2.5 Im Rückblick.....................................53 2.2.6 Zeitzeugnisse....................................55 -
Checklist Department of Special Collections—Memorial Library—University of Wisconsin–Madison
1914: Then Came Armageddon Exhibit Checklist Department of Special Collections—Memorial Library—University of Wisconsin–Madison Guest exhibit co-curators: Skye Doney and Eric O’Connor War Begins in Austria and Serbia Postcards from the Stangel Collection: “Sarajevo – Totalansicht,” postcard 185A. “1914. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern,” postcard 45A. “Serbische Artillerie,” postcard 317A. “Unser Kaiser,” postcard 6A. Herbert Wrigley Wilson and John Alexander Hammerton. The Great War: The Standard History of the All-Europe Conflict. London: Amalgamated Press, 1914. F0807 W69 1. Illustrated London News. 11 July 1914. AP I289 1914. Memorial Library. The Serbian Blue Book, part of Collected Diplomatic Documents Related to the Outbreak of the European War. London: Harrison and Sons, 1915. F0817 4. Crawfurd Price. The Dawn of Armageddon, or the Provocation by Serbia [etc.] London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co, 1917. F0814 7. Austro-Hungarian Red Book. New York: John C. Rankin Co., 1915. F0809 AU7 E A. Germany Mobilizes for War Grosser Bilderatlas des Weltkrieges, vol. 1. Munich: F. Bruckmann, 1915. F0807 G91 1. Pin: “Vergesst Unsere Kolonien Nicht!” Stangel Collection. Pin: “Der Stahlhelm.” Stangel Collection. Illustrirte Zeitung [sic], 6 August 1914. AP I315 143 1. Memorial Library. “Behüt dich Gott in neuen Jahre!” Stangel Collection, postcard 99A. Photograph, Sigrid Schultz Papers. PH 2848.001, folder 2/1 (1). Wisconsin Historical Society Archives. “Schön ist die Jugend.” Stangel Collection, postcard 66A. “Youth is beautiful.” Auswärtiges Amt. German White Book, authorized translation: Documents relating to the Outbreak of the War with Supplements. [N.p., 1914?]. F0809 G23 E. Paul Schreckenbach. Der Weltbrand: Illustrierte Geschichte aus großer Zeit. -

Werkbund, and the Aesthetics of Culture in the Wilhelmine Period
The Kunstgewerbe, the Werkbund, and the Aesthetics of Culture in the Wilhelmine Period MARK JARZOMBEK Cornell University Joseph Goebbels'famous claim about the connection between politics and that concept back to its nonreactionary, Wilhelmine roots.1 This paper, art in his letter to Wilhelm Furtwdngler in 1933 epitomizes Nazi theories which looks at the discourse on cultural aesthetics as it emerged in the first concerning the cultural benefits of art. In it he attempts both to legitimize decade of the twentieth century, also challenges some received notions about and cunningly obscure an underlying reactionary agenda: the Werkbund, an organization of artists, architects, and industrialists founded in 1907. With the Werkbund, the utopian potential of cultural We who are giving form to modern German politics, see aesthetics that emerged in the context of liberal bourgeois theory long before it ourselves as artists to whom has been assigned the great was co-opted by the right wing revealed itself for the first time as a powerful responsibility of forming, from out of the brute mass, the instrument of cultural definition. This paper will also discuss some of the solid and full image of the people. early formulators of Wilhelmine cultural aesthetics in various disciplines, Though there are many studies of post-World War I cultural aesthetics, Karl Scheffier (art critic), Heinrich Waentig (economist), Hermann especially in the context of Hitler'sfinal solution, little has been done to trace Muthesius (architect), and Georg Fuchs (playwright), among others. BY THE TURN OF THE TWENTIETH century, the German This article forms part of a larger work that analyzes the full spectrum Kunstgewerbe began to champion a full spectrum of aesthetic, of related political and economic issues in this period. -

Winter 2019 Hirmer Highlights
WINTER 2019 HIRMER HIGHLIGHTS Making van Gogh focuses on the œuvre of Vincent van Gogh in the context of its recep- tion. The publication examines the particular role which German gallerists, collectors, critics and museums played in the story of his success. At the same time it sheds light on the importance of van Gogh as a role model for the avant-garde generation of artists. Some 50 central works by van Gogh alongside 3 70 masterpieces by his German followers “Van Gogh is dead, but the van Gogh-chaps are alive! And how alive they MAKING VAN GOGH are! It is van Goghing everywhere”, was how Ferdinand Avenarius described Ed. Alexander Eiling, it in 1910 in the magazine Der Kunstwart. Vincent van Gogh’s paintings Felix Krämer exerted a particular fascination on young artists in Germany at the With the cooperation of Elena Schroll beginning of the twentieth century. Barely fifteen years after his death the Contributions by H. Bieder- Dutch artist was seen as one of the most important forerunners of modern mann, R. Dorn, E. Eiling, J. Kaak, painting. A selection of key works from all van Gogh’s creative phases are S. Koldehoff, F. Korn, F. Krämer, I. Schmeisser, E. Schroll juxtaposed with works by Max Beckmann, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Paula Modersohn-Becker, Gabriele Münter, Karl Schmidt- 336 pages, 304 colour illustrations Rottluff and others. 9 ¼ × 11 in, hardcover $ 60.00 978-3-7774-3298-4 November 2019 Exhibition Städel Museum, Frankfurt 10.23.2019 – 02.16.2020 7 Vincent van Gogh, The Poplars at Saint-Rémy, 1889, The Cleveland Museum of Art, Bequest of Leonard C. -
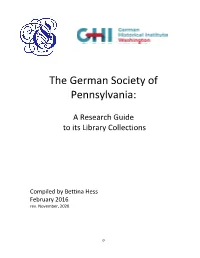
Research Guide to Its Library Collections
& The German Society of Pennsylvania: A Research Guide to its Library Collections Compiled by Bettina Hess February 2016 rev. November, 2020 0 Introduction p. 2 History and Brief Overview of the Collections p. 2 Books Main Collection p. 5 German American Collection p. 9 Carl Schurz Collection p. 30 Reference Collection p. 30 Pamphlets Main Collection p. 31 German American Collection p. 31 cataloged p. 31 uncataloged legal size boxes with call numbers p. 40 legal size boxes without call numbers p. 52 Carl Schurz Collection pamphlet box lists p. 54 Ephemera German American Collection Letter size boxes with call numbers p. 148 Letter size boxes without call numbers p. 163 Legal size boxes without call numbers p. 176 Manuscripts Mss. I Collections with finding aids p. 179 Collections with catalog entries p. 199 collections by size with inventories: Mss. IIa -- Letter size boxes p. 202 Mss. IIb -- Legal size boxes p. 207 Mss. III -- flat boxes (12 x 16 “) p. 210 Mss. IV -- flat boxes (14 x 18 “) p. 215 Mss. Oversize (20 x 24”) p. 219 Mss. Oversize Gallery (24 x 36”) p. 224 Minimally processed manuscript collections p. 228 Newspapers/Periodicals Newspapers on microfilm p. 292 German American imprints -- bound volumes p. 296 German imprints -- bound volumes p. 313 1 Introduction This research guide to the German Society of Pennsylvania’s Joseph Horner Memorial Library is an update to the original guide written by Kevin Ostoyich in 2006 (The German Society of Pennsylvania: A Guide to its Book and Manuscript Collections) and published by the German Historical Institute. -

Readings in the Anthropocene
v01umes m me series: Vol. 1. Improvisation as Art: Conceptual Challenges, Historical Perspectives by Edgar Landgraf Vol. 2. The German Pfcaro and Modernity: Between Underdog and Readings in the Shape-Shifter by Bernhard Malkmus Vol. 3. Citation and Precedent: Conjunctions and Disjunctions of German Anthropocene Law and Literature by Thomas 0. Beebee Vol. 4. Beyond Discontent: 'Sublimation' from Goethe to Lacan The Environmental Humanities, by Eckart Goebel German Studies, and Beyond Vol. 5. From Kafka to Sebald: Modernism and Narrative Form edited by Sabine Wilke VoL 6. Image in Outline: Reading Lou Andreas-Salome by Gisela Brinker-Gabler Vol. 7. Out of Place: German Realism, Displacement, and Modernity by John B. Lyon Edited by Vol. 8. Thomas Mann in English: A Study in Literary Translation Sabine Wilke and Japhet Johnstone by David Horton Vol. 9. The Tragedy of Fatherhood: King Laius and the Politics of Paternity in the West by Silke-Maria Weineck Vol. 10. The Poet as Phenomenologist: Rilke and the New Poems by Luke Fischer Vol. 11. The Laughter of the 71zracian Woman: A Protohistory of Theory by Hans Blumenberg, translated by Spencer Hawkins Vol. 12. Roma Voices in the German-Speaking World by Lorely French Vol. 13. Vienna's Dreams of Europe: Culture and Identity beyond the Nation-State by Katherine Arens Vol. 14. Thomas Mann and Shakespeare: Something Rich and Strange edited by Tobias Doring and Ewan Fernie Vol. 15. Goethe's Families of the Heart by Susan E. Gustafson Vol. 16. German Aesthetics: Fundamental Concepts from Baumgarten to Adorno edited by J. D. Mininger and Jason Michael Peck Bloomsbury Acadernic Vol.