"Eiserne Frauen"
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Harald Seeger Die Höhe Der Entschädigung Bemisst Sich Bei (Wandlitz) Spielern/Spielerinnen Der Älteren D-Junioren/ Der Am 18
Nr. 4 | 30. Juni 2015 § 3 Der Deutsche Fußball-Bund trauert um § 3 Nr. 2., Absatz 6, Satz 1 wird geändert: Harald Seeger Die Höhe der Entschädigung bemisst sich bei (Wandlitz) Spielern/Spielerinnen der älteren D-Junioren/ der am 18. Mai 2015 im Alter von 93 Jahren Juniorinnen bis zu den jüngeren AJunioren/ verstorben ist. jüngeren B-Juniorinnen nach einem Grundbetrag sowie einem Betrag pro angefangenem Spieljahr Der gebürtige Brandenburger arbeitete seit (Spieljahre in den Altersklassen der G-, F- und 1949 als Trainer und war ehemaliger Chef- E-Junioren/Juniorinnen werden nicht berück- trainer des 1. FC Union Berlin, wie auch sichtigt), in welchem der Junior/die Juniorin dem schon beim Vorgänger TSC Berlin. 1959 abgebenden Verein angehört hat. übernahm er das Training des damaligen DDR-Oberligisten ASK Vorwärts Berlin, den § 7c er 1960 und 1962 zur DDR-Meisterschaft führte. § 7c Nr. 1. d) wird neu gefasst: 1963 wechselte Harald Seeger zum Trainer- d) Der Verein muss mindestens drei Altersklas- stab des damaligen Fußball-Verbandes der sen der A-Junioren, B-, C- oder D-Junioren/ DDR. Zunächst war er für die Junioren- Juniorinnen mit jeweils mindestens einer auswahl verantwortlich, mit der er 1965 das Mannschaft besetzt haben. Er soll pro Alters- UEFA-Juniorenturnier gewann. 1967 wurde klasse höchstens über zwei Mannschaften ver- Harald Seeger Trainer der National-Aus- fügen. Nicht zugelassen sind Mannschaften wahlmannschaft, mit der er bis zum Ende älterer Altersklassen. Der Jugendförderverein des Jahres 1969 insgesamt 15 Länderspiele darf nicht Mitglied einer Spielgemeinschaft sein. absolvierte. 1972 beendete er beim 1. FC Union Berlin seine Trainer-Karriere. Änderungen des DFB-Statuts 3. -

Miniaturbroschuren
Teil 2: Miniaturbroschuren 1 ... der werfe den ersten Stein (Joh 8, 2-11), GIEBELER, H. bzw. SCHOLZ-BREZNAY, L. (Ill.). Stuttgart: Amt für missionarische Dienste der Evang. Landeskirche in Württemberg (Hrsg.). ca. 1985. 16 S. 93x100mm. Die große Einladung Heft 23 2 ... ei verbibscht - Sächsisch von A-Z, GEISS, HEIDE MARIE KARIN. München: Compact Verlag. 1991, 1992. 256 S. 55x60mm. Miniwörterbuch 3 ... Küß’ die Hand ... - Wienerisch von A-Z, SCHMIDT, NICOLE. München: Compact Verlag. 1991. 256 S. 55x60mm. Miniwörterbuch 4 ... und die beste Ehefrau von allen - Ein satirisches Geständnis, KISHON, EPHRAIM. Nürnberg: Vereinigte Papierwerke. 1981. 48 S. 70x100mm. Band 1 der Reihe »Edition C« 5 ... und ganz gewiß an jedem neuen Tag - Worte voll Hoffnung, Trost u. Zuversicht, BALDERS, GÜNTER (Hrsg.). Wuppertal und Kassel: Oncken Verlag. 1985, weitere Jahrgänge. 64 S. 60x85 +/–2mm. OnckenMiniBücher 6 ... und Gottes Segen, BALDERS, GÜNTER (Hrsg.). Wuppertal und Kassel: Oncken Verlag. 1992. 64 S. 60x85 +/–2mm. OnckenMiniBücher 7 's war ämal, VOIGT, LENE. München: Wilhelm Heyne Verlag. 1998. 128 S. 60x80mm. Heyne Mini 33/1390 8 1. Auftrag im All, CHILTON, IRMA. Hannover: Pelikan AG. 1981. 144 S. 50x70 +/–2mm. Tramp-Bücherei Science Fiction 9 1. FC Kaiserslautern, SCHRÖDER, ULFERT. Stuttgart: Ernst Klett Verlag. 1979. 48 S. 52x74mm. merky POCKET - merky-Fußball 10 1. FC Kaiserslautern - Saison 1949/50, [SPORTBILDHEFT]. Oldenburg: Gerhard Stalling AG. o.J. ca. 1950. 16 S. unpaginiert 53x75mm. Stalling-Sportbildhefte, Serie D: Südwestdeutsche (N) Oberliga 11 1. FC Kaiserslautern - Saison 1950/51, [SPORTBILDHEFT]. Oldenburg: Gerhard Stalling AG. o.J. ca. 1950. 16 S. unpaginiert 53x75mm. Stalling-Sportbildhefte, Serie D: Südwestdeutsche (N) Oberliga 12 1. -

Berliner Meisterschaft 1976 Und Aufstiegsrunde Zur 2. Bundesliga
Beilage zum Stadionblatt vom 22. Mai 2016 – Berliner Meisterschaft 1976 und Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 1 Beilage zum Stadionblatt vom 22. Mai 2016 – Berliner Meisterschaft 1976 und Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Vor 40 Jahren - Meister der Oberliga Berlin 1975/76 Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 2 Beilage zum Stadionblatt vom 22. Mai 2016 – Berliner Meisterschaft 1976 und Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Vor 40 Jahren – Halbfinale im Paul-Rusch-Pokal 1975/76 Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 3 Beilage zum Stadionblatt vom 22. Mai 2016 – Berliner Meisterschaft 1976 und Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Vor 40 Jahren - Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1976 Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 4 Beilage zum Stadionblatt vom 22. Mai 2016 – Berliner Meisterschaft 1976 und Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 5 Beilage zum Stadionblatt vom 12. Juni 2016 – Saison 1975/76 mit Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord 1975/76 – Oberliga Berlin - SC Union 06 17.08.1975 SC Staaken - SC Union 06 0:4 (0:2) 24.08.1975 SC Union 06 - SC Siemensstadt 0:1 (0:1) 31.08.1975 SC Union 06 - BBC Südost 3:0 (3:0) 07.09.1975 1.Traber FC - SC Union 06 0:4 (0:4) 14.09.1975 SC Union 06 - Hertha BSC Amateure 2:1 (0:1) 20.09.1975 Reinickendorfer Füchse - SC Union 06 0:3 (0:0) 05.10.1975 BFC Preußen - SC Union 06 1:1 (0:0) 18.10.1975 Polizei SV - SC Union 06 1:5 (0:3) 25.10.1975 SC Union 06 - Sp.Vg. -

Anpfiff&Tooor
3,50 € Schutzgebühr PGZ NRP KYR WIT Fußballkreis Ein Prignitz/Ruppin ANPFIFF&TOOOR Magazin der 15. AUGUST 2019 Märkischen Allgemeinen Großer Ausblick auf die Fußballsaison 2019/2020 Zeitung 2 Märkische Allgemeine Zeitung FUßBALLSAISON 2019/2020 Donnerstag, 15. August 2019 Von (A)lt Ruppin bis (Z)ernitz Für Fußballfans Brandenburgliga BoxSV Veritas Wittenberge / Lenzen/Lanz 25 MSV 1919 Neuruppin 3 Reckenziner SV / Pankower SV Rot-Weiß 26 SV Buckow 27 Landesliga Nord Wilsnack/Legde / Wittenberge/Breese II 28 Auf 40 Seiten dreht sich alles FK Hansa Wittstock 5 SV Rot-Weiß Gülitz / MTV Freyenstein 29 SV Schwarz-Rot Neustadt 6 SSV Einheit Perleberg 6 Kreisliga Ost um den Fußball in Prignitz/Ruppin Blau-Weiß Walsleben / Herzberger SV 30 Landesklasse West TSV Wustrau 31 SV Eintracht Alt Ruppin 7 SV 90 Fehrbellin / Blau-Weiß Rheinsberg 32 Liebe Fußballfans, Torjubel, SV Union Neuruppin 8 SV Dreetz / Gühlen-Glienicke/Rägelin 33 Überraschungssiege, knifflige Pritzwalker FHV 03 9 SG Linum / SV Protzen 34 FSV Veritas Wittenberge/Breese 10 SV 69 Schönberg 35 Abseitsentscheidungen – die Langener SV 10 TuS Wildberg / FC Dossow 36 Fußballsaison 2019/20 steht in SV Eintracht Alt Ruppin II 37 den Startlöchern. Die Kicker Kreisoberliga SV Prignitz Maulbeerwalde II 37 des Fußballkreises Prignitz/ MSV Neuruppin II / FC Wusterhausen 11 Zernitzer SV / SV Eiche 05 Weisen 12 Frauenfußball 35 / 38 Ruppin haben in den vergan- Meyenburger SV Wacker 13 Ansetzungen 2019/20 Stahl Wittstock / Schwarz-Weiß Zaatzke 14 genen Wochen hart an Fitness, Brandenburgliga 4 Spielzügen und Aufstellun- SV Union Neuruppin / SC Hertha Karstädt 15 Landesliga Nord 7 gen gearbeitet, um optimal in SV Garz/Hoppenrade / SV Demerthin 16 Landesklasse West 8 SV Blumenthal/Grabow 17 Rahmenspielplan Prignitz/Ruppin 13 die neue Spielzeit zu starten. -

Der SC Union 06 Berlin 1.FC Union Berlin
Benefizspiel - Sonntag, 18. Januar 2015, 13:00 Uhr - Poststadion - offizielle Vereinszeitschrift - 50 ct Benefizspiel - Sonntag, 18. Januar 2015, 13:00 Uhr - Poststadion - offizielle Vereinszeitschrift - 50 ct Wir danken unseren Sponsoren Der SC Union 06 Berlin empfängt den 1.FC Union Berlin Liebe Freunde des SC Union 06 Berlin, liebe Gäste! Wir begrüßen die Mannschaft des 1.FC Union Berlin und ihre Fans recht herzlich im Poststadion zum Freundschaftsspiel zur Vorbereitung auf die Rückrunde 2014/15 Die Mannschaft des SC Union 06 beim Hallenturnier der Landesliga Unsere Homepage www.scunion06-berlin.de Auf unserer Internetseite findet Ihr Spielberichte, Bilder und die neuesten Informationen zu allen Mannschaften des SC Union 06 sowie ein Diskussionsforum. Helft mit, schickt Spielberichte oder Verbesserungsvorschläge und aktuelle Infos, die auf der Seite veröffentlicht werden sollen, an: [email protected] Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 16 Layout, Inhalt: Frank Börner - Kontakt: [email protected] - Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25 - S. 1 Benefizspiel - Sonntag, 18. Januar 2015, 13:00 Uhr - Poststadion - offizielle Vereinszeitschrift - 50 ct Benefizspiel - Sonntag, 18. Januar 2015, 13:00 Uhr - Poststadion - offizielle Vereinszeitschrift - 50 ct In einem Kraftakt wurden für die Mitglieder Wohnungen und Arbeitsplätze besorgt. Am 9. Juni Vom Spielfeldrand gesehen 1950 schließlich konnte in den Räumen des Süd-Ost-Kasinos in der Schlesischen Straße die Gründung des "SC Union 06 Berlin" gefeiert werden. Nicht nur die 1. Mannschaft, sondern auch Liebe Unioner, liebe Gäste, ein Teil der Jugendmannschaften machten den Umzug mit, so dass der neue Verein bereits zur Gründung 120 Mitglieder hatte. -

Germany - Divisional Movements
Germany - Divisional Movements Aachen, NW Bornheim, NW Erlbach, BY Haltern am See, NW Aalen, BW Bottrop, NW Erlenbach am Main, BY Hamburg, HH Abtswind, BY Brandenburg an der Havel, BB Erndtebrück, NW Hameln, NI Achern, BW Braunschweig, NI Eschborn, HE Hamm, NW Achim, NI Bremen, HB Essen, NW Hanau, HE Ahlen, NW Bremerhaven, HB Euskirchen, NW Hannover, NI Albstadt, BW Brieselang, BB Eutin, SH Hartenholm, SH Aldenhoven, NW Buchbach, BY Feucht, BY Haßfurt, BY Alfter, NW Buchholz in der Nordheide, NI Flensburg, SH Hattersheim am Main, HE Altenholz, SH Bückeburg, NI Flieden, HE Hauenstein, RP Alzenau, BY Burgbrohl, RP Forchheim, BY Heeslingen, NI Amberg, BY Burghaun, HE Frankenthal, RP Heide (Holstein), SH Ammerthal, BY Burghausen, BY Frankfurt/Main, HE Heidelberg, BW Andernach, RP Burglengenfeld, BY Frankfurt/Oder, BB Heidenheim an der Brenz, BW Ansbach, BY Bürstadt, HE Frechen, NW Heilbronn, BW Aschaffenburg, BY Buxtehude, NI Freiberg am Neckar, BW Heikendorf, SH Aspach, BW Celle, NI Freiburg, BW Helmbrechts, BY Aubstadt, BY Cham, BY Friedberg, HE Hennef, NW Aue, SN Chemnitz, SN Friedrichshafen, BW Henstedt-Ulzburg, SH Auerbach, SN Cloppenburg, NI Friedrichsthal, SL Herford, NW Augsburg, BY Cottbus, BB Frohnlach, BY Herne, NW Backnang, BW Dachau, BY Fulda, HE Herxheim bei Landau, RP Bad Kreuznach, RP Darmstadt, HE Fürstenwalde/Spree, BB Herzlake, NI Bad Vilbel, HE Dassendorf, SH Fürth, BY Hilden, NW Baesweiler, NW Delmenhorst, NI Gaggenau, BW Hildesheim, NI Bahlingen, BW Dillingen/Saar, SL Garbsen, NI Hof, BY Balingen, BW Dinslaken, NW Garching, -

Stalling-Sportbildhefte Saison 1945/50 Und Saison 1950/51 Gerhard Stalling AG Abteilung Sportverlag Blatt 1
Deutschsprachige Miniaturbroschur-Reihen Stalling-Sportbildhefte Saison 1945/50 und Saison 1950/51 Gerhard Stalling AG Abteilung Sportverlag Blatt 1 Stalling-Sportbildhefte Saison 1949/50 und Saison 1950/51 Verlag: Gerhard Stalling AG Herausgeber: Abteilung Sportverlag Ausgabeort: Oldenburg Ausgabejahre: o. J. ca. 1950 Seiten: 16 nicht nummeriert Format: 53 x 75 mm Einband: Papier, jedes Heft hat andere Farbgebung ISBN: Ohne Gliederung: Die Reihung der Titel folgt der vom Verlag gewählten Reihenfolge. Zur Reihe: In den Exemplaren bewirbt der Verlag die Reihe wie folgt: „Neueste, wertvolle Bilddokumente des In - und Auslandssports. Als erstes Sammelwerk erscheint: „Die deutsche Fußball-Oberliga“ (je Mannschaft ein Heft) Serie A: Norddeutsche Oberliga Serie B: Westdeutsche Oberliga Serie C: Süddeutsche Oberliga Serie D: Südwestdeutsche Oberliga Serie E: Berliner Stadtliga Serie F: Ostdeutsche Oberliga Sammelwerke für andere Sportarten und für den Auslandssport folgen. Stalling-Sportbildhefte erscheinen in bunter Folge zum Preise von nur 10 Pf. je Heft. Sie sind in den Verkaufsstellen des Zeitschriftenhandels sowie in Papier- und Schreibwarengeschäften erhältlich. Für jedes abgeschlossene Sammelwerk werden geschmackvoll ausgeführte Einsteckalben herausgegeben.“ Quellennachweis: Miniaturbuchsammlung Elke und Walter Staufenbiel, Dresden Verlagsangaben Deutschsprachige Miniaturbroschur-Reihen Stalling-Sportbildhefte Saison 1945/50 und Saison 1950/51 Gerhard Stalling AG Abteilung Sportverlag Blatt 2 Serie A: Norddeutsche Oberliga 1. Hamburger SV Saison 1949/50 (Heft Nr. 1) Saison 1950/51 (Heft Nr.?) 2. FC St. Pauli Saison 1949/50 (Heft Nr. 2) Saison 1950/51 (Heft Nr.?) 3. VFL Osnabrück Saison 1949/50 (Heft Nr. 3) Saison 1950/51 (Heft Nr.?) 4. Werder Bremen Saison 1949/50 (Heft Nr. ?) Saison 1950/51 (Heft Nr. ?) 5. Eintracht Braunschweig Saison 1949/50 (Heft Nr. -

Doppelinterview Mit 98Ern LOTTO Hessenliga Inklusion in Kreisliga
HESSEN- FUSSBALL Monatsmagazin des Hessischen Fußball-Verbandes e. V. – 8/2015 | www.hfv-online.de DDoppelinterviewoppelinterview mmitit 998ern8ern LLOTTOOTTO HessenligaHessenliga IInklusionnklusion iinn KKreisligareisliga Unsere Amateure. Echte Profi s. Nach dem Spiel ist vor dem Genuss. Wir wünschen allen Mannschaften viel Erfolg im Krombacher Pokal. HESSEN-FUSSBALL 8/2015 3 Inhalt LOTTO Hessenliga . 4 Mit Beginn der neuen Spielsaison konnte der Hessische Fußball-Verband mit LOTTO Hessen seinen neuen Ligasponsor präsentieren. Die Partnerschaft bringt zahlreiche Vorteile für Liga, Mannschaften und Fans. Start der LOTTO Hessenliga . 5 Gleich zu Beginn der aktuellen Spielzeit lockte das Derby Borussia Fulda gegen den TSV Lehnerz Zuschauermassen ins Stadion. Inklusion in der Kreisliga . 6 Liebe Die frühere Nationalspielerin Pia Wunderlich trainiert eine Mannschaft, deren Spieler fast alle Fußballfreunde, Mitglieder des Behindertenwerks Main-Kinzig sind. Die Mannschaft nimmt am Ligaalltag teil. der Ball rollt wieder! Abgesehen von unseren beiden Erstligisten Eintracht Frankfurt und SV Darmstadt 98 sind viele Ligen bereits Kilianstädten läuft mit Polen ein . 7 an den Start gegangen oder gerade im Begriff darin. Darunter ist Die F-Junioren des SV Kilianstädten haben beim HFV-Gewinnspiel elf Einlaufkids-Plätze für den auch die höchste Liga unseres Hessischen Fußball-Verbandes, die Länderspielknüller Deutschland gegen Polen LOTTO Hessenliga. Wir sind froh und stolz, dass wir mit LOTTO am 4. September in Frankfurt gewonnen. Hessen eine Namenspartnerschaft für diese Liga eingehen konnten und können diese dadurch erhaltenen Mittel sofort an Neuer Marketingmitarbeiter . 9 die teilnehmenden Vereine zurückgeben, unter anderem durch Tobias Leistner kümmert sich um die Vermarktung die Videopräsentationen im Internet, wo jede Partie als Spiel- des Hessischen Fußball-Verbandes. -
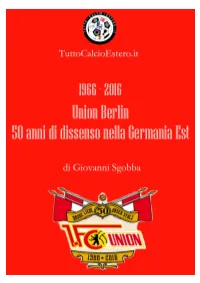
PDF-Union-Berlin-Definitivo.Pdf
INDICE: Introduzione pg. 2 Capitolo 1 - Gli anni ‘60: la nascita del club - 1.1 - La nascita del nome e il primo memorabile gol in Oberliga pg. 4 - 1.2 - Storia di un logo atipico pg. 6 - 1.3 - “Eisern Union!”, il primo inno ufficiale pg. 7 - 1.4 - La rivista del club “Union-Informationen” pg. 8 - 1.5 - La prima coppa non si scorda mai pg. 12 - 1.6 - Il sogno di giocare in Europa frantumato dai carri russi nella Primavera di Praga pg. 14 Capitolo 2 - Le sfide con le rivali di sempre: Dynamo Berlin, Dresden, Hertha e RB Leipzig - 2.1 - L’impresa del ‘76. I derby vinti contro la squadra del potere pg. 14 - 2.2 - Il “miracolo del fiume Elba” contro il Dynamo Dresda pg. 16 - 2.3 - Hertha-Union, il derby degli amici separati dal filo spinato pg. 17 - 2.4 - 40 anni di soprusi della Dynamo spazzati via con un 8-0 pg. 20 - 2.5 - 5 febbraio 2011, quando l’Union cambiò la storia del derby di Berlino pg. 21 - 2.6 - La protesta contro il RB Leipzig e la morte del calcio autentico pg. 23 Capitolo 3 - Dopo la caduta del Muro e gli anni 2000 - 3.1 - Ribellione post-muro: la prima maglia con uno sponsor pg. 25 - 3.2 - C’era una volta l’Union Berlino in finale di Coppa… pg. 26 - 3.3 - Il debutto in Coppa Uefa tanto sognato pg. 28 - 3.4 - Perché l’Alte Försterei è al 50° posto tra gli stadi più belli del mondo? pg. -

2020 21 Stadionheft Vs SSC Sdwest
1. Hauptrunde AOK-Pokal, Sonntag, 13. September 2020, Lichtplatz im Sportpark Poststadion, 15:00 Uhr 1. Hauptrunde AOK-Pokal, Sonntag, 13. September 2020, Lichtplatz im Sportpark Poststadion, 15:00 Uhr Wir danken unseren Sponsoren Der SC Union 06 Berlin empfängt den Steglitzer SC Südwest Liebe Freunde des SC Union 06 Berlin, liebe Gäste! Wir begrüßen die Mannschaft des Steglitzer SC Südwest und ihre Fans recht herzlich auf dem Lichtplatz im Sportpark Poststadion zum Pokalspiel im Landespokal Berlin 2020/21 Unsere Homepage www.scunion06-berlin.de Layout, Inhalt: Frank Börner, Kontakt: [email protected], Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25, Seite 4 von 4 Layout, Inhalt: Frank Börner, Kontakt: [email protected], Tel. Geschäftstelle: 030-394 45 25, Seite 1 von 4 1. Hauptrunde AOK-Pokal, Sonntag, 13. September 2020, Lichtplatz im Sportpark Poststadion, 15:00 Uhr 1. Hauptrunde AOK-Pokal, Sonntag, 13. September 2020, Lichtplatz im Sportpark Poststadion, 15:00 Uhr SC Union 06 – Team für die Saison 2020/21 – Bezirksliga Bezirksliga, 3. Abteilung, 1. Spieltag 2020/21, 6. September 2020 Nr. Name Vorname geb. Neuzugang von SC Union 06 FSV Fortuna Pankow 3:2 - Abugrain Owais 19.09.2000 SC Gatow II Grünauer BC 0:3 DJK Schwarz-Weiß Neukölln TSV Lichtenberg 8:0 99 Ilgin Tolga 30.04.1996 BFC Meteor 06 SC Schwarz-Weiß Spandau BSC Rehberge 1:1 1 Kadiri Mohamed 31.12.1991 SV Lichtenberg 47 II BSV Oranke 19.09. 14 Adjei Jeremy 07.04.1999 SV Altlüdersdorf BSC Marzahn SV Buchholz 20.09. 2 Dietze Mark 03.09.1995 SC Gatow SG Blankenburg BFC Preussen II 20.09. -

WIR WERDEN EWIG LEBEN Meine Unglaubliche Saison Mit Dem 1
Christoph Biermann WIR WERDEN EWIG LEBEN Meine unglaubliche Saison mit dem 1. FC Union Berlin Kiepenheuer & Witsch Aus Verantwortung für die Umwelt hat sich der Verlag Kiepenheuer & Witsch zu einer nachhaltigen Buchproduktion verpflichtet. Der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen, der Schutz unseres Klimas und der Natur gehören zu unseren obersten Unternehmenszielen. Gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten setzen wir uns für eine klimaneutrale Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten zur Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.klimaneutralerverlag.de Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512 1. Auflage 2020 © 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln Covermotiv: Vorderseite: © Sebastian Wells / OSTKREUZ; Rückseite: © Matthias Koch Gesetzt aus der Minion Pro und Brandon Grotesque Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-462-00111-2 Mein Leben als Hochstapler Als ich am 1. August 2019, morgens um neun Uhr, in einem kurzärmeligen schwarzen Poloshirt mit dem Vereinswappen des 1. FC Union Berlin, schwarzen Sportshorts und himbeerfarbenen Joggingschuhen vor der Mannschaft stehe, komme ich mir vor wie einer dieser Neuzugänge, von denen vor Saisonbeginn immer ge- redet wird, aber niemand weiß, ob sie wirklich kommen. Mein Transfer in diesen Raum hat einige Wochen gedauert, hat etlicher Gespräche, interner Diskussionen und schlicht Bedenkzeit bedurft. Doch nun bin ich da und stehe vor den Spielern des 1. FC Union Berlin, dessen erste Saison in der Bundesliga bald beginnen wird. Ich sehe Neven Subotic, der Deutscher Meister mit Borussia Dort- mund war und in einem Finale der Champions League gespielt hat. -
![[FONT="Lucida Sans Unicode"][SIZE](https://docslib.b-cdn.net/cover/5313/font-lucida-sans-unicode-size-7095313.webp)
[FONT="Lucida Sans Unicode"][SIZE
Season 1971-72 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach Manager: Egon Piechaczek (b. 16.11.1931), from 28 January 1972 Jan Notermans (b. 29.07.1932) Managers: Hans Weisweiler (b. 05.12.1919) Goalkeepers: Goalkeepers: Burdenski, Dieter (b. 26.11.1950), *1971, formerly FC Schalke 04 Kleff, Wolfgang (b. 16.11.1946), 1 A, *1968, formerly VfL Schwerte Siese, Gerhard (b. 05.01.1944), *1961, formerly Eintracht Bielefeld Schrage, Bernd (b. 12.09.1951), *1970, formerly RW Hünsborn Quasten, Gregor (b. 03.10.1952), *1971, formerly PSV Mönchengladbach Defenders: Schulz, Dieter (b. 17.05.1939), *1960, formerly VfB 03 Bielefeld Defenders: Wenzel, Horst (b. 02.03.1944), *1969, formerly VfB Lübeck Michallik, Heinz (b. 21.07.1947), *1971, formerly DJK Gütersloh Klein, Volker (b. 11.04.1949), *1970, formerly 1. FC Kaiserslautern Müller, Ludwig (b. 25.08.1941), 6 A, *1969, formerly 1. FC Nürnberg, 1. FC Hassfurt Kasperski, Gerhard (b. 15.12.1949), *1971, formerly Preussen Münster, FC Schalke 04, SW Essen Wittkamp, Hans-Jürgen (b. 23.07.1947), *1971, formerly FC Schalke 04, SpVg Herten, VfL Resse 08 Slomiany, Waldemar (b. 01.01.1943), 1 A Poland, *1970, formerly FC Schalke 04, Gornik Zabrze Surau, Ulrich (b. 19.08.1952), *1971, formerly Alemannia Aachen Stürz, Georg (b. 19.03.1944), *1965, formerly Meinerzhagen, Hervest-Drosten Bleidick, Hartwig (b. 26.12.1944), 2 A, *1968, formerly Soester SV Loof, Peter (b. 23.09.1947), *1971, formerly Hannover 96, BSV Bad Herzburg Vogts, Hans-Hubert (b. 30.12.1946), 40 A, *1965, formerly VfR Büttgen Kosmann, Rolf (b. 17.05.1953), *1971, formerly Tus Jöllenbeck Sieloff, Klaus-Dieter (b.27.02.1942), 14 A, *1969, formerly VfB Stuttgart, FV 08 Rottweil Wittmann, Heinz (12.09.1943), *1965, formerly SC Zwiesel Midfield: Braun, Ullrich (b.