Der Niedergang Der Regionalen Studiencesar N. Caviedes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2/1-Spaltig, Ohne Einrückungen
Der Nachlass von Wilhelm Lauer im Archiv des Geographischen Instituts Bonn Findbuch bearbeitet von Sabine KROLL und Jens Peter MÜLLER 2., um Nachträge erweiterte Fassung Bonn 2019 Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................................. II Vorwort .................................................................................................................................................... III Zur Biographie von Wilhelm Lauer ...................................................................................................... III Hinweise zum Nachlass Lauer und zur Benutzung ............................................................................. III 1 Lebensdokumente von Wilhelm Lauer .................................................................................................. 5 1.1 Privater und gesellschaftlicher Bereich .......................................................................................... 5 1.2 Beruflicher Bereich ......................................................................................................................... 6 1.2.1 Wilhelm Lauer als Wissenschaftler ......................................................................................... 6 1.2.2. Wilhelm Lauer in Leitungsfunktionen ................................................................................... 16 1.2.3 Wilhelm Lauer als Gutachter ................................................................................................ -

Der Nationalsozialismus Und Lateinamerika Institutionen – Repräsentationen – Wissenskonstrukte I
Sandra Carreras (Hrsg.) Der Nationalsozialismus und Lateinamerika Institutionen – Repräsentationen – Wissenskonstrukte I Ibero-Online.de / Heft 3, I IBERO-ONLINE.DE El Instituto Ibero-Americano Fundación Patrimonio Cultural Prusiano es un centro interdisciplinario que se dedica al intercambio científico y cultural con América Latina, España y Portugal. Alberga la mayor biblioteca especializada en Europa en cuanto al ámbito cultural iberoamericano. Asimismo, es un lugar de investigación extrauniversitaria, y tiene como objetivo la intensificación del diálogo entre Ale- mania e Ibero-América. En la serie IBERO-ONLINE.DE se publican textos provenientes de conferen- cias y simposios llevados a cabo en el Instituto Ibero-Americano. La serie se pro- pone difundir los resultados de las actividades científicas del Instituto más allá del contexto local. Las publicaciones de la serie IBERO-ONLINE.DE se pueden bajar en formato PDF de la página web del Instituto: <http://www.ibero-online.de>. A pedido especial, los textos de la serie también pueden ser publicados en versión impresa. Das Ibero-Amerikanische Institut PK(IAI) ist ein Disziplinen übergreifend konzi- piertes Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit sowie des akademischen und kultu- rellen Austauschs mit Lateinamerika, Spanien und Portugal. Es beherbergt die größte europäische Spezialbibliothek für den ibero-amerikanischen Kulturraum, zugleich die drittgrößte auf diesen Bereich spezialisierte Bibliothek weltweit. Gleichzeitig erfüllt das IAI eine Funktion als Stätte der außeruniversitären wissen- schaftlichen Forschung sowie als Forum des Dialogs zwischen Deutschland, Euro- pa und Ibero-Amerika. In der Reihe IBERO-ONLINE.DE werden in loser Folge Texte auf der Grund- lage von Vorträgen und Symposien veröffentlicht, die am Ibero-Amerikanischen Institut PK stattgefunden haben. -

Annotated Bibliography
1 Uxmal, Kabah, Sayil, and Labná http://academic.reed.edu/uxmal/ return to Annotated Bibliography Architecture, Restoration, and Imaging of the Maya Cities of UXMAL, KABAH, SAYIL, AND LABNÁ The Puuc Region, Yucatán, México Charles Rhyne Reed College Annotated Bibliography Title This is not a general Maya bibliograpjy. Like this web site as a whole, it focuses on the architecture of Uxmal, Kabah, Sayil, and Labná, and on their restoraton and graphic imaging. Where a book contains chapters with different titles by different authors, one or more of these chapters may be listed separately under the title of the chapter, with its own annotation. A Reindel, Markus “El abandono de las ciudades puuc en el norte d Yucatán”. 50 años de estudios americanistas en la Universidad de Bonn: Nuevas contribuciones a la arqueología, etnohistoria, etnolingüistica y etnografia de las Américas, ed. Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz, et al.: 239-258. Markt Schwaben: Verlag Anton Saurwein, 1998. 2 Finney, Ben R. “L’Abbé Brasseur de Bourbourg and Désiré Charnay.” Unpublished paper. Cambridge, MA: Harvard university, 1960. Sáenz Vargas, César A. “El adoratorio central, palacio del gobernador, Uxmal”. Revista Tlatoani. Period 1, Nos. 5-6: 45-50. México, D.F.: Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 1952. Photographs of the Governor’s Palace, Uxmal, are reproduced on this web site. http://academic.reed.edu/uxmal/galleries/thumbnails/uxmal/uxmal-govpalace.htm Ochoa, Lorenzo “Alberto Ruz Lhuillier”. La antropología en México: Panorama histórico, 11. Los protagonistas: 395-404. México, D.F.: Colección Biblioteca del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1988. A brief, authoritative review of the professional life of Ruz Lhuiller (1906-1979), his publications, academic positions, theoretical approaches to archaeology and Maya culture, and his professional and public acclaim. -

Terms of Racial Endearment: Nazi Categorization of Mennonites in Ideology and Practice, 1929–1945
Terms of Racial Endearment: Nazi Categorization of Mennonites in Ideology and Practice, 1929–1945 Benjamin W. Goossen ABSTRACT The Christian Mennonite denomination maintained a privileged position within National Socialist thought and policy through its conceptual and legal association with an evolving series of racial categories. Nearly all the world’s half-million Mennonites lived outside German borders between the World Wars. This allowed a small number of church leaders and sympathetic scholars to shape their image within Germany, especially as Hitler’s wartime expansionism brought a fourth of the denomination’s members under Nazi rule. Casting Mennonitism as part of one or more subgroups within a larger Germanic whole benefitted most adherents in regions administered by the Third Reich while simultaneously enabling their enrollment in propaganda and empire building. In November 1929, the Nazi Party organ, Völkischer Beobachter, carried a front-page article entitled “The Death of the German Farmer Community in Soviet Russia.” Authored by Alfred Rosenberg, the editor and National Socialist ideologue who had led the party while Hitler was in prison, it outlined the plight of some 13,000 German-speaking refugees from Stalinization who, encamped in Moscow, sought escape from the Soviet Union to Germany. For Rosenberg, the crisis symbolized a world-historic clash between what he called Judeo-Bolshevism and the German race. “Bolshevism is a comrade of the Jewish efforts to destroy the entire Germanic world,” Rosenberg wrote. “The National Socialist movement recognized this danger from the beginning and built that into its essence; the extermination of the despairing German farmers in Soviet Russia gives opportunity to sharpen this recognition anew.”1 Penned shortly before the appearance of Rosenberg’s bestselling book, Der Mythus des 20. -

SFB 5 Resourcecultures.Indb
Anke K. Scholz, Martin Bartelheim, Roland Hardenberg and Jörn Staecker (Eds.) ResourceCultures Sociocultural Dynamics and the Use of Resources – Theories, Methods, Perspectives r s C u e TS M N O B . E V M E . A P M O E L N S E u so rc T V e e s S E R a R D e s c s o u r c e r a t l i C. c s i VA S l a LUATION f t n i o o n C RessourcenKulturen Band 5 ResourceCultures rk RessourcenKulturen Band 5 Anke K. Scholz, Martin Bartelheim, Roland Hardenberg, and Jörn Staecker (Eds.) ResourceCultures Sociocultural Dynamics and the Use of Resources – Theories, Methods, Perspectives Tübingen 2017 Peer Review: The papers published in this volume were subject to an anonymous international peer review. Cover Picture: The structure of SFB 1070 using a rotary model (Graphic: SFB 1070). The publication of this text is licensed under the terms of the Creative Commons BY-NC 3.0 DE license. The full legal code is available at https:// creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/. Illustrations are not part of the CC license, the copyright is with their authors, if not otherwise specified. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Universität Tübingen und die Autoren Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-946552-08-6 http://hdl.handle.net/10900/74124 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-dspace-741243 http://dx.doi.org/10.15496/publikation-15530 Redaktion: Uwe Müller, Marion Etzel, Henrike Michelau, Jadranka Verdonkschot Layout: Büro für Design, Martin Emrich, Lemgo Gestaltung und Druckvorstufe: Henrike Michelau Druck: Pro BUSINESS digital printing Deutschland GmbH Printed in Germany Contents Editors’ Preface ................................................................................ -

The Cultural Approach – by Caroline Ware
"^' v wj.j. $4^50 to history. Thfcultural approach 907.1 W27c 59-10603 Ware $4.50 The cultural approach to history. KANSAS CITY. MO. PUBLIC LIBRARY D DDD1 SOUTHWEST THE CULTURAL APPROACH TO HISTORY THE CULTURAL APPROACH TO HISTORY Edited for the American Historical Association By CAROLINE F. WARE Mew Tork: Morningside Heights COLUMBIA UNIVERSITY PRESS 1940 COPYRIGHT 1940 COLUMBIA UNIVERSITY PRESS, NEW YORK FOREIGN AGENTS: Oxford University Press, Humphrey Milford, Amen House, London, E. C. 4, England, and B. I. Building, Nicol Road, Bombay, India; Maruzen Company, Ltd., 6 Nihonbashi, Tori-Nichome, Tokyo, Japan MANUFACTURED IN THE UNITED STATES OF AMERICA PREFACE .FIRST credit for this volume belongs to Eugene N. Anderson, who, as chairman of the Program Committee for the American His- torical Association meetings in December, 1939, was mainly respon- sible for planning the sessions at which the papers constituting this volume were presented. In addition to Mr. Anderson, the following members of the Program Committee and others outside of the Com- mittee were responsible for arranging the particular sessions at which the papers here included were given: Merle Curti, Psychol- ogy and History; Carlton C. Qualey, Nationality Groups in the United States; Philip E. Mosely, The Peasant Family; Ralph E. Turner, The Industrial City; Paul Lewinson, The Corporation an Institutional Factor in Modern History; Wayne Grover, Land Power and Sea Power; Walter F. Dorn, Liberalism; Edgar N. Johnson, Medieval Culture, Ecclesiastical or Secular?; Viola F. Barnes and Ralph H. Gabriel, How Explain the "Flowering of New England"?; Louis C. Hunter, Local History, and Population Studies and History; Ben A. -
2 Artigo KOHLHEPP, Gerd
REVISTA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL , ISSN 2317-5443, DOI: 10.7867/2317-5443.2013 V1N2P029-075 © 2013 PPGDR/U NIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU WWW .FURB .BR /RBDR A importância de Leo Waibel para a geografia brasileira e o início das relações científicas entre o Brasil e a Alemanha no campo da geografia Gerd Kohlhepp Instituto de Geografia da Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemanha Recebido: 04/02/2013 Versão revisada (entregue): 29/11/2013 Aprovado: 03/12/2013 Resumo O tema deste artigo é a relevância do geógrafo alemão Leo Waibel para a geografia brasileira. Nascido em fins do século XIX, Waibel teve uma trajetória acadêmica singular. Doutorou-se, sob a orientação de Alfred Hettner, na prestigiosa Universidade de Heidelberg. Obteve sua livre-docência na Universidade de Köln. E suas atividades profissionais, ele as iniciou, como docente – e diretor do Instituto de Geografia – em 1926 na Universidade de Kiel e desde 1929 na Universidade de Bonn. Embora a geografia física recebesse suas primeiras atenções, a contribuição que daria para a geografia humana, especialmente, para a geografia econômica, acabaria ganhando grande evidência. E o que aqui é de importância: o seu objeto privilegiado de estudos viria a ser a geografia dos trópicos. Em face da realidade política vivida pela Alemanha na época, Leo Waibel (como também aconteceria com inúmeros outros pesquisadores daquele país) foi demitido em julho de 1937 e proibido de exercer quaisquer funções em universidades alemãs. Por isso, em 1939 transferiu-se para os Estados Unidos. Mas, em 1946 mudaria para o Brasil, onde permaneceria até 1950. É a passagem de Waibel pelo país nesse período que será examinada nas páginas do presente artigo, destacando-se sua contribuição para o início das relações científicas entre o Brasil e a Alemanha no campo da geografia. -
Oskar Schmieder, Un Geografo Hispanista Y Americanista
Oskar Schmieder, un geografo hispanista y americanista por JURGEN BAHR* y ELISABETH DILLNER** Palabras clave: América del Norte; Geografia alemana (siglo XX); Geografia regional; Espa- tia; Iberoamérica; Pampa; Schmieder, Oskar. El 12 de febrero de 1980 murio, pocos dias después de haber cumplido 10s 89 años de edad, Oskar Schmieder, catedratico y doctor en Geografia. La ciencia geo- grafica ha perdido con 61 a un erudit0 sabio que adquirió universal prestigio y consi- deración, gracias a sus investigaciones geograficas regionales en el Viejo y Nuevo Mundo y a su constante y eficaz labor pedagogica, en universidades alemanas y ex- tranjeras. Mas que ningún otro geógrafo de su generación, Schmieder pas6 una gran parte de su vida en Ultramar: durante casi trece años fue maestro de diferentes uni- versidades en América del Norte y del Sur. Por ello, insistiremos con especial énfa- sis, en el presente articulo, en sus trabajos en Iberoamérica. Cuando en 1930 Schmieder fue llamado a desempeñar una catedra de su especia- lidad en la Universidad de Kiel, Alemania, como sucesor de Leo Waibel, ya tenia la experiencia de una estancia de once largos años en el Nuevo Mundo dedicados a la ciencia y coronados con extraordinari0 éxito. Ocupo hasta 1956, fecha en que se ju- bilo, 10s cargos de catedratico y director del Instituto de Geografia de la Christian- Albrechts-Universitat de Kiel. Schmieder nació en el año 1891 en Bonn-Benel, donde paso su niñez, y mas tarde se dedico al estudio de las materias de Geografia, Geologia y Botanica en las univer- sidades alemanas de Konigsberg, Bonn y Heidelberg. -

Hilgard O'reilly Sternberg, Um Pioneiro Nas Pesquisas Das
Hilgard O’Reilly Sternberg, um Pioneiro nas Pesquisas das Questões Ambientais no Brasili Hilgard O’Reilly Sternberg, a Pioneer in Research on Environmental Issues in Brazil Gerd Kohlheppii Universidade de Tübingen Tübingen, Alemanha Resumo: No final dos anos 1930 surgiu no Brasil a primeira geração de geógrafos for- mados no país; no entanto, caso quisessem cursar uma pós-graduação tinham que ir para a Europa ou os Estados Unidos, uma situação que perdurou até a década de 1960. Entre esses pioneiros encontrava-se Hilgard O’Reilly Sternberg, que assumiu a Cátedra de Geografia do Brasil na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro e, mais tarde, o car- go de Vice-Presidente da UGI, impulsionando a interligação internacional da geografia brasileira. Paralelamente a seus outros focos de pesquisa, O’Reilly Sternberg foi um dos representantes mais excepcionais da pesquisa sobre as condições naturais e humanas das regiões das florestas tropicais da Amazônia. Ele reconheceu que somente através do método holístico seria possível a pesquisa sobre os conflitos homem-meio ambiente existentes do Brasil. A partir de 1964, em Berkeley, Califórnia, O’Reilly Sternberg criou as bases para uma pesquisa fundamental, a avaliação das possibilidades de um desen- volvimento regional sustentável no Brasil, com a inclusão do know-how da população da região de modo a garantir a identidade regional diante da influência do planejamento regional estatal mal orientado e da globalização. Com alta perícia especializada, ética científica e consciência crítica, ele contribuiu para o reconhecimento e renome interna- cional da pesquisa geográfica brasileira. Palavras-chave: Hilgard O’Reilly Sternberg; Centro de Pesquisas de Geografia do Brasil da UFRJ; Universidade de Califórnia em Berkeley, EUA; Geografia do Brasil, Amazônia. -
Chosen Nation Goossen 1 Bibliography Archival Material
Chosen Nation Goossen Bibliography for Benjamin W. Goossen, Chosen Nation: Mennonites and Germany in a Global Era (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017). Bibliography Archival Material Archiv der Kolonie Fernheim, Filadelfia, Paraguay B.H. Unruh, Deutschland Dokumente G.S. Klassen Letters Information zur Völkischen Bewegung Nachlaß Dr. F. Kliewer Archiv der Kolonie Menno, Loma Plata, Paraguay Briefe (Walter Quiring u.a.) Chacokrieg Chortitzer Komitee Die Chaco-Expedition Fürsorge Komitee Gesetz Nr. 514 und Gesetz Nr. 914 M.C.C. Mission in Menno Archiv des Schweizerischen Vereins für Täufergeschichte, Basel, Switzerland Uncatalogued Documents Archives Nationales, Pierrefitte-sur-Seine, France AJ/43 (Organisation internationale pour les réfugiés) 31 (Emigration de réfugiés mennonites venant de Europe, février 1946- mars 1947) 49 (Eligibilité des Mennonites, décembre 1946-août 1947) 51 (Régles concernant l’éligibilité: Albanais, Autrichiens, Bulgares, Tchécoslovaques, Estoniens, Allemands, Hongrois, Italiens, Juifs, Lettons, Lituaniens, Mennonites, Polonais, Roumains, Russes 1 Chosen Nation Goossen républicains espagnols, Turcs, Ukrainiens, Yougoslaves, 1946- 1947) 93 (Correspondance avec le Comité central mennonite, mai 1951-janvier 1952) 265 (Mouvements de Mennonites vers le Paraguay et l’Uruguay, janvier 1948-janvier 1952) 293 (Mouvements de Mennonites, décembre 1947-août 1948) 462 (Groupes de réfugiés) 557 (Mouvements de Mennonites vers l’Amérique du Sud, avril 1951- mai 1952) 566 (Mennonites, 1946-1947) 572 (Volksdeutsche, juillet 1947-août 1951) 978 (Eligibilité des Tchèques, Mennonites, Baltes, Hongrois, 1948-1951) 1071 (Infiltration mennonite aux Pays-Bas, 1946-1951) 1177 (Mennonites) Archiwum Państwowe w Gdańsku, Gdańsk, Poland Syg. 9 (Regierung Danzig 1816-1944) Syg. 635 (Stogi/Heubuden) Auswärtiges Amt, Berlin, Germany R 60/478 (Verband d. -

Gerd Kohlhepp E As Heranças Da Geografia Alemã Para Os Estudos De Colonização E Desenvolvimento No Brasil
Gerd Kohlhepp e as heranças da geografia alemã para os estudos de colonização e desenvolvimento no Brasil Entrevista: Entrevista com o geógrafo alemão Gerd Kohlhepp1 concedida ao Editor Chefe de HALAC, Prof. Sandro Dutra e Silva2 (Anápolis, Goiás, Brasil, em 24 de outubro de 2018), com introdução de Stephen Bell3. esde muito tempo que eu nutro um profundo e pessoal envolvimento com a geografia histórica do sul e centro-sul do Brasil. Após o meu primeiro D encontro com o Prof. Sandro Dutra e Silva em Portugal no ano de 2014 – em decorrência da Segunda Conferência Mundial de História Ambiental, realizada na cidade de Guimarães –, tive a oportunidade de visitar Goiás naquele mesmo ano a convite dele. Em Anápolis eu pude reconhecer, particularmente, mas de maneira visceral, o quanto o geógrafo alemão Leo Waibel conseguiu transmitir as características distintas da geografia e das paisagens do centro-oeste brasileiro, 1 Dr. Phil in Geography, University of Heidelberg, Germany. Professor Emeritus, University of Tübingen, Germany. ORCID: https://orcid.org/0000- 0001-5087-2462. [email protected] 2 PhD in History, University of Brasília, Brazil. Professor of History, Universidade Estadual de Goiás, and Centro Universitário de Anápolis, Brazil. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0001-5726. [email protected] 3 PhD in Geography, University of Toronto, Canada. Professor of Geography and History, University of California, Los Angeles. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3411-2329. [email protected] HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña • http://halacsolcha.org/index.php/halac v.10, n.1 (2020) • p. 306-334 • ISSN 2237-2717 • https://doi.org/10.32991/2237-2717.2020v10i1.p306-334 306 Gerd Kohlhepp e as heranças da geografia alemã para os estudos de colonização e desenvolvimento no Brasil Sandro Dutra e Silva, Stephen Bell apesar das limitações, com um tempo relativamente curto e estadia para as suas publicações. -
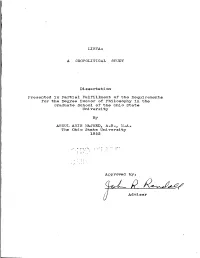
LIBYA* a GEOPOLITICAL STUDY Di S A© Rt at I on Presented in Partial
LIBYA* A GEOPOLITICAL STUDY Di s a© rt at i on Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By ABDUL AMIR MA.JEED, A-B-, M-A- The Ohio State University 1952 Approved by: / Adviser A G K N OVVT jBD GEMEHT S This study could not; have been carried out without the assistance of a number of individuals. The patient, time-consuming, and thorough criticism and assistance of my adviser, Professor John R. Randall, during the progress of this study is gratefully acknowledged. The writer is greatly indebted also to Professor Guy-Herald Smith, Chairman of the Department of Geography, The Ohio State University, for his many helpful suggestions and criticisms through out the course of the work. The aid of Professor Sydney M« Fisher of the Department of History, The Ohio State University, is appreciatedo Thanks are due Miss Genevieve Clark who has done the cartographic work. I must express my gratitude to the staffs of Ohio State University Library and the Library of Congress both of whom gave invaluable aid* TABLE OF CONTENTS CHAPTER PAGE I NTRODUCTION.................................................. 1 PART I HISTORICAL DEVELOPMENT I. LIBYA IN HISTORY ............................................ 5 Early Records ..................... 5 Greek Settlements ................... 7 TRe Roman Period ................... 12 The Arab Invasion 14 Period of* Turkish Rule ................ 17 Conclusion ...... ................ 19 II. THE ITALIAN ACQUISITION OF L I B Y A ......................... 22 Italy and Modem Imperialism ............. 22 The Diplomatic Struggle Over Tripoli and Cyrenaica • • 29 Italian-Turkish Relations and The Tripoli War ..... 35 Italian Colonial Policy in Libya .....