Die Urzeitliche Zisterne Von Telfes Im Stubai
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Birgitz Am Weg Zur „Gesunden Gemeinde“ Foto: Freizeit-Tirol.At/Bernhard Schösser
Birgitz am Weg zur „Gesunden Gemeinde“ Foto: freizeit-tirol.at/Bernhard Schösser Gesundheit fängt bei den Jüngsten an! Deshalb waren Kinder auch intensiv in den „Tag der Gesundheit“ in Birgitz eingebunden, der Ende Juni stattfand. Er war erster Programmpunkt des Vorzeigeprojektes „Die Gesunde Gemeinde“. Mit dem Kooperationspartner GemNova wird ein Konzept für die Übertragung des Modells auf andere Kommunen erstellt. Seiten 16/17 Ausgabe 07/08 2014 Aus dem Inhalt Besuchen Sie uns auch im Internet! n Die Meinung des Präsidenten 2/3 www.gemeinde verband-tirol.at n GF Helmut Ludwig geht in den Ruhestand 4-6 Telefon: 0512/ 587130 n Glasfaserzukunft Tirol 8-11 Anschrift: n Gas-, Heizungs- und Klimaanlagengesetz 18-20 Adamgasse 7a 6020 Innsbruck n Feuerbeschau in den Gemeinden 24/25 n Im Porträt: Vier neue Bürgermeister 28-31 n Aktuelles aus der Geschäftsstelle 32-34 „Sponsoring Post“ Verlagspostamt 6020 Innsbruck GZ 02Z030434 S 2 Die Meinung des Präsidenten Liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, geschätzte Leser Mit 1. Juli ist die No- hestens im Laufe des Jah- Das Umsatzvolumen, das velle zum Tiroler Flur- res 2015 ohne nachteilige über die GemNova abgewi- verfassungsgesetz in Kraft Auswirkungen für die Ge- ckelt wurde, hat sich allein getreten. Bezüglich der meinden getroffen werden von 2011 auf 2013 von 1,2 Umsetzung betreten alle können. Mio. € auf knapp 15 Mio. € Akteure Neuland. Und der gesteigert (+1.250 %). Ak- Tiroler Gemeindeverband Wir werden weiterhin tuell gehen wir davon aus, ist in engem Kontakt mit informieren, zumal wir dass im Jahr 2014 deut- der Agrarbehörde und der unverändert echte Sahne- lich über 50 Mio. -

Rettet Die Kalkkögel
Zugestellt durch Österreichische Post Verbindung Muttereralm – Lizum und Verbindung Bereits versunkene Beratungskosten ins Stubaital Neben den leider unbekannten Kosten für die grisch- Zusätzlich 3S-Bahn vom Hoadl zum Kreuzjoch in der consulta-Studie und den darin angeführten weiteren Schlick, damit Dauergäste aus dem Stubai in die Liz- Studien sind im Stubai sicher erhebliche Kosten für um kommen können. Planung und Beratung und Lobbying bei Dr. Martin Zanon angefallen. Quelle Betrag Investitionsbedarf Hoadl - Schlick (davon Und es geht weiter mit ganzseitigen Anzeigen in der 28,0 Mio EUR 14 Mio. EUR im Stubai) TT (Listenpreis am Samstag: 19.057,- netto) Investitionsbedarf Neusti - Schlick 19,0 Mio EUR Wie hoch sind die Beträge? Investitionsbedarf Muttereralm - Lizum 17,0 Mio EUR Wer finanziert das? (Infrastrukturgesellscha Stubai, Investitionsbedarf Lizum 26,0 Mio EUR Planungsverbände, ARGE Brückenschlag, Gemein- Investitionsbedarf Muttereralm 4,5 Mio EUR den) Summe 94,5 Mio EUR Wie lange soll das noch so weitergehen? Anbindung Stubaitalbahn (nicht in Studie) 6,0 Mio EUR Gibt es dazu Gemeinderatsbeschlüsse mit entspre- Rettet die Kalkkögel Abgang jährlich 0,7 Mio EUR chender Sachverhaltsdarstellung, Begründung und Finanzierung? Liebe Stubaierinnen und Stubaier Und die unberührte Natur nimmt man sich gratis Das Thema „Kalkkögel“ ist derzeit in aller Munde und Bewusste Desinformation aus taktischen Gründen dazu! Fortsetzung folgt.... bewegt viele Menschen. In zahlreichen Leserbriefen oder aufgrund ungeklärter bzw. negativer Faktoren? Finanzierung von 33 Mio. EUR auf Stubaier kommt dies zum Ausdruck. Dabei erfolgen die Planun- Dabei stellt diese Bahn den eigentlichen „Dosenö§- gen nicht transparent unter Einbindung und Informa- Seite ner“ für weitere großräumige Erschließungsprojekte tion der Ö§entlichkeit, sondern weitgehend „hinter Wer soll die 33 MioQuelle EUR auf Stubaier Seite aufbringen?Betrag dar. -

Bergisel Stadion Olympiaworld Schloss Ambras Bergisel Stadion
Olperer Habicht Zuckerhütl Schaufelspitze Stubaier WWildspitzeildspitze Schrankogel Lüsener Fernerkogel Sulzkogel Acherkogel 3476 m 3277 m 3507 m 3333 m 3340 m 3497 m 3298 m 3016 m 3007 m Pirchkogel Windach 2828 m Jochdohle ferner - S c D ift h aun rl a fer e R n fern u Wildspitzbahn erlif o t Daun- kar fe e l Graf- iss E t +l scharte Ga ahn ljo is a l joch H 8 KÜHTAI ratb ch jo d un Ferdinand- o ng c l a Sennjoch h n faffe ba h b D Finstertaler e ah F P h Se a -M rb ern n ss h 2230 m KALKKÖGEL Stausee Haus u ise a e n t 2450 m uba lba -B KÜHKÜHTAITAI Ka hn hn Westfalenhaus A ah t t n n lift f f l os i i h - p o l l a PRAXMAR Pforzheimer Hütte en 2020 m Kaiser arzm u u Sennjoch-Rest. nb ro hw a a c ll e Drei-Seen-Hütte se S n Glungezer 7 STUBAIER GLETSCHER n t rt Murmele Potsdamer Hütte Lüsens n t Max r r - a a l bahn - 1686 m Dre lif nlif e e r l is t g sg hn Nockspitze ee nne F 2677 m F s m a Kreuzjoch- Hoadl nba So Ei a enb W hn G art n 2403m ie sg K Rest. h 2343 m s a b liftel+ll Patscherkofel am re liftel+ll G er bahn Zirmach G u b Zirmach Hoadlhaus a gl halter l h l is i oc l z l k ft H c l l l 2250 m l j o o Galtalm n o n g t h c j Gleirsch Alm e n n h Zirmachalm h l a a n Pleisen Juifenalm li r l h h f b i a Dresdner h ft n t g a Glungezer Hütte a e b c l s t b b 2236 m i f o S - i j d n n Hütte l z Dohlennest Haggen E Schlickeralm a e e u t t lm e Schlicker o r r r a H WindeggWindegg Silz / Arlberg a 1646 m Vergör lt K bodenlifte Ü g b Hochmahdalm Mutterberg a l s 3 AXAMER LIZUM Olympiabahn ST. -
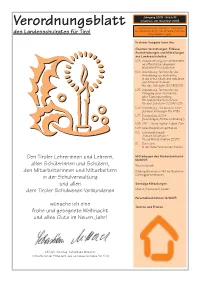
Verordnungsblatt A-6020 Innsbruck · Innrain 1 · Andechshof Tel
Jahrgang 2003 · Stück XII Innsbruck, 20. Dezember 2003 Verordnungsblatt A-6020 Innsbruck · Innrain 1 · Andechshof Tel. 0512/52 0 33-0 · Fax 0512/52 0 33-342 des Landesschulrates für Tirol http://www.lsr-t.gv.at In dieser Ausgabe lesen Sie: Gesetze, Verordnungen, Erlässe, Ausschreibungen und Mitteilungen des Landesschulrates 103. Ausschreibung von Leiterstellen an öffentlichen allgemein bildenden Pflichtschulen 104. Verordnung: Termine für die Anmeldung zur Aufnahme in die erste Stufe der mittleren und höheren Schulen für das Schuljahr 2004/2005 105. Verordnung: Termine für die Ablegung einer Aufnahms- oder Eignungsprüfung für bestimmte Schularten für das Schuljahr 2004/2005 106. Verordnung: Zusätzliche Lehr- planbestimmungen für TFBS 107. EuropaQuiz 2004 (Schülerquiz „Politische Bildung“) 108. YAP – Young-rights-Action-Plan 109. www.integrationsportal.at 110. Schulwettbewerb „Future Mountain – PP Young Winter Games 2005“ 111. Der Islam in der österreichischen Schule Mitteilungen des Medienzentrums Den Tiroler Lehrerinnen und Lehrern, 12/2003 allen Schülerinnen und Schülern, Neu im Verleih den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bildungskalender – Mit kostenlosen in der Schulverwaltung Schnupperseminaren und allen Sonstige Mitteilungen dem Tiroler Schulwesen Verbundenen Modul „Genussvoll essen“ Personalnachrichten 12/2003 wünsche ich eine Termine und Fristen frohe und gesegnete Weihnacht und alles Gute im Neuen Jahr! LR Dipl.-Vw. Mag. Sebastian Mitterer Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Tirol Seite 2 Verordnungsblatt StückStück Xll – VIINr. u.103, VIII 104, – Nr. 105 67 GZ-IVa-2016/1314 Bewerbungen von Frauen sind besonders § 3 103. erwünscht. Diese Verordnung tritt mit dem Tag der Ausschreibung von Leiter- Kundmachung in Kraft. Auf Grund der Bestimmung des § 2 stellen an öffentlichen all- Abs. 3 des Landesvertragslehrergeset- Der Amtsführende Präsident gemeinbildenden Pflichtschulen zes 1966 sind ab 1. -

49. Euroloppet Ganghoferlauf 2019, A-Leutasch (104)
Datum: 19.03.19 49. Euroloppet Ganghoferlauf 2019, A-Leutasch Zeit: 17:14:01 Seite: 1 (104) Kinder II Knaben Rang Name und Vorname Jg Land Ort Team Zeit Abstand Stnr 1. Mutscheller Maximilian 2009 D-Isny WSV Isny 9.51,1 ------ 367 2. Bauer Marco 2008 Leogang SC Leogang 9.56,3 0.05,2 314 3. Herzog Karl 2008 D-Weiler-Simmerberg SG Simmerberg 9.57,0 0.05,9 321 4. Martin Phillip 2008 Egg VSV-Skiclub Bregenzerwald 10.26,2 0.35,1 343 5. Inkermann Arwin 2008 CH-Wauwil SL Schwendi-Langis 10.31,4 0.40,3 373 6. Gitzoller Felix 2008 Egg VSV-Skiclub Bregenzerwald 10.34,7 0.43,6 339 7. Orgis Tomm 2008 D-Oberau TSV Oberammergau 10.37,6 0.46,5 331 8. Kohler Joachim 2008 Egg VSV-Skiclub Bregenzerwald 10.54,2 1.03,1 340 9. Glos Maximilian 2008 St. Anton am Arlberg Lca Arlberg 10.59,2 1.08,1 309 10. Vater Karl 2008 Grinzens SC Seefeld 11.11,7 1.20,6 358 11. Kaindl Jelle 2008 Bad Häring LLC Angerberg 11.13,7 1.22,6 308 12. Benkert Claudius 2008 D-Oberstdorf Skiclub Oberstdorf 11.14,7 1.23,6 375 13. Kündig Paul 2009 Egg VSV-Skiclub Bregenzerwald 11.15,0 1.23,9 342 14. Niederstätter Elias 2008 I-Aldein (BZ) Sportverein Aldein 11.22,2 1.31,1 364 15. Allgaier Felix 2009 D-Mehrstetten WSV Mehrstetten 11.27,3 1.36,2 346 16. Sutterlüty Georg 2008 Egg VSV-Skiclub Bregenzerwald 11.32,2 1.41,1 344 17. -

Benefits of the Winter Welcome Card 2018/2019
Tobogganing in Oberperfuss FROM THE FIRST NIGHT’S STAY WELCOME SERVICES WELCOME CARD Free ski bus P Free cross-country skiing P CARD Free ice skating P WINTER 18/19 Swimming pools 50% discount P Family Programme 20% discount P Culture and customs 10–20% discount P Climbing 10–50% discount P Public transport (selected bus lines) P WITH A STAY OF THREE OR MORE NIGHTS AT A PARTNER COMPANY ADDITIONAL SERVICE WELCOME CARD PLUS Cable cars free for hikers and togobbanists: Oberperfuss lifts (Peter Anich sections I + II) - Oberperfuss P NO DIRECT ACCESS AT THE TURNSTILE ON LIFTS/ CABLE CARS. PLEASE ASK FOR TICKET AT THE TICKET OFFICE. unlimited unlimited Innsbruck Tourismus Burggraben 3 • 6020 Innsbruck, Austria E N Tel. +43 512 / 59 850 • [email protected] WWW.INNSBRUCK.INFO/WELCOME WWW.INNSBRUCK.INFO Rangger Köpfl #MYINNSBRUCK PUBLIC TRANSPORT WELCOME CARD Present your WELCOME CARD and enjoy free travel on selected VVT FREE SKI BUS buses within the Innsbruck holiday destination area. This free service to the TOP ski resorts in Olympia Skiworld does not apply to the City of Innsbruck (all inner city transport provided by IVB). FREE CROSS-COUNTRY SKIING Obsteig in the Innsbruck region and on the Seefeld Plateau More information about free travel available at Tourist Information, FREE ICE SKATING from your landlord and at Eisarena Silz www.innsbruck.info/welcome BUS LINES Eissportzentrum Götzens The Welcome Card acts as a valid ticket on the following bus lines Freizeitzentrum Axams between the specified route sections. Tickets are required for trips Kühtai by night that go beyond the free section. -

Innsbruck - Götzens - Birgitz - Axams/Kristen - Grinzens
4162 Innsbruck - Götzens - Birgitz - Axams/Kristen - Grinzens Gültig ab 07.01.2021 HALTESTELLE MONTAG-FREITAG 11-416-2-2-j21, 16.03.2021 15:53:31 VERKEHRSHINWEIS L Innsbruck Hauptbahnhof (Steig K) 05:30 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 Innsbruck Landesgericht 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 Innsbruck Finanzamt 06:10 06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 Innsbruck Studentenhaus/Chirurgie 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:27 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 Innsbruck Innrain/Campus WIFI 06:14 06:29 06:44 06:59 07:14 07:29 07:29 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 Innsbruck Westbahnhof 05:33 Innsbruck Peterbrünnl 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 Innsbruck Ziegelei/Haftanstalt 05:39 06:17 06:32 06:47 07:03 07:18 07:33 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 Götzens Dorfplatz (Steig A) 05:44 06:22 06:37 06:52 07:08 07:23 07:38 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 4161 nach Natters ab 06:26 -

In and Around Innsbruck Is Vast Von Innsbruck Aufs Miemingertotal Plateau Length Und of Tour: Retour 80 Km Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, Tel
THE KARWENDEL TOUR: 3 TOUR FACTS EMERGENCY REPAIRS LOCAL TOUR ADVICE AROUND THE NATURE PARK Start and finish: Innsbruck Up the mountain, through the valley, along some lakes: the tour through Elevation gain: 550 m It only takes a few minutes by road bike to get out of the city. For a Is your bike broken? Don’t worry, these eleven specialists provide help: the Karwendel mountain range is a perfect example of variety of cycling Alpin Bike, Planötzenhofstraße 16, tel. +43 664 / 13 43 230 convenient and traffic-free escape, choose one of the many broad cycle Highest point: 869 m experiences in the Alps. The trip starts with a flat entry in Innsbruck and tracks. The choice of tours available in and around Innsbruck is vast Von Innsbruck aufs MiemingerTotal Plateau length und of tour: retour 80 km Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, tel. +43 512 / 36 12 75 R O A D continues with a tough mountain climb from Telfs to Leutasch. From and diverse, offering unique views of the city, the countryside, and the Bikes and More, Herzog-Siegmund-Ufer 7, tel. +43 512 / 34 60 10 there, several climbs and descents along the Isar river will lead you Level of difficulty: beginner alpine scenery. It provides everyone, from hobby cyclists to professional BKD, Burgenlandstraße 29, tel. +43 512 / 34 32 26 through the Karwendel mountains to the Achensee Lake. Your return to Elevation profile: athletes, with an opportunity to take on challenges appropriate to their Innsbruck will take you through the Inntal Valley. 900 Die Börse, Leopoldstraße 4, tel. -

Rinn Sistrans Lans Patsch Igls Vill Mutters Natters
Schaufelspitze Stubaier Wildspitze Acherkogel 3.333 m 3.340 m 3.007 m Jochdohle Windach- Schrankogel Lüsener Fernerkogel Sulzkogel Pirchkogel Habicht Zuckerhütl ferner 3.497 m 3.298 m 3.016 m 2.828 m 3.277 m 3.507 m lift D Olperer er aunf fern Wildspitzbahn ern kar R erlif 3.476 m t Daun- Graf- s E o e ais Zoo-ShutS i l+ scharte h G c sj t ll joc 1 KÜHTAI fen- tle jo h oc a aun Ferdinand- f a d Finstertaler H Pfa hn ch u h D Sennjoch o hn ba f S l a F t e b h er gra ba el ss KALKKÖGEL Stausee Haus e rb n a e au h - elb 2.230 m Westfalenhaus A -M is 2.450 m b n h KÜHTAI ah t ah lp u a Kaiser f K t n n n e t- lif i n B os l Sennjoch-Rest. o Lüsens ro ah 2.020 m Max zm u PRAXMAR se n war a l l Drei-Seen-Hütte nl Sch 3 STUBAIER GLETSCHER n t Dr if ft Fernpass Glungezer r a l 1.686 m ei t li r l Hoadl se n e g hn MurmelbahnKreuzjoch- Nockspitze Pforzheimer Hütte enb ne Imst / Arlberg F s a W a n Simmeringalm n h o Reutte / Füssen 2.677 m Ei nb Rest. Potsdamer Hütte 2.343 m i n S rte h 2.403m es Patscherkofel a K a b Zürich / Paris / Frankfurt 9 GLUNGEZER sg r e ahn am e b Hoadlhaus G rg lterb G ll u h a b cha Zirmachbahn a 2.248 m z c l is Ho l h Galtalm l l k j n n o o o t h j g c n n a Pleisen e Gipfelstube a h n Zirmachalm Gleirsch Alm l b h l h l r Dresdner t h i n if f a t g a f c t Glungezer Hütte i e 2.236 m b s o Dohlennest 4 PATSCHERKOFEL b l S l i j Hütte z - n Haggen Schlickeralm d E m l u - Juifenalm Kinderland e e Schli l a Holzleiten t Vergör a r Windegg Ü t o Grünberg r 2 AXAMER LIZUM 1.646 m Schutzhaus Das Kofel b Mutterberg l K ckerbo n H u a a h t n Olympiabahn f ST. -

Gemeinderatsprotokoll Nr. 07
171 N I E D E R S C H R I F T gem. § 46 TGO 2001 über die am Montag, dem 8. November 2004 im Sitzungsraum des Gemeindeamtes Telfes im Stubai abgehaltene 7. Gemeinderatssitzung. Beginn: 20.00 Uhr Ende: 24.00 Uhr Vorsitzender: Bgm. Peter Lanthaler Anwesend: Bgm. Peter Lanthaler, Rudolf Span, Ersatzmann Michael Tanzer (für Ursula Paulweber), Paul Mair, Leo Span, Ersatzmann Ernst Mair (für Dietmar Tschenett), Georg Viertler, Karlheinz Töchterle, Waltraud Wilberger, Friedrich Suitner, Thomas Leitgeb, Josef Permoser, Egon Maurberger; entschuldigt ferngeblieben: Ursula Paulweber, Dietmar Tschenett; weiters anwesend: bei Pkt. 3 der TO Feuerwehr-Kdt. Christian Gleirscher und Kdt.-Stellv. Martin Wegscheider, bei Pkt. 6 der TO Gerhard Jank; Schriftführer: Egon Maurberger TAGESORDNUNG 1.) Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Sitzung 2.) Genehmigung und Unterfertigung des Verhandlungsprotokolles vom 27.9.2004 3.) Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf eines Feuerwehrautos 4.) Beratung und Beschlussfassung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Telfes i. Stubai (Ortsgebiet und Froneben – Schlick) 5.) Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Auflagen für die Bauland- Widmung der Gp. 314/2 KG Telfes (Hubert Haas) 6.) Beratung und Beschlussfassung a) über die Auflegung des von Arch. DI Helmut Heinricher, Birgitz, ausgearbeiteten Entwurfes des allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes „Gerhard Jank – Gp. 84/4, 83 und Bp. 248“ 172 b) des von Arch. DI Helmut Heinricher, Birgitz, ausgearbeiteten Entwurfes des -

From the First Night's Stay Bus Lines
Kletterzentrum Telfs, climbing centre FROM THE FIRST NIGHT’S STAY BUS LINES SERVICES WELCOME CARD WELCOME POST BUS Swimming pools/bathing lakes 50% discount P 4123 Telfs – Zirl – Innsbruck 4132 Ampass – Aldrans – Sistrans – Lans – Igls/Patscherkofel Lifts/cable cars 10% discount P (Römerstraße) – Patsch CARD E-bike rental 10–50% discount P 4132/34 Igls/Patscherkofel (Römerstraße) – Lans – Sistrans – Rinn – Tulfes – Glungezerbahn (“Zirbenweg” circular stone pine hiking Mountain hiking programme (free guided hikes) P trail) SUMMER 2018 4134 Aldrans – Lans – Sistrans – Rinn/Judenstein – Tulfes – Family programme 10–50% discount P Glungezerbahn Golf 20% discount P 4140 Innsbruck – Unterberg 4141 Vill – Igls – Patsch – Ellbögen Culture and customs 10–50% discount P 4142 Natters – Innsbruck Climbing 25–50% discount P 4161 Natters – Mutters – Götzens – Völs 4162 Grinzens – Axams – Birgitz – Götzens – Innsbruck Public transport (selected bus lines) P 4162 During lift operation Axamer Lizum from Axams-Terminal Kögele to the hiking area Axamer Lizum 4165 Innsbruck – Völs – Kematen i. T. – Ranggen – Oberperfuss WITH A STAY OF THREE OR MORE NIGHTS AT A 4166 Innsbruck – Völs – Kematen – Sellrain – Gries i. S. – Praxmar*- St. Sigmund – Kühtai* (*Praxmar and Kühtai from July–September) PARTNER COMPANY 4168 Axams – Kematen – Zirl 4176 Obsteig/Holzleiten – Telfs – Innsbruck SERVICES WELCOME CARD PLUS 8352 Ötztal/Bahnhof – Stams – Telfs – Innsbruck Lifts/cable cars free: Bergbahnen Oberperfuss (Peter Anich Sektion I + II) - Oberperfuss, P IVB LINES DreiSeenBahn - Kühtai, Axamer Lizum (Olympiabahn) - Axams, Muttereralmbahn - Mutters Linie J Igls – Innsbruck Linie 6 Igls Bahnhof (train station) – Bergisel Lifts/cable cars 25% discount: P Patscherkofelbahn & Innsbrucker Nordkettenbahnen NO DIRECT ACCESS AT THE TURNSTILE ONCARS. LIFTS/CABLE unlimited Legal Notice: PLEASE ASK FOR TICKET AT Publisher/Concept and Graphics: Innsbruck Tourismus; THE TICKET OFFICE. -

In and Around Innsbruck
THE KARWENDEL TOUR: 3 TOUR FACTS EMERGENCY REPAIRS LOCAL TOUR ADVICE AROUND THE NATURE PARK Start and fi nish: Innsbruck Up the mountain, through the valley, along some lakes: the tour through the Elevation gain: 550 m It only takes a few minutes by road bike to get out of the city. For a convenient Is your bike broken? Don’t worry, these eleven specialists provide help: Karwendel mountain range is a perfect example of variety of cycling experi- Alpin Bike, Planötzenhofstraße 16, tel. +43 664 / 13 43 230 and traffi c-free escape, choose one of the many broad cycle tracks. The choice Highest point: 869 m ences in the Alps. The trip starts with a fl at entry in Innsbruck and contin- Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, tel. +43 512 / 36 12 75 of tours available in and around Innsbruck is vast and diverse, offering unique Von Innsbruck aufs MiemingerTotal Plateau length undof tour: retour 80 km R O A D ues with a tough mountain climb from Telfs to Leutasch. From there, several views of the city, the countryside, and the alpine scenery. It provides everyone, Bikes and More, Herzog-Siegmund-Ufer 7, tel. +43 512 / 34 60 10 climbs and descents along the Isar river will lead you through the Karwendel Level of diffi culty: beginner from hobby cyclists to professional athletes, with an opportunity to take on BKD, Burgenlandstraße 29, tel. +43 512 / 34 32 26 mountains to the Achen Lake. Your return to Innsbruck will take you through Elevation profile: challenges appropriate to their individual levels.