Effi Briest Und Bad Boll
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

German Language and Culture Texts
German language and culture texts Title Author Condition Other notes Suggested price Oxford German Dictionary Oxford As new, never used Large, £20 (RRP £30) – though hardback dustjacket has a small tear at the back (could be fixed with selotape easily) Duden CD to go with the £0.20 dictionary (but no dictionary) Understanding Stuart As new Is new £4 Contemporary Germany Parkes Germany a healthy democracy? Can Germany’s allies continue to rely on it as a reliable partner? Introductory survey of German society focusing on post- unification situation Der Nationalsozialismus 12 Fischer/Hu Very old book but 1987 book £0.50 dunkle Jahre deutscher egli/Ischi/S not marked (apart about Nazi Geschichte chaerer from 1 or 2 period of underlines in Germany in pencil) German Complete German Course L.J. Russon Old book but no Overview of £1 markings German grammar German Grammar and Usage A. E. Old book with light Overview of £0.50 Hammer markings German grammar German prelims texts Title Author Condition Other notes Suggested price The Cambridge Cambridge Companion As new Cambridge Companion £15 (RRP £23) Companion to The (Edited by Graham Modern German Novel Bartram) German novel 1890s to present Die Verwandlung Franz Kafka Light pencil marks Pocket size Reclam £1 (RRP £2) on 2 pages Die Verwandlung Kafka Very few Reclam £0.80 markings The Metamorphosis and Franz Kafka Light markings English translation of £2 (RRP £8) other Stories German text Oxford World’s Classics Erläuterungen und Various (Reclam) As new Pocket size £2.50 (RRP £4) Dokumente Reclam -

Die Verortung Des Fremden Im Dialog Der Kulturen in Den Literari Schen Texten
Die Verortung des Fremden im Dialog der Kulturen in den literari schen Texten - Störfaktoren oder Dialogpartner?1 Kadriye Öztürk2 Einleitung In unserer allmählich kleiner werdenden Welt und „in der Literatur und Wissen schaft, die auf einer Vielzahl von Ortsveränderungen beruhen“ (Ette 2001: 21), ist „die Verortung des Fremden im Dialog der Kulturen“ von einer großen Be deutung. Der Dialog der Kulturen war schon längst ein Thema vieler Kulturar beiten und der Humanwissenschaften, wobei mehrmals vergessen wurde, wo das Fremde in diesem Dialog liegt und wer für wen fremd ist. Meist spielt eine eurozentrische Betrachtungsweise eine wesentliche Rolle, um diesen interkultu rellen Dialog zu definieren, auch wenn der Dialog sich zwischen zwei Elemen ten oder Personen gleicher Rechte in der sprachlichen, kulturellen und sozialen Repräsentation verwirklichen sollte, sonst geht der Dialog von vornherein ver loren. “Es lohnt sich in der Tat zu fragen, inwieweit man wirklich bereits von einem global-gleichrangigen Dialog zwischen den Völkern sprechen kann, der nicht selten von verschiedenen Seiten beschworen wird“ (Bräsel 1999: !!). Da -die durch den interkulturellen Dialog entstandene- Interkulturalität zur Ent stehung neu entstandener oder verändert erlebter Formen des Austausches zwi schen sozialen Einheiten und Individuen und zur Aufhebung der Grenzziehun gen und zur Entstehung der Schnittstellen führte, mussten die Interaktionspart ner - laut Gutjahr - sich wechselseitig als unterschiedlich kulturell geprägt iden tifizieren (vgl.Gutjahr -

Effi Briest" Gleixner, Ulrike 2014
Repositorium für die Geschlechterforschung Geschlechtergeschichte verändert Geschichtsbilder : Das zweifache Leben der "Effi Briest" Gleixner, Ulrike 2014 https://doi.org/10.25595/779 Veröffentlichungsversion / published version Sammelbandbeitrag / collection article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Gleixner, Ulrike: Geschlechtergeschichte verändert Geschichtsbilder : Das zweifache Leben der "Effi Briest", in: Maß, Sandra; Tippelskirch, Xenia von (Hrsg.): Faltenwürfe der Geschichte. Entdecken, entziffern, erzählen (Frankfurt: Campus Verlag, 2014), 366-384. DOI: https://doi.org/10.25595/779. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY 4.0 Lizenz (Namensnennung) This document is made available under a CC BY 4.0 License zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu dieser Lizenz finden (Attribution). For more information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de www.genderopen.de DA S ZW EIFACH E L E B EN DER >EFf l ßRIEST< 367 schichts- und Geschlechterbilder entstehen zu einem großen Teil auf der Geschlechtergeschichte verändert Basis von literarischen, künstlerischen und medialen Zeugnissen.3 Fonta Geschichtsbilder: Das zweifache Leben der nes Kunstfigur Effi Briest wurde in der populären Rezeption zu einer rea listisch-authentischen Figur, an deren Schicksal sich die Unmöglichkeit EJ!i Briest einer Entfaltung von Frauen in der wilhelminischen Gesellschaft zu zeigen scheint. Den Roman als historische Quelle zu lesen erscheint naiv, viel U!rike G!eixner mehr ist er eine mit realistischen Details ausgestattete Allegorie für die !ragik der menschlichen Existenz. Im Folgenden möchte ich aufzeigen, wie die literarische Kunstfigur in der Rezeption zu einer historisch über• Am 10. Februar 2002 wurde das Grab der Baronin Elisabeth von Ardenne zeugenden Frauenfigur wurde, und welche Zuschreibungen insbesondere auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf bei Potsdam in den Rang eines dem weiblichen Geschlecht in diesem Prozess widerfahren. -

Unwiederbringlich Und Effi Briest : Eine Studie Zu Theodor Fontanes Erzahlweisë
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1-19-1977 Unwiederbringlich und Effi Briest : Eine Studie zu Theodor Fontanes Erzahlweisë Christine Gentzkow Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the German Language and Literature Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Gentzkow, Christine, "Unwiederbringlich und Effi Briest : Eine Studie zu Theodorontanes F Erzahlweisë " (1977). Dissertations and Theses. Paper 2560. https://doi.org/10.15760/etd.2557 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Christine Gentzkow for the Master of Arts in German presented January 19, 1977. Title: Unwiederbringlich und Effi Briest: Eine Studie zu Theodor Fontanes Erzahlweise. APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE: Fronz , Langbamm~mnan ~ . Linda B. Parshall Louis J. Elteto In thi's thesis an attempt is made to show the ::peculiar features of Fontane's narrative style as well as his art of characterization. I have tried to interpret his concept of humaneness in the two novels, Unwiederbringlich and Effi Briest, and to show how the composition of these novels is directed to the portrait of the individual. Theodor Fontane 1 s unusual distinction lies in his keen observation of the Prussian scene and his craftsmanship as a cosmopolitan story- teller. The principal elements of his works are a sense of historical continuity and an uncommon perception of the speech and gestures by which his characters reveal their particular virtues. -

THE PRIVATE EYE: the Depiction, of Introspection in Selected Works by Gustave Flaubert and Theodor Fontane
THE PRIVATE EYE: The Depiction, of Introspection in Selected Works by Gustave Flaubert and Theodor Fontane A thesis submitted for the degree of Ph.D. of the University of London by Thomas Peck 1995. ProQuest Number: 10016800 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10016800 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 For my parents and my fiancée Abstract of thesis. The Private Eye: The depiction of introspection in selected works of Gustave Flaubert and Theodor Fontane. The introduction sets out the thematic concerns which I wish to explore in Fontane's and Flaubert's fiction. It also incorporates a review of previous comparative literature which has focused on these two authors. Part I contains five sections, one from each of the novels I wish to discuss (Schach von Wuthenow, Madame Bovary, Irrungen, Wimmgen, L'Éducation sentimentale and Effi Driest). Each section depicts moments of crisis and intense inwardness on the part of the characters which are analysed according to the criteria outlined in the introduction. The basic issue in each case is the same: what is the status and nature of these seemingly private moments? Part 11 develops the issues raised in the close readings: i. -

Swinemunde War, Als Wir Sommer 1827 Dort Einzogen, Ein Unschones Nest...“
„Swinemunde war, als wir Sommer 1827 dort einzogen, ein unschones Nest...“ ZUM 200. GEBURTSTAG VON THEODOR FONTANE Die Adler-Apotheke in Swinemünde um 1890 Jordansee, früher ein beliebtes Ausflugsziel n diesem Jahr jährt sich der Geburts- Jordansee auf der Insel Wollin vielleicht das tag des Schriftstellers zum 200. Mal. schönste derartige Gewässer im nördlichen iDas Land Brandenburg plant unter Deutschland ist. dem Motto „fontane.200“ gar ein ganzes In seinem Buch „Meine Kinderjahre“ Theodor-Fontane-Jahr. Ohne Zweifel hat beschreibt Fontane sehr anschaulich seine Die Gedenktafel für Fontane in Swine- der Schriftsteller mit seinem mehrbändi- Kindheit in Swinemünde, wo sein Vater münde. Jozef Pluciński hat sie dort anbrin- gen Werk „Wanderungen durch die Mark Louis Henri Fontane die Adler-Apotheke gen lassen, wo früher die Adler-Apotheke Brandenburg“ dem Land ein literarisches gekauft hatte. Es heißt dort: „Swinemünde stand, die 1955 abgerissen wurde. Denkmal gesetzt und damit dessen Iden- war, als wir Sommer 1827 dort einzogen, ein tität geprägt wie kein anderer Autor. Auch unschönes Nest, aber zugleich ein Ort von ten sich kaum vorstellen können, dass ihr mit seinen Bestsellern „Frau Jenny Treibel“, besonderem Reiz. Wählte man als Beob- Schulgebäude zwei Jahrzehnte später die „Der Stechlin“ und dem bereits dreimal ver- achtungsposten den Kirchenplatz, zu des- erste polnische Schule im nunmehr polnisch filmten Roman „Effi Briest“ schrieb Fontane sen einschließenden Häusern auch unsere verwalteten und besiedelten Westpommern Literaturgeschichte. Weithin bekannt sein Apotheke gehörte, so ließ sich, obschon beherbergen sollte. dürfte auch das Gedicht „Herr von Ribbeck hier die Hauptstraße vorüberführte, wenig Sehr ausführlich berichtet Fontane über auf Ribbeck im Havelland“. -

Theodor Fontanes Darstellung Der Berliner Gesellschaft in Seinen Romanen Effi Briest Und Irrungen Wirrungen
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1988 Theodor Fontanes Darstellung der Berliner Gesellschaft in seinen Romanen Effi Briest und Irrungen Wirrungen Ronald Kent Nelson Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the German Literature Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Nelson, Ronald Kent, "Theodor Fontanes Darstellung der Berliner Gesellschaft in seinen Romanen Effi Briest und Irrungen Wirrungen" (1988). Dissertations and Theses. Paper 3857. https://doi.org/10.15760/etd.5741 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Ronald Kent Nelson for the Master of Arts in German presented July 26, 1988. Title: Theodor Fontanes Darstellung der Berliner Gesellschaft in seinen Romanen Eff i Briest und Irrungen Wirrungen. APPROVED BY THE MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE. LOUlS J. B'., Franklin c. west This thesis examines Theodor Fontane's novels Effi Briest and Irrungen Wirrungen and shows how he used them to exoress his dissatisfaction with the Berlin society of his time. Chapter I examines Fontane' s personal background anc'l shows how his attitudes were influenced by others. Fontane's parents could not agree on how he was to be brought up, his father preferring a free-thinking, liberal education and his mother a more traditional one. England also played a major role in Fontane's develop- 2 ment. -
Marginal Culture, Hybridity and the Polish Challenge in Fontane's Effi Briest
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Open Access Dissertations 2-2011 Justifying the Margins: Marginal Culture, Hybridity and the Polish Challenge in Fontane's Effi Briest Zorana Gluscevic University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations Part of the German Language and Literature Commons Recommended Citation Gluscevic, Zorana, "Justifying the Margins: Marginal Culture, Hybridity and the Polish Challenge in Fontane's Effi Briest" (2011). Open Access Dissertations. 335. https://scholarworks.umass.edu/open_access_dissertations/335 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Open Access Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. JUSTIFYING THE MARGINS: MARGINAL CULTURE, HYBRIDITY, AND THE POLISH CHALLENGE IN FONTANE’S EFFI BRIEST A Dissertation Presented by ZORANA GLUSCEVIC Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts Amherst in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY February 2011 German and Scandinavian Studies © Copyright by Zorana Gluscevic 2011 All Rights Reserved JUSTIFYING THE MARGINS: MARGINAL CULTURE, HYBRIDITY, AND THE POLISH CHALLENGE IN FONTANE’S EFFI BRIEST A Dissertation Presented By ZORANA GLUSCEVIC Approved as to style and content by: _________________________________________________ -
Za Dużo Światła, to Niedobrze, Ale Takie Przytłumione, to W Sam
ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS Folia Litteraria Polonica 3(49) 2018 http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.49.11 Joanna Jabłkowska* „Za dużo światła, to niedobrze, ale takie przytłumione, to w sam raz”: motyw zdrady małżeńskiej w niemieckim realizmie poetyckim na podstawie Effi Briest Theodora Fontanego Takie życie nie jest, a gdyby takim było, to musiałby zostać wynaleziony sublimują- cy i upiększający je welon. Piękno nie wymaga specjalnego „wynalezienia” – nie jest to konieczne, ponieważ piękno istnieje, trzeba tylko umieć je dostrzec lub przynaj- mniej nie odpychać go w sposób zamierzony. Prawdziwy realizm może być także pełen piękna, bo piękno – chwalić Boga – należy do życia tak samo jak brzydota1. Powyższe słowa pochodzą z listu Theodora Fontanego (1819–1898)2, jednego z czo- łowych przedstawicieli niemieckiego realizmu. Fontane pisze do żony o francuskim naturalizmie, konkretnie La fortune des Rougon Emila Zoli. * Profesor, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, e-mail: [email protected] 1 Po niemiecku: „So ist das Leben nicht und wenn es so wäre, so müßte der verklärende Schön- heitsschleier dafür geschaffen werden. Aber dies «erst schaffen» ist gar nicht nötig; die Schön- heit ist da, man muß nur ein Auge dafür haben oder es wenigstens nicht absichtlich verschlie- ßen. Der echte Realismus wird auch immer schönheitsvoll sein; denn das Schöne, Gott sei dank, gehört dem Leben gerade so gut an wie das Häßliche.” Th. Fontane, Brief an Emilie Fon- tane v. 14.06.1883 (list do Emilii Fontane), w: tenże, Der Ehebriefwechsel. Große Brandenburger Ausgabe, t. -
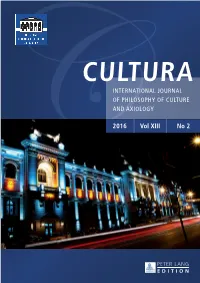
Reading Rainer Fassbinder's Adaptation Fontane Effi Briest
CULTURA CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE CULTURA AND AXIOLOGY Founded in 2004, Cultura. International Journal of Philosophy of 2016 Culture and Axiology is a semiannual peer-reviewed journal devo- 2 2016 Vol XIII No 2 ted to philosophy of culture and the study of value. It aims to pro- mote the exploration of different values and cultural phenomena in regional and international contexts. The editorial board encourages the submission of manuscripts based on original research that are judged to make a novel and important contribution to understan- ding the values and cultural phenomena in the contempo rary world. CULTURE AND AXIOLOGY CULTURE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ISBN 978-3-631-71562-8 www.peterlang.com CULTURA 2016_271562_VOL_13_No2_GR_A5Br.indd 1 14.11.16 KW 46 10:45 CULTURA CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE CULTURA AND AXIOLOGY Founded in 2004, Cultura. International Journal of Philosophy of 2016 Culture and Axiology is a semiannual peer-reviewed journal devo- 2 2016 Vol XIII No 2 ted to philosophy of culture and the study of value. It aims to pro- mote the exploration of different values and cultural phenomena in regional and international contexts. The editorial board encourages the submission of manuscripts based on original research that are judged to make a novel and important contribution to understan- ding the values and cultural phenomena in the contempo rary world. CULTURE AND AXIOLOGY CULTURE INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL www.peterlang.com CULTURA 2016_271562_VOL_13_No2_GR_A5Br.indd 1 14.11.16 KW 46 10:45 CULTURA INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY OF CULTURE AND AXIOLOGY Cultura. -

Multistep Oxygen Therapy (EWOT) - the Best Ant-Aging Gift You Can Give Your Body
Multistep Oxygen Therapy (EWOT) - The Best Ant-Aging Gift You Can Give Your Body Written by: Rober Rowan MD; Read more at www.docRowen.com. Also read about Ozone in Sierra Leone and Vaccines at FaceBook.com/DrRobertJRowen. In the never-ending fight against the aging process, we have finally found a therapy that now gives us the edge. It can dramatically reduce the effects of the aging process from your body, it costs very little, and it can be done in the comfort of your own home. The therapy is called EWOT (exercise with oxygen therapy) or multi-step therapy. You’ve read about it in the past, but that’s just the beginning of what will be one of the biggest breakthroughs ever in anti- aging medicine in decades, and yet it’s still virtually ignored by the medical establishment. Why? Probably because it doesn’t cost much, so the doctors and drug companies aren’t going to get rich using it. But I suspect most are simply in the dark about the incredible benefits you can receive using this therapy. I know I was for many years. As an avid user of oxidation and oxygen therapies, I was fortunate to attend a lecture on oxygen multi- step therapy at the International Oxidative Medicine Association’s convention years ago. However, it was presented in poor English without a clear understanding among the attendees of the mechanisms of action. Like most physicians, I need to know how something works to better apply it to patient care. Just hearing results without understanding is not satisfactory. -

Image and Autonomy: Woman Figures in Thomas Mann's Work
Image and Autonomy Women Figures in Thomas Mann’s Work Gerta Valentine University College London PhD Thesis ProQuest Number: U642585 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest U642585 Published by ProQuest LLC(2015). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT Critical orthodoxy tends to perceive Thomas Mann as an intellectual or cerebral writer; and, in consequence, it is often argued that he is interested not in individual characters as convincing, engaging, human entities, but rather in stereotypical figures who embody certain values or attitudes. And - so the argument runs - this limitation is particularly evident in respect of the women figures. The publication of the diaries has led critics to invoke his latent homosexuality as further evidence for his inability to create credible women characters. This thesis seeks to challenge this orthodoxy by arguing that time and time again Thomas Mann’s women figures challenge - or, at the very least, call into question - the stereotyping that is foisted upon them by their socio cultural context and lay claim to a measure of human autonomy.