Serbische Vergangenheitsaufarbeitung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Helsinki Committee for Human Rights in Serbia HUMAN RIGHTS AND
Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Helsinki Committee for Human Rights in Serbia HUMAN RIGHTS AND ACCOUNTABILITY Serbia 2003 0 1 Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Helsinki Committee for Human Rights in Serbia HUMAN RIGHTS AND ACCOUNTABILITY Serbia 2003 Helsinki Committee for Human Rights in Serbia PUBLISHER: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia FOR PUBLISHER: Sonja Biserko * * * TRANSLATED BY: Ivana Damjanovic Dragan Novakovic Spomenka Grujicic LAYOUT BY: Nebojsa Tasic HUMAN RIGHTS COVER DESIGNE: Ivan Hrasovec AND PRINTED BY: "Zagorac", Belgrade 2004 ACCOUNTABILITY NUMBER OF COPIES: 500 - Serbia 2003 - ISBN - 86-7208-090-4 This book was published thanks to the support of the Swedish Helsinki Committee for Human Rights Belgrade, 2004 2 3 Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Helsinki Committee for Human Rights in Serbia I am here to work for you and in behalf of you. But I cannot work instead of you. Zoran Djindjic 4 5 Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Helsinki Committee for Human Rights in Serbia Introduction The Premier Zoran Djindjic assassination not only marked the year 2003 but will also – judging by ongoing developments – face Serbia with a historical crossroads: with one road leading towards Europe and another away from it. The murder of a reformist premier stalled reforms and put an end to the cooperation with The Hague Tribunal. And, moreover, it opened the door to Serbia’s radicalization. The DOS coalition's incapability and unwillingness to make a break with Milosevic’s policy, particularly the warring one, gave scope to restoration of the ancien regime that triumphed in the early parliamentary election. -

Confronting the Yugoslav Controversies Central European Studies Charles W
Confronting the Yugoslav Controversies Central European Studies Charles W. Ingrao, senior editor Gary B. Cohen, editor Confronting the Yugoslav Controversies A Scholars’ Initiative Edited by Charles Ingrao and Thomas A. Emmert United States Institute of Peace Press Washington, D.C. D Purdue University Press West Lafayette, Indiana Copyright 2009 by Purdue University. All rights reserved. Printed in the United States of America. Second revision, May 2010. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Confronting the Yugoslav Controversies: A Scholars’ Initiative / edited by Charles Ingrao and Thomas A. Emmert. p. cm. ISBN 978-1-55753-533-7 1. Yugoslavia--History--1992-2003. 2. Former Yugoslav republics--History. 3. Yugoslavia--Ethnic relations--History--20th century. 4. Former Yugoslav republics--Ethnic relations--History--20th century. 5. Ethnic conflict-- Yugoslavia--History--20th century. 6. Ethnic conflict--Former Yugoslav republics--History--20th century. 7. Yugoslav War, 1991-1995. 8. Kosovo War, 1998-1999. 9. Kosovo (Republic)--History--1980-2008. I. Ingrao, Charles W. II. Emmert, Thomas Allan, 1945- DR1316.C66 2009 949.703--dc22 2008050130 Contents Introduction Charles Ingrao 1 1. The Dissolution of Yugoslavia Andrew Wachtel and Christopher Bennett 12 2. Kosovo under Autonomy, 1974–1990 Momčilo Pavlović 48 3. Independence and the Fate of Minorities, 1991–1992 Gale Stokes 82 4. Ethnic Cleansing and War Crimes, 1991–1995 Marie-Janine Calic 114 5. The International Community and the FRY/Belligerents, 1989–1997 Matjaž Klemenčič 152 6. Safe Areas Charles Ingrao 200 7. The War in Croatia, 1991–1995 Mile Bjelajac and Ozren Žunec 230 8. Kosovo under the Milošević Regime Dusan Janjić, with Anna Lalaj and Besnik Pula 272 9. -

Yugoslav Destruction After the Cold War
STASIS AMONG POWERS: YUGOSLAV DESTRUCTION AFTER THE COLD WAR A dissertation presented by Mladen Stevan Mrdalj to The Department of Political Science In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the field of Political Science Northeastern University Boston, Massachusetts December 2015 STASIS AMONG POWERS: YUGOSLAV DESTRUCTION AFTER THE COLD WAR by Mladen Stevan Mrdalj ABSTRACT OF DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science in the College of Social Sciences and Humanities of Northeastern University December 2015 2 Abstract This research investigates the causes of Yugoslavia’s violent destruction in the 1990’s. It builds its argument on the interaction of international and domestic factors. In doing so, it details the origins of Yugoslav ideology as a fluid concept rooted in the early 19th century Croatian national movement. Tracing the evolving nationalist competition among Serbs and Croats, it demonstrates inherent contradictions of the Yugoslav project. These contradictions resulted in ethnic outbidding among Croatian nationalists and communists against the perceived Serbian hegemony. This dynamic drove the gradual erosion of Yugoslav state capacity during Cold War. The end of Cold War coincided with the height of internal Yugoslav conflict. Managing the collapse of Soviet Union and communism imposed both strategic and normative imperatives on the Western allies. These imperatives largely determined external policy toward Yugoslavia. They incentivized and inhibited domestic actors in pursuit of their goals. The result was the collapse of the country with varying degrees of violence. The findings support further research on international causes of civil wars. -

Third Amended Indictment
THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA CASE NO. IT-01-42-PT THE PROSECUTOR OF THE TRIBUNAL AGAINST PAVLE STRUGAR THIRD AMENDED INDICTMENT The Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, pursuant to her authority under Article 18 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ("the Statute of the Tribunal") charges: PAVLE STRUGAR With VIOLATIONS OF THE LAWS OR CUSTOMS OF WAR as set forth below: THE ACCUSED: 1. Pavle STRUGAR was born on 13 July 1933 in Pec, in present-day Kosovo. He graduated from the Military Academy for Ground Forces in 1952 and was thereafter assigned to various Yugoslav Peoples’ Army (the "JNA") posts in the Socialist Republic of Slovenia and the Socialist Republic of Serbia. He subsequently was promoted to Major General and was named Commander of the Military Academy for Ground Forces. In 1989, he was made the Commander of the Territorial Defence forces in the Socialist Republic of Montenegro. In December 1989, he was promoted to Lieutenant General. In October 1991, he was named as the Commander of the Second Operational Group, which was formed by the JNA to conduct the military campaign against the Dubrovnik region of the Republic of Croatia ("Croatia"). In 1993 he was retired from the Yugoslav Army (the "VJ"). Among the formations subordinated to him was the Ninth VPS commanded by Miodrag JOKIC. INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY 2. As commander of the JNA Second Operational Group set up to conduct the Dubrovnik campaign, General Pavle STRUGAR exercised both de jure and de facto power over the forces under his command. -

Fitness Hearings in War Crimes Cases: from Nuremberg to the Hague Phillip L
Boston College International and Comparative Law Review Volume 30 Issue 1 Sharpening the Cutting Edge of International Article 10 Human Rights Law: Unresolved Issues of War Crimes Tribunals 12-1-2007 Fitness Hearings in War Crimes Cases: From Nuremberg to the Hague Phillip L. Weiner Follow this and additional works at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr Part of the International Law Commons, and the Military, War, and Peace Commons Recommended Citation Phillip L. Weiner, Fitness Hearings in War Crimes Cases: From Nuremberg to the Hague , 30 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 185 (2007), http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol30/iss1/10 This Symposium Article is brought to you for free and open access by the Law Journals at Digital Commons @ Boston College Law School. It has been accepted for inclusion in Boston College International and Comparative Law Review by an authorized editor of Digital Commons @ Boston College Law School. For more information, please contact [email protected]. FITNESS HEARINGS IN WAR CRIMES CASES: FROM NUREMBERG TO THE HAGUE Phillip L. Weiner* † Abstract: This Article examines the Strugar decision and its role in estab- lishing the standards for a defendant’s ªtness to stand trial before an in- ternational tribunal. While ªtness to stand trial was an issue in three cases at Nuremberg, those cases failed to establish any standards for the interna- tional criminal justice community. In contrast, the Strugar standards have been followed in other Trial Chambers at the International Criminal Tri- bunal for the Former Yugoslavia, and at The Special Panels for Serious Crimes at the United Nations Tribunal at East Timor. -

Commhr Country Report
Strasbourg, 23 June 2014 CommDH(2014)13 English only REPORT BY NILS MUIŽNIEKS COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE COUNCIL OF EUROPE FOLLOWING HIS VISIT TO MONTENEGRO FROM 17 TO 20 MARCH 2014 CommDH(2014)13 Summary .......................................................................................................................................................... 3 Introduction ..................................................................................................................................................... 5 1 Major issues pertaining to post-war justice and reconciliation ................................................................ 6 1.1 The need to end impunity for wartime crimes and provide effective redress to all war victims.............6 1.1.1 General ...............................................................................................................................................6 1.1.2 Domestic wartime criminal proceedings ............................................................................................7 1.1.3 Major issues concerning domestic wartime criminal proceedings ....................................................8 1.2 Protracted displacement of persons due to the 1990s’ wars ...................................................................9 1.2.1 The question of the legal status of displaced persons .......................................................................9 1.2.2 The situation of displaced persons in the Konik camps ...................................................................11 -

The Development Path of the Serbian Language and Script Matica Srpska – Members’ Society of Montenegro Department of Serbian Language and Literature
Jelica Stojanović THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT MATICA SRPSKA – MEMBERS’ SOCIETY OF MONTENEGRO DEPARTMENT OF SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE Title of the original Serbian Edition: Jelica Stojanović, Put srpskog jezika i pisma, Belgrade, Srpska književna zadruga, 2017, The Blue Edition series For the publisher JELICA STOJANOVIĆ Editor DRAGO PEROVIĆ Translation NOVICA PETROVIĆ ©Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2020. Jelica Stojanović THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT Podgorica 2020 MILOš KOVAčEVIć THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT, MADE UP OF STRAY PATHS Only two years have passed from the two hundredth anni- versary of the beginning of Vuk Karadžić’s struggle for “intro- ducing the folk language in literature”, that is to say, from the introduction of the Serbian folk language in the Serbian literary language, or to put it in the more modern phrasing of today: the standard language. The beginning of that struggle is connected to the year 1814, when, in the royal city of Vienna, Vuk’s first grammar book came out: The Orthography of the Serbian Lan- guage Based on the Speech of the Common Folk, which dealt with resolving the three most important standard-related issues: a) the issue of the Serbian orthography, b) the issue of the morpho- logical structure of the Serbian language, and c) the issue of the name of the language and its national boundaries. Rare are the languages, if, indeed, there are any, which have had such a turbulent history of two hundred years. The histor- ical development of a language can be followed at two histor- ical levels: that of its internal and that of its external history. -

RE-IMAGINING YUGOSLAVIA Learning and Living with Diverse Cultural Identities
RE-IMAGINING YUGOSLAVIA Learning and Living with Diverse Cultural Identities by Radoslav Draskovic A thesis submitted in conformity with the requirements For the degree of Master of Arts Graduate Department of Theory and Policy Studies in Education Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto ©Copyright by Radoslav Draskovic 2010. RE-IMAGINING YUGOSLAVIA Learning and Living with Diverse Cultural Identities Radoslav Draskovic Master of Arts, 2010 Department of Theory and Policy Studies in Education Ontario Institute for Studies in Education University of Toronto Abstract of Thesis: This thesis uses the example of Yugoslavia-the land of the South Slavs (also known as the Balkans) - to study how the twists and turns of historical evolution have been reflected in communal understanding of that history. Key words: imagined communities, nation-state, historical memory, the study of history. ii Acknowledgments: The great Mahatma Gandhi once said: “Whatever you do will be insignificant, but it is very important that you do it”. I found that this sentence appropriately describes every human endeavor including the road I have chosen for the last three years of my life. This thesis marks the conclusion of a deeply personal journey as well as a great learning experience that I had at the Ontario Institute for Studies in Education at University of Toronto At the end of this trip, before anyone else, I would like to thank my professors Harold Troper and David Levine who have taught me a great deal during the course of my studies, with their views, knowledge and advice. I am especially grateful to my mentor, Professor David Levine, for his intellectual guidance, patience and understanding of all the challenges that I met during the course of my study and while writing this thesis. -

Initial Indictment
THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA CASE NO. IT-01-42 THE PROSECUTOR OF THE TRIBUNAL AGAINST PAVLE STRUGAR MIODRAG JOKIC MILAN ZEC VLADIMIR KOVACEVIC INDICTMENT The Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, pursuant to her authority under Article 18 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ("the Statute of the Tribunal") charges: PAVLE STRUGAR, MIODRAG JOKIC, MILAN ZEC, and VLADIMIR KOVACEVIC With GRAVE BREACHES OF THE GENEVA CONVENTIONS and VIOLATIONS OF THE LAWS OR CUSTOMS OF WAR as set forth below: THE ACCUSED: 1. Pavle STRUGAR was born on 13 July 1933 in Pec, in present-day Kosovo. He graduated from the Military Academy for Ground Forces in 1952 and was thereafter assigned to various Yugoslav Peoples’ Army (the "JNA") posts in Slovenia and Serbia. He subsequently was promoted to Major General and was named Commander of the Military Academy for Ground Forces. In 1987, he was made the Commander of the Territorial Defence forces in Montenegro. In December 1989, he was promoted to Lieutenant General. In October 1991, he was named as the Commander of the Second Operational Group, which was formed by the JNA to conduct the military campaign against the Dubrovnik region of Croatia. On 26 August 1993, he was retired from the Yugoslav Army (the "VJ"). 2. Miodrag JOKIC was born in 1935 in Mionica, in the Valjevo municipality, of present-day Serbia. He graduated from the Yugoslav Military-Naval Academy and then served as an officer in various postings with the Yugoslav Navy. -

2001 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 4, 2002
Yugoslavia, Federal Republic of Page 1 of 44 Yugoslavia, Federal Republic of Country Reports on Human Rights Practices - 2001 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor March 4, 2002 (The report on the Federal Republic of Yugoslavia is discussed in three separate sections on Serbia, Kosovo, and Montenegro and addresses human rights situations in each of these entities. Since federal authority was exercised effectively only over the Republic of Serbia throughout the year, the human rights situations in Kosovo and Montenegro are dealt with in separate sections following this report.) The Federal Republic of Yugoslavia (Yugoslavia), a constitutional republic consisting of the Republic of Serbia and the Republic of Montenegro, has a president and a parliamentary system of government based on multiparty elections. Vojislav Kostunica was elected President of the Federation in elections held on September 24, 2000 that were closely contested; President Slobodan Milosevic ultimately was unable to manipulate the elections. Massive public protests forced Milosevic to recognize his defeat and cede power on October 6, 2000. Under the constitutional framework, the Federation encompasses the Republics of Serbia and Montenegro; however, the Montenegrin Government has refused to participate in many of the functions of the Federal Government and has acted unilaterally in several areas. The Federal Government presides over a weakened structure, with responsibilities essentially limited to the Foreign Ministry, the Yugoslav Army (VJ), the Customs Administration, civil aviation control, and foreign economic and commercial relations. Although President Kostunica enjoyed wide popular support, significant power was concentrated at the republic level where, in Serbia, Prime Minister Djindjic exercises significant executive authority. -

Strugar Et Al
Strugar et al. - Initial Indictment Page 1 of 12 THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA CASE NO. IT-01-42 THE PROSECUTOR OF THE TRIBUNAL AGAINST PAVLE STRUGAR MIODRAG JOKIC MILAN ZEC VLADIMIR KOVACEVIC INDICTMENT The Prosecutor of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, pursuant to her authority under Article 18 of the Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia ("the Statute of the Tribunal") charges: PAVLE STRUGAR, MIODRAG JOKIC, MILAN ZEC, and VLADIMIR KOVACEVIC With GRAVE BREACHES OF THE GENEVA CONVENTIONS and VIOLATIONS OF THE LAWS OR CUSTOMS OF WAR as set forth below: THE ACCUSED: 1. Pavle STRUGAR was born on 13 July 1933 in Pec, in present-day Kosovo. He graduated from the Military Academy for Ground Forces in 1952 and was thereafter assigned to various Yugoslav Peoples’ Army (the "JNA") posts in Slovenia and Serbia. He subsequently was promoted to Major General and was named Commander of the Military Academy for Ground Forces. In 1987, he was made the Commander of the Territorial Defence forces in Montenegro. In December 1989, he was promoted to Lieutenant General. In October 1991, he was named as the Commander of the Second Operational Group, which was formed by the JNA to conduct the military campaign against the Dubrovnik region of Croatia. On 26 August 1993, he was retired from the Yugoslav Army (the "VJ"). 2. Miodrag JOKIC was born in 1935 in Mionica, in the Valjevo municipality, of present-day Serbia. He graduated from the Yugoslav Military-Naval Academy and then served as an officer in various postings with the Yugoslav Navy. -
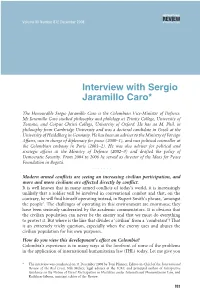
Download Review PDF , Format and Size of the File
Volume 90 Number 872 December 2008 Interview with Sergio Jaramillo Caro* The Honourable Sergio Jaramillo Caro is the Colombian Vice-Minister of Defence. Mr Jaramillo Caro studied philosophy and philology at Trinity College, University of Toronto, and Corpus Christi College, University of Oxford. He has an M. Phil. in philosophy from Cambridge University and was a doctoral candidate in Greek at the University of Heidelberg in Germany. He has been an adviser to the Ministry of Foreign Affairs, was in charge of diplomacy for peace (2000–1), and was political counsellor at the Colombian embassy in Paris (2001–2). He was also adviser for political and strategic affairs at the Ministry of Defence (2002–3) and drafted the policy of Democratic Security. From 2004 to 2006 he served as director of the Ideas for Peace Foundation in Bogota´. Modern armed conflicts are seeing an increasing civilian participation, and more and more civilians are affected directly by conflict. It is well known that in many armed conflicts of today’s world, it is increasingly unlikely that a soldier will be involved in conventional combat and that, on the contrary, he will find himself operating instead, in Rupert Smith’s phrase, ‘amongst the people’. The challenges of operating in this environment are enormous; they have been seriously underrated by the academic commentators. It is obvious that the civilian population can never be the enemy and that we must do everything to protect it. But where is the line that divides a ‘civilian’ from a ‘combatant’? That is an extremely tricky question, especially when the enemy uses and abuses the civilian population for his own purposes.