Otto Ill. - Heinrich 11
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Body/Soul Metaphor the Papal/Imperial Polemic On
THE BODY/SOUL METAPHOR THE PAPAL/IMPERIAL POLEMIC ON ELEVENTH CENTURY CHURCH REFORM by JAMES R. ROBERTS B.A., Catholic University of America, 1953 S.T.L., University of Sr. Thomas, Rome, 1957 J.C.B., Lateran University, Rome, 1961 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in » i THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES DEPARTMENT OF HISTORY We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA September, 1977 Co) James R. Roberts, 1977 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the Head of my Department or by his representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of The University of British Columbia 2075 Wesbrook Place Vancouver, Canada V6T 1W5 Date Index Chapter Page (Abst*ac't 'i Chronological list of authors examined vii Chapter One: The Background . 1 Chapter Two: The Eleventh Century Setting 47 Conclusion 76 Appendices 79 A: Excursus on Priestly Dignity and Authority vs Royal or Imperial Power 80 B: Excursus: The Gregorians' Defense of the Church's Necessity for Corporal Goods 87 Footnotes 92 ii ABSTRACT An interest in exploring the roots of the Gregorian reform of the Church in the eleventh century led to the reading of the polemical writings by means of which papalists and imperialists contended in the latter decades of the century. -

The Idea of Medieval Heresy in Early Modern France
The Idea of Medieval Heresy in Early Modern France Bethany Hume PhD University of York History September 2019 2 Abstract This thesis responds to the historiographical focus on the trope of the Albigensians and Waldensians within sixteenth-century confessional polemic. It supports a shift away from the consideration of medieval heresy in early modern historical writing merely as literary topoi of the French Wars of Religion. Instead, it argues for a more detailed examination of the medieval heretical and inquisitorial sources used within seventeenth-century French intellectual culture and religious polemic. It does this by examining the context of the Doat Commission (1663-1670), which transcribed a collection of inquisition registers from Languedoc, 1235-44. Jean de Doat (c.1600-1683), President of the Chambre des Comptes of the parlement of Pau from 1646, was charged by royal commission to the south of France to copy documents of interest to the Crown. This thesis aims to explore the Doat Commission within the wider context of ideas on medieval heresy in seventeenth-century France. The periodization “medieval” is extremely broad and incorporates many forms of heresy throughout Europe. As such, the scope of this thesis surveys how thirteenth-century heretics, namely the Albigensians and Waldensians, were portrayed in historical narrative in the 1600s. The field of study that this thesis hopes to contribute to includes the growth of historical interest in medieval heresy and its repression, and the search for original sources by seventeenth-century savants. By exploring the ideas of medieval heresy espoused by different intellectual networks it becomes clear that early modern European thought on medieval heresy informed antiquarianism, historical writing, and ideas of justice and persecution, as well as shaping confessional identity. -

Popes in History
popes in history medals by Ľudmila Cvengrošová text by Mons . Viliam Judák Dear friends, Despite of having long-term experience in publishing in other areas, through the AXIS MEDIA company I have for the first time entered the environment of medal production. There have been several reasons for this decision. The topic going beyond the borders of not only Slovakia but the ones of Europe as well. The genuine work of the academic sculptress Ľudmila Cvengrošová, an admirable and nice artist. The fine text by the Bishop Viliam Judák. The “Popes in history” edition in this range is a unique work in the world. It proves our potential to offer a work eliminating borders through its mission. Literally and metaphorically, too. The fabulous processing of noble metals and miniatures produced with the smallest details possible will for sure attract the interest of antiquarians but also of those interested in this topic. Although this is a limited edition I am convinced that it will be provided to everybody who wants to commemorate significant part of the historical continuity and Christian civilization. I am pleased to have become part of this unique project, and I believe that whether the medals or this lovely book will present a good message on us in the world and on the world in us. Ján KOVÁČIK AXIS MEDIA 11 Celebrities grown in the artist’s hands There is one thing we always know for sure – that by having set a target for himself/herself an artist actually opens a wonderful world of invention and creativity. In the recent years the academic sculptress and medal maker Ľudmila Cvengrošová has devoted herself to marvellous group projects including a precious cycle of male and female monarchs of the House of Habsburg crowned at the St. -

Absolute Monarchs a History of the Papacy 1St Edition Ebook
ABSOLUTE MONARCHS A HISTORY OF THE PAPACY 1ST EDITION PDF, EPUB, EBOOK John Julius Norwich | 9780812978841 | | | | | Absolute Monarchs A History of the Papacy 1st edition PDF Book This message will appear once per week unless you renew or log out. Show More. Disappointed by the renaissance Popes, I thought the era of the enlightenment would be better — nope. It was all just too jumbled for me. I've always been interested in religious history, probably comes from growing up in the Philippines. Some are more myths, rumors, and stories than historical fact, esp. And that is the book, pretty much: Names, dates, wars, and the judgments of an elderly British aristocrat. Welcome back. The worst problems of the book are in the first and the last one hundred pages. Reading two thousand years of history with this enormous cast of characters is hard work. The rest, unfortunately, is just history. Surprisingly, I enjoy this book quite a bit. And here, surely, is the crux of the matter. What I liked least was finding out that if the Pope was a good guy, he would probably be killed fairly soon. Critic Reviews "Norwich doesn't skirt controversies, ancient and present, in this broad, clear-eyed assessment. This is not necessarily because of its history, or what I view as a colossal waste of time and money that could be put to better use, but rather because the Catholic church, to this day, adheres to a set of dogmas that are clearly harmful and in my opinion immoral. Add to Cart failed. -
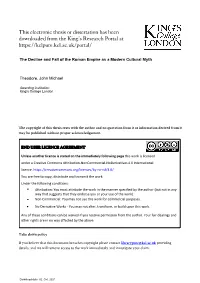
2014 Theodore Jonathan 0970
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The Decline and Fall of the Roman Empire as a Modern Cultural Myth Theodore, John Michael Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 02. Oct. 2021 The Decline and Fall of the Roman Empire as a Modern Cultural Myth JONATHAN THEODORE King’s College London Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of London Department of Culture, Media and Creative Industries School of Arts and Humanities September 2014 1 ACKNOWLEDGEMENTS It would be all too easy to spread the net of debt and gratitude as wide as possible, but I will keep this short and sincere. -

Popes from St. Peter
POPES FROM ST. PETER (Chronological list of popes from St. Peter to Benedict XVI) Sl. No. Papal Name Photo Elected Date Died Date Place of birth Notes 1st Centuary Disciple of Jesus from whom he received the keys to the Kingdom of Heaven, according to Matthew 16:18–19 . Executed by crucifixion upside-down; feast day (Feast Bethsaida, of Saints Peter and Paul) 29 June, (Chair of 1 St Peter - 67 Galilea Saint Peter) 22 February. Recognized as the first Bishop of Rome (Pope) appointed by Christ, by the Catholic Church. Also revered as saint in Eastern Christianity, with a feast day of 29 June. Pope Saint Linus was, according to several early sources, Bishop of the diocese of Rome after Saint Peter. This makes Linus Tuscia (Central the second Pope. Linus is the only person 2t S Linus 67 76 Tuscany) specifically mentioned in the New Testament, other than Peter, considered by the Catholic Church to have held the position of Pope. Martyred; feast day 26 April. Once Probably Greece 3t S Anacletus 76 88 erroneously split into Cletus and Anacletus. Feast day 23 November. Also revered as a 4t S Clement I 88 97 Rome saint inEastern Christianity, with a feast day of 25 November. 5 St Evaristus 97 105 Bethlehem, Judea Feast day 26 October 2nd Century Also revered as a saint in Eastern Rome 6t S Alexander I 105 115 Christianity, with a feast day of 16 March. Also revered as a saint in Eastern Rome or Greece 7 St Sixtus I 115 125 Christianity, with a feast day of 10 August. -

Saeculum Obscurum – Der Epigraphische Befund (Ca. 890–1000)
Wolf Zöller: Saeculum obscurum – der epigraphische Befund (ca. 890–1000) Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 99 (2019) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom DOI 10.1515/qfiab-2019-0007 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Wolf Zöller Saeculum obscurum – der epigraphische Befund (ca. 890–1000) 1 Einleitung 5 Papstepitaphien an der Wende zum 2 Quellencorpus und Forschungs 11. Jahrhundert stand 6 Grabinschriften des römischen 3 Papstepitaphien und formosia Adels nische Krise 7 Fazit 4 Bau, Weihe und Stifterinschriften Riassunto: Questo saggio offre gli esiti di un’indagine condotta sulla produzione epi grafica della Roma altomedioevale, ponendo in particolare l’accento sugli aspetti topo logici e materiali delle iscrizioni commissionate da parte dei vescovi romani e degli esponenti della nobiltà cittadina durante il X secolo. Nonostante esistano ponderosi corpora che raccolgono le iscrizioni romane, manca purtroppo a tutt’oggi una rasse gna specifica della produzione epigrafica dell’Urbe per il periodo che va dall’anno 890 all’anno 1000, periodo comunemente noto come saeculum obscurum. Proprio le testimonianze epigrafiche, invece, consentono di giungere a una comprensione più profonda del linguaggio materiale e dei meccanismi di comunicazione utilizzati per la rappresentazione del potere all’interno della struttura urbana della città di Roma. -

Sunday School
ChurchChurch HistoryHistory ChurchChurch HistoryHistory IntroductionIntroduction toto ChurchChurch HistoryHistory st rd TheThe AncientAncient ChurchChurch AD 11st-3-3rd centuriescenturies th th TheThe RiseRise ofof ChristendomChristendom AD 44th-5-5th centuriescenturies th th TheThe EarlyEarly MiddleMiddle AgesAges AD 66th-10-10th centuriescenturies th th TheThe AgeAge ofof CrusadesCrusades AD 1111th-13-13th centuriescenturies th th TheThe RenaissanceRenaissance AD 1414th-15-15th centuriescenturies th ConquestConquest andand ReformationReformation AD 1616th centurycentury th th TheThe AgeAge ofof EnlightenmentEnlightenment AD 1717th-18-18th centuriescenturies th TheThe AgeAge ofof RevolutionRevolution AD 1919th centurycentury th TheThe ModernModern AgeAge AD 2020th centurycentury st TheThe PostmodernPostmodern AgeAge AD 2121st centurycentury ChurchChurch HistoryHistory IntroductionIntroduction toto ChurchChurch HistoryHistory st rd TheThe AncientAncient ChurchChurch AD 11st-3-3rd centuriescenturies th th TheThe RiseRise ofof ChristendomChristendom AD 44th-5-5th centuriescenturies th th TheThe EarlyEarly MiddleMiddle AgesAges AD 66th-10-10th centuriescenturies The “Dark Ages” Overview Flagrant Abuses of Authority: Zeno, Theodoric, and Clovis Auctoritas Sacrata Pontificum: Gelasius The Rise of the Monk: Benedict, Brendan, and Dennis The Politics of Death: Justinian and Columba Kingdoms of God Streamlining the Church European Empires: The Carolingians European Empires: The Northmen Centuries of In-Fighting (part 2) TheThe EarlyEarly MiddleMiddle -

Read Book Pornocracy
PORNOCRACY PDF, EPUB, EBOOK Catherine Breillat,Paul Buck,Catherine Petit,Chris Kraus,Peter Sotos | 136 pages | 15 Aug 2008 | AUTONOMEDIA | 9781584350477 | English | New York, United States Pornocracy PDF Book This epoch deserves to be designated under the title of the Pornocracy ; that is to say, the government of prostitutes, for Theodora , Marozia , and other ladies of rank at that time, placed on the pontifical throne their paramours and their sons, who were no better than themselves. Pornocracy is the first of her novels to be published in English. See also: Pornocracy. Namespaces Entry Discussion. Whilst it is a slur, it does accurately represent the sleaze element of their respective administrations. Alberic II of Spoleto — Pope Benedict IX — Liutprand affirms that Marozia arranged the murder of her former lover Pope John X who had originally been nominated for office by Theodora through her then husband Guy of Tuscany possibly to secure the elevation of her current favourite as Pope Leo VI. Hugh of Italy also married Marozia. Eee-o eleven Marozia — Thoughts and prayers. Could views of theater women transcend fears of sexual indulgence and seduction so that actresses might become honored citizens? Distributed for Semiotext e. Paris: Michel Levy, After several Crescentii family Popes up to , the Theophylacti still occasionally nominated sons as Popes:. Adapted and directed for film in France by Breillat as Anatomy of Hell , Pornocracy leads the reader through an undulating and atmospheric exploration of the criminal and the erotic, finally climaxing in a place well beyond more familiar moral terrain. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. -

Erik Von Kuehnelt-Leddihn: the Intelligent American’S Guide to Europe (1979) Study Guide
Scholars Crossing Faculty Publications and Presentations Helms School of Government 2009 Erik von Kuehnelt-Leddihn: The Intelligent American’s Guide to Europe (1979) Study Guide Steven Alan Samson Liberty University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.liberty.edu/gov_fac_pubs Part of the Other Social and Behavioral Sciences Commons, Political Science Commons, and the Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons Recommended Citation Samson, Steven Alan, "Erik von Kuehnelt-Leddihn: The Intelligent American’s Guide to Europe (1979) Study Guide" (2009). Faculty Publications and Presentations. 130. https://digitalcommons.liberty.edu/gov_fac_pubs/130 This Article is brought to you for free and open access by the Helms School of Government at Scholars Crossing. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications and Presentations by an authorized administrator of Scholars Crossing. For more information, please contact [email protected]. 1 ERIK VON KUEHNELT-LEDDIHN: THE INTELLIGENT AMERICAN’S GUIDE TO EUROPE (1979) STUDY GUIDE, 2002-2014 Steven Alan Samson INTRODUCTION Outline and Study Questions 1. What is the great “ crease ” that divides western civilization, and why? [Other major creases include the great divide between the Catholic and Eastern Orthodox parts of Europe and the northernmost frontiers of the ancient Roman Empire]. Why is it so difficult for the average American to know and understand the outside world? Lingua franca means “free tongue,” implying a common language. Why do geography and history suffer neglect in Anglo-American higher education ? (9-10) 2. What are some sources and some consequences of the typical misunderstanding between Anglo-Saxons and Continentals? Why did the seeds of American and British foreign policy (toward Mexico and others) nearly always bear evil fruit? (10-13) 3. -

Papacy of the Piuses.” His Tifical Names in the Modern Era
OLDEST DAUGHTER OF THE CHURCH schism (c. 11). If the author of the offense is a cleric, he official documents, and in the works of sacred orators; it could also be assigned an expiatory punishment ferendae has taken the form “Elder Daughter” when applied to a sententiae: interdict, removal from office, or of favors, queen (Catherine de Medici is so called in a letter from privileges, etc. that he had received and of their use (c. the nuncio Prospero Santacroce in 1564). And, the glory 1336, 1°, no. 1–3). In case of prolonged obstinacy or a of the sovereign flows out over his kingdom: GREGORY particularly serious scandal, other punishments could be IX declared to Saint Louis in 1239 that “the kingdom of added, including revoking his clerical status (c. 1364 § 2), France was placed by God above all peoples,” and in which would not include a dispensation from the law of 1562 we find the expression “elder kingdom of the celibacy (c. 291). Church,” which might be seen as an early version of the Dominique Le Tourneau present wording. The mass celebrated every year on 31 May in honor of St. Petronilla in St. Peter’s Basilica in the presence of the French ambassador and the French OLDEST DAUGHTER OF THE CHURCH. The ex- colony is, still today, reminiscent of the Holy See’s secu- pression “Oldest Daughter of the Church,” applied to lar predilection for France. France in reference to its conversion to Catholicism ear- Bernard Barbiche lier than the other nations of western Europe, seems to be of fairly recent origin; it appears in neither the Littré Bibliography (1865) nor in the Larousse Grand Dictionnaire uni- versel du XIXe siècle (1872). -

List of Popes
Numerical Name Personal Pontificate Place of birth Notes order English · Regnal name 1st Century Apostle of Jesus from whom he received the keys to the Kingdom of Heaven, according to Matthew 16:18–19. Executed by crucifixion Simon Peter upside-down; feast day (Feast of CΙΜΗΟΝ Saints Peter and Paul) 29 June, St Peter Bethsaida, 1 33 – 64/67 ΚΗΦΑC (Chair of Saint Peter) 22 February. PETRUS Galilea (contemporary Recognized by the Catholic Greek) Church as the first Bishop of Rome appointed by Christ. Also revered as saint in Eastern Christianity, with a feast day of 29 June. Feast day 23 September. Also 64/67(?) – St Linus revered as a saint in Eastern 2 Linus Tuscia 76/79(?) LINUS Christianity, with a feast day of 7 June. St Anacletus Martyred; feast day 26 April. Once 76/79(?) – 3 (Cletus) Anacletus Rome erroneously split into Cletus and 88/92 ANACLETUS Anacletus Feast day 23 November. Also St Clement I revered as a saint in Eastern 4 88/92 – 97 Clement Rome CLEMENS Christianity, with a feast day of 25 November. 97/99 – St Evaristus Bethlehem, 5 Aristus Feast day 26 October 105/107 EVARISTUS Judea 2nd Century Also revered as a saint in Eastern 105/107 – St Alexander I 6 Alexander Rome Christianity, with a feast day of 16 115/116 ALEXANDER March. 6 April. Also revered as a saint in St Sixtus I 7 115/116 – 125 Xystus Rome Eastern Christianity, with a feast XYSTUS day of 10 August. Terranova da St Telesphorus 8 125 – 136/138 Telesphorus Sibari, TELESPHORUS Calabria 136/138 – St Hyginus Athens, Traditionally martyred; feast day 9 Hyginus 140/142 HYGINUS Greece 11 January St Pius I Aquileia, Martyred by sword; feast day 11 10 140/142 – 155 Pius PIUS Friuli July St Anicetus Traditionally martyred; feast day 11 155–166 Anicitus Emesa, Syria ANICETUS 17 April c.