Antonio Rosetti (B. Litomerice [Leitmeritz], Ca. 1750 – D
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
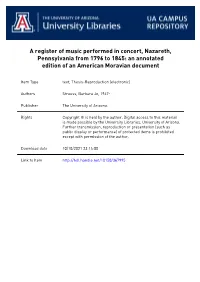
A Register of Music Performed in Concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an Annotated Edition of an American Moravian Document
A register of music performed in concert, Nazareth, Pennsylvania from 1796 to 1845: an annotated edition of an American Moravian document Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Strauss, Barbara Jo, 1947- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 23:14:00 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/347995 A REGISTER OF MUSIC PERFORMED IN CONCERT, NAZARETH., PENNSYLVANIA FROM 1796 TO 181+52 AN ANNOTATED EDITION OF AN AMERICAN.MORAVIAN DOCUMENT by Barbara Jo Strauss A Thesis Submitted to the Faculty of the SCHOOL OF MUSIC In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC WITH A MAJOR IN MUSIC HISTORY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 1 9 7 6 Copyright 1976 Barbara Jo Strauss STATEMENT BY AUTHOR This thesis has been submitted in partial fulfill ment of requirements for an advanced degree at The Univer sity of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that accurate ac knowledgment of source is made. Requests for permission for extended quotation from or reproduction of this manu script in whole or in part may -
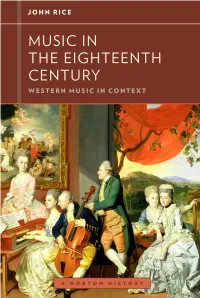
MUSIC in the EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: a Norton History Walter Frisch Series Editor
MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY Western Music in Context: A Norton History Walter Frisch series editor Music in the Medieval West, by Margot Fassler Music in the Renaissance, by Richard Freedman Music in the Baroque, by Wendy Heller Music in the Eighteenth Century, by John Rice Music in the Nineteenth Century, by Walter Frisch Music in the Twentieth and Twenty-First Centuries, by Joseph Auner MUSIC IN THE EIGHTEENTH CENTURY John Rice n W. W. NORTON AND COMPANY NEW YORK ē LONDON W. W. Norton & Company has been independent since its founding in 1923, when William Warder Norton and Mary D. Herter Norton first published lectures delivered at the People’s Institute, the adult education division of New York City’s Cooper Union. The firm soon expanded its program beyond the Institute, publishing books by celebrated academics from America and abroad. By midcentury, the two major pillars of Norton’s publishing program— trade books and college texts—were firmly established. In the 1950s, the Norton family transferred control of the company to its employees, and today—with a staff of four hundred and a comparable number of trade, college, and professional titles published each year—W. W. Norton & Company stands as the largest and oldest publishing house owned wholly by its employees. Copyright © 2013 by W. W. Norton & Company, Inc. All rights reserved Printed in the United States of America Editor: Maribeth Payne Associate Editor: Justin Hoffman Assistant Editor: Ariella Foss Developmental Editor: Harry Haskell Manuscript Editor: JoAnn Simony Project Editor: Jack Borrebach Electronic Media Editor: Steve Hoge Marketing Manager, Music: Amy Parkin Production Manager: Ashley Horna Photo Editor: Stephanie Romeo Permissions Manager: Megan Jackson Text Design: Jillian Burr Composition: CM Preparé Manufacturing: Quad/Graphics—Fairfield, PA Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Rice, John A. -

Süddeutsche Hofkapellen Im 18. Jahrhundert
Süddeutsche Hofkapellen im 18. Jahrhundert Eine Bestandsaufnahme Herausgegeben von Silke Leopold und Bärbel Pelker ISBN 978-3-946054-00-9 UP HEIDELBERG 9 783946 054009 hei UNIVERSITY PUBLISHING Die Initialzundung zu dieser Publikation gab ein Symposium uber suddeutsche Hofkapellen, das 2003 von der Forschungsstelle Geschichte der Mannheimer Hofkapelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Schwetzingen veranstaltet wurde. Auf der Grundlage eines einheitlich vorgegebenen Themen- kataloges sollten der gegenwärtige Forschungsstand und die Strukturen der Hof- und Adelskapellen erstmals vergleichend erfasst und dokumentiert werden. Der herzliche Dank der Herausgeberinnen gilt vor allem den Autoren, die sich mit viel Engagement und Geduld dem uber mehrere Jahre währenden Entste- hungsprozess gewidmet haben. Sie danken auch den vielen Archiven, Bibliothe- ken und Museen im suddeutschen Raum sowie den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg fur ihre Unterstutzung. Ein ganz besonderer Dank gilt Kara Rick fur ihre wertvolle redaktionelle Mitarbeit sowie Jelena Rothermel und Johannes Sturm fur weiteres Korrekturlesen. Die Redaktion hat sich bemüht, die Rechteinhaber der Abbildungen zu ermitteln. Falls trotzdem etwas übersehen wurde, möchten wir Sie herzlich bitten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abruf bar. Dieses Werk ist unter der Creative Commons-Lizenz 4.0 (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Die Online-Version dieser Publikation ist auf den Verlagswebseiten von Heidelberg University PUBLISHING http://heiup.uni-heidelberg.de dauerhaft frei verfügbar (open access). urn: urn:nbn:de:bsz:16-heiup-book-347-3 doi: https://doi.org/10.17885/heiup.347.479 Unveränderte Wiederveröffentlichung der Erstausgabe von 2014. -

CM0012005 Booklet:CM0012005 Booklet
Antonio Rosetti (ca.1750 – 1792) BOHEMIAN MUTINEER PRATUM INTEGRUM ORCHESTRA Sinfonie D-dur (Murray A21) Symphony in D major (Murray A21) 1. Largo. Allegro assai . [7:39] 2. Andante scherzante. [6:22] 3. Menuetto fresco . [3:43] 4. Allegro moderato . [5:24] Konzert d-moll für Horn und Orchester (Murray C38) Concerto for horn and orchestra in D minor (Murray C38) 5. Allegro molto . [9:38] Total 6. Adagio (cadenza by H. MacDougall) . [5:27] Time 7. Rondo. Allegro . [5:12] [81:00] Konzert d-moll für Violine und Orchester (Murray C9) Concerto for violin and orchestra in D minor (Murray C9) 8. Allegro maestoso (cadenza by A. Rosetti) . [9:05] 9. Adagio (cadenza by A. Rosetti) . [6:26] 10. Rondo. Moderato (cadenza by D. Sinkovsky). [5:56] Sinfonie g-moll (Murray A42) Symphony in G minor (Murray A42) 11. Vivace. [6:45] 12. Menuetto fresco . [2:31] 13. Andante ma Allegretto. [3:41] BOHEMIAN MUTINEER 14. Capriccio. Allegretto scherzante . [2:47] Antonio Rosetti (ca. 1750 – 1792), born in Bohemia, spent the best years of his life in Germany, in small principalities, far 4 removed from the music capitals of his age. However, the English ENGLISH music historian Charles Burney, who undertook extensive travels in Europe, ranked him among the most outstanding musicians of his time and as the equal of Haydn and Mozart. The public loved Rosetti – and there is plenty of documentary evidence to show that his works were often played throughout Europe. By the end of the 1790s, at least half of those of Rosetti’s compositions that have come down to us had been published, some of them, more- over, by very well-established music publishers. -

DETERMINING the AUTHENTICITY of the CONCERTO for TWO HORNS, Woo. 19, ATTRIBUTED to FERDINAND RIES
DETERMINING THE AUTHENTICITY OF THE CONCERTO FOR TWO HORNS, WoO. 19, ATTRIBUTED TO FERDINAND RIES Amy D. Laursen, B.M.E., M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS December 2015 APPROVED: William Scharnberg, Major Professor Kris Chesky, Related Field Professor Brian Bowman, Committee Member Benjamin Brand, Director of Graduate Studies, College of Music James Scott, Dean of the College of Music Costas Tsatsoulis, Dean of the Toulouse Graduate School Laursen, Amy D. Determining the Authenticity of the Concerto for Two Horns, WoO. 19, Attributed to Ferdinand Ries. Doctor of Musical Arts (Performance), December 2015, 100 pp., 1 table, 27 figures, 57 musical examples, references, 108 titles. Ferdinand Ries is credited as the composer of the Concerto for Two Horns, WoO. 19 preserved in the Berlin State Library. Dated 1811, ostensibly Ries wrote it in the same year as his Horn Sonata, Op. 34, yet the writing for the horns in the Concerto is significantly more demanding. Furthermore, Ries added to the mystery by not claiming the Concerto in his personal catalog of works or mentioning it in any surviving correspondence. The purpose of this dissertation is to study the authorship of the Concerto for Two Horns and offer possible explanations for the variance in horn writing. Biographical information of Ries is given followed by a stylistic analysis of Ries’s known works. A stylistic analysis of the Concerto for Two Horns, WoO. 19 is offered, including a handwriting comparison between the Concerto for Two Horns and Ries’s Horn Sonata. Finally, possible explanations are proposed that rationalize the variance in horn writing between the Concerto for Two Horns, WoO. -
Download Booklet
adagio theChristmas ultimate collection Chill The Ultimate2 Collection Copyright all tracks public domain DDD 8.578062-63 4 CD 1 CD 2 1 Tomaso Albinoni (1671–1751) Adagio from Concerto for two oboes Op 9 No 12 3:15 1 Johann Sebastian Bach Adagio from Easter Oratorio 5:08 Alison Alty & Anthony Camden (oboes), London Virtuosi, John Georgiadis (conductor) Budapest Strings 2 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Adagio from Divertimento No 15 K287 8:36 2 Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) Adagio from Violin Concerto (completed by Gregory Rose) 2:56 Capella Istropolitana, Harald Nerat (conductor) Alexander Trostiansky (violin), Russian Philharmonic Orchestra, Gregory Rose (conductor) 3 Johann Sebastian Bach (1685–1750) Adagio ma non tanto e dolce from Triple Concerto 6:11 3 Leopold Hofmann Adagio from Oboe Concerto in C major 5:42 Cologne Chamber Orchestra, Helmut Müller-Brühl (conductor) Stefan Schilli (oboe), Nicolaus Esterházy Sinfonia, Béla Drahos (conductor) 4 Leopold Hofmann (1738–1793) Adagio cantabile from Oboe and Harpsichord Concerto in F major 8:38 4 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Concerto for Two Pianos and Orchestra No 7 K242 8:36 Jen Jand , D nes Várjon (pianos), Concentus Hungaricus, Mátyás Antal (conductor) Stefan Schilli (oboe), Jenő Jandó (harpsichord), Nicolaus Esterházy Sinfonia, Béla Drahos (conductor) ő ó é 5 Franz Joseph Haydn (1732–1809) Adagio from Piano Concerto No 9 in G major 8:56 5 Luigi Boccherini Adagio from Cello Concerto in G major G480 6:33 Tim Hugh (cello), Scottish Chamber Orchestra, Anthony Halstead (conductor) -

Austro-German Classical Era Horn Works: a Study in Style and Performance Practice
AUSTRO-GERMAN CLASSICAL ERA HORN WORKS: A STUDY IN STYLE AND PERFORMANCE PRACTICE By Bradley Alan Tatum Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts 2010 Advisory Committee: Gregory Miller, Chair Dr. Michael Votta Dr. Richard King Chris Gekker Dr. Peter Beicken ABSTRACT Title of Document: AUSTRO-GERMAN CLASSICAL ERA HORN WORKS: A STUDY IN STYLE AND PERFORMANCE PRACTICE Bradley Alan Tatum, 2010, Doctor of Musical Arts Directed By: Associate Professor, Horn, Gregory Miller, School of Music, Wind and Percussion Division The horn has a long history in Western music that began in the Baroque Era and has progressed through several incarnations into the instrument we know today. The Classical Era in particular produced an enormous body of solo literature for the horn that is still in high demand today. Specifically, Mozart’s concertos are performed on every professional audition and have been recorded on numerous CDs. Every hornist attempts to perform these works in a musically satisfying way, but modern performers often neglect studying this music in context. This dissertation seeks to bring musicians a thorough approach to Classical works for horn by Austro- German composers. The lack of recordings from the late 18 th and early 19 th centuries makes it difficult to emulate performances of the Classical Era, and only through reading books written slightly before, during, and after this time period can modern musicians achieve an approximation of authentic historical performance. This, combined with a thorough study of the natural horn and its capabilities, can lead to musically satisfying and classically enlightened performances of these works on modern instruments. -

Ignace Joseph Pleyel's Parthia In
Ignace Joseph Pleyel’s Parthia in Dis: A Study and Critical Edition D.M.A. Document Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Arts in the Graduate School of The Ohio State University By John Anthony Oelrich Graduate Program in Music The Ohio State University 2012 DMA Document Committee: Russel Mikkelson, Advisor Richard Blatti Robert Ward Charles Atkinson Copyright by John Anthony Oelrich 2012 ii Abstract Though he has slipped from the mainstream of music history, Ignace Pleyel was a significant figure in the musical life of the late 18th to early 19th centuries. He was a significant musical figure in many of Europe’s major cities, and for a number of years his works were published more than any other composer. Writing in large scale orchestral and chamber settings, Pleyel’s contributions to the repertoire are representative of the musical style associated with Classical period while also containing unique features. Pleyel’s Symphonie Concertante in Eb was a popular piece throughout Europe from approximately 1790 -1810 as evidenced by the 79 published editions and 38 manuscript extant copies. Of these settings, there are two wind arrangements in the form of manuscript parts in the Badische Landesbibliothek in Karlsruhe, Germany. The older of these sets, shelf mark Don Mus. Ms. 1571, titles the work Parthia in Dis and was used as the primary source for the creation of a critical edition. A comparison of the two wind arrangements revealed that the structure, range, tonal scheme, texture, and the placement of thematic and accompanimental material are treated almost identically. -

The Debated Authenticity of Franz Joseph Haydn's Concertos for Horn
The Debated Authenticity of Franz Joseph Haydn’s Concertos for Horn: An Historical and Theoretical Approach to Attribution A document submitted to the Graduate School of the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in the Performance Studies Division of the College-Conservatory of Music 2010 by Anna Marie Leverenz B.M., Southern Illinois University, 2005 M.M. Illinois State University, 2007 Committee Chair: Professor Randy Gardner Abstract Of the three horn concertos attributed to Franz Joseph Haydn only one, the concerto Hob. VIId: 3, can be proven as an authentic composition. The concertos published as Hob. VIId: 2 and Hob. VIId: 4 are thought by musicologists to be spurious attributions. Current scholarship suggests that the concerto Hob. VIId: 2 would be better attributed to Antonio Rosetti, and that the concerto Hob. VIId: 4 may be a work of Michael Haydn. This document considers these possible misattributions and compares the concertos to known works of Joseph Haydn, Michael Haydn, and Antonio Rosetti. A survey of the historical background of these composers and their individual compositional styles is examined and compared with the circumstances of the concertos in question in order to understand the causes of, and correct, the misattributions. ii © 2011 Anna Marie Leverenz All rights reserved iii Preface In the spring of 2009, I enrolled in Dr. Mary Sue Morrow‟s eighteenth-century advanced topics course on Joseph Haydn‟s symphonies. In this class we studied all of Haydn‟s symphonies, either as a group or individually, culminating in a final project with a focus of our choice. -

Swr2 Programm Kw 27
SWR2 PROGRAMM - Seite 1 - KW 27 / 05. - 11.07.2021 5.03 ARD-Nachtkonzert 9.05 SWR2 Musikstunde Montag, 05. Juli Wolfgang Amadeus Mozart: Ein früher Klassiker – „Così fan tutte“, Ouvertüre Johann Christian Bach (1) 0.03 ARD-Nachtkonzert Orchester der norwegischen Mit Jan Ritterstaedt Max Bruch: Nationaloper Sinfonie Nr. 1 Es-Dur op. 28 Leitung: Rinaldo Alessandrini Johann Christian Bachs Musik übt gro- Gewandhausorchester Leipzig Claude Debussy: ßen Einfluss auf den jungen Mozart aus. Leitung: Kurt Masur „Lindaraja“ Sie bezaubert das Londoner Publikum Johannes Brahms: Vladimir und Vovka Ashkenazy (Klavier) und macht den jüngsten Bachsohn dort „Fest- und Gedenksprüche“ op. 109 Johann Stamitz: zu einem Star. Mit dem Gambisten Carl Rundfunkchor Leipzig Sinfonie G-Dur Friedrich Abel teilt er nicht nur die Woh- Leitung: Wolf-Dieter Hauschild Concerto Köln nung, sondern auch eine gemeinsame Arvo Pärt: Ernest Chausson: Konzertreihe. Die SWR2 Musikstunde „Fratres“ Andante und Allegro auf den Spuren des „Londoner“ oder MDR-Sinfonieorchester Charles Neidich (Klarinette) „Mailänder“ Bach. Leitung: Kristjan Järvi Pascal Devoyon (Klavier) Joseph Haydn: Niels Wilhelm Gade: 10.00 Nachrichten, Wetter Sonate e-Moll Hob. XVI/47bis Finale aus der Sinfonie Ragna Schirmer (Klavier) Nr. 7 F-Dur op. 45 10.05 SWR2 Treffpunkt Klassik Christoph Willibald Gluck: Danish National Radio Symphony Musik. Meinung. Perspektiven. „Orphée et Eurydice“, Ballettmusiken Orchestra Kammerorchester Leitung: Christopher Hogwood 11.57 SWR2 Kulturtipps Carl Philipp Emanuel Bach Johannes Brahms: Leitung: Hartmut Haenchen Aus „16 Walzer“ op. 39 12.00 Nachrichten, Wetter Ernst Wilhelm Wolf: Klavierduo Martina und Kristina Bauer Sinfonia G-Dur Jean-Philippe Rameau: 12.05 SWR2 Aktuell Staatskapelle Weimar „Naïs“, Ouvertüre Leitung: Peter Gülke Le Concert des Nations 12.30 Nachrichten Leitung: Jordi Savall 2.00 Nachrichten, Wetter 12.33 SWR2 Journal am Mittag 6.00 SWR2 am Morgen Das Magazin für Kultur und Gesellschaft 2.03 ARD-Nachtkonzert darin bis 8.30 Uhr: Eugène Ysaye: u. -

Newslet T Er
6767 7 6 s s 6 s CIETY . O s 7 Ss F 7 . O s Cs R I 6 S . 6 s E U s I 7 G M s 7 s H . SECM 6 T Y s s 6 R E 7 E U s s N T 7 T N NEWSLETTER E s H s - C s s 6 6 7 7 6 6 7 ISSUE NO. 9 OCTOBER 2006 “Genre in Eighteenth-Century Music” opment within the Neapolitan commedia per musica, especially in the libretti of Francesco Zini, giving insight into the inner work- SECM Second Biennial Conference ings of Neapolitan intellectual life. Williamsburg, Virginia, 21–23 April 2006 The session on Saturday morning presented two very different approaches to a consideration of London opera. Richard Hardie focused on instrumental partbooks issued by John Walsh, and R. Todd Rober convincingly demonstrated these publications were designed to The sights and sounds of the restored historic area of Colonial coordinate with vocal partbooks to accommodate a variety of per- Williamsburg provided the backdrop for the venue for SECM’s formance situations, suggesting a thriving life of amateur perfor- second biennial conference entitled “Genre in Eighteenth-Cen- mances of operas (or sections thereof ) across England. Michael tury Music.” While rain put a damper on some of the sightseeing Burden argued in his paper that a unique combination of the com- possibilities during parts of the weekend, the quality and diversity plexity and flair of the Italian opera with the simpler song style of of the fourteen paper presentations, a fortepiano concert by Mal- English opera helped Thomas Arne’s Artaxerxes remain popular colm Bilson, and a special presentation on instrument conservation over more than sixty years. -

An Examination of Selected Double Horn Concerti from Baroque to Romantic
An Examination of Selected Double Horn Concerti from Baroque to Romantic By Lindsay Marie Smith, BM, MM A Document In Performance Submitted to the Graduate Faculty Of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS Performance (Horn) Approved Christopher M. Smith Chairperson of the Committee Lisa Rogers James Decker Accepted Mark Sheridan Dean of the Graduate School May 2019 Copyright 2019, Lindsay Marie Smith Texas Tech University, Lindsay Marie Smith, May 2019 TABLE OF CONTENTS Abstract . .iv List of Figures. .v Chapter I. Introduction . .1 Overview of the Study. .1 Justification for the Study . .3 Limitations of the Study . 4 Review of Literature . .4 II. The Development of the Double Horn Concerto . 6 III. Music and the Horn in the Baroque Time Period . 9 Brief Historical Context . 9 Innovations to the Horn . 10 Concerto in E-flat for Two Horns and Strings, TWV 54:Es1 by Georg Philipp Telemann . 13 Brief Compositional Analysis . .13 Performance Practice Considerations . .19 Concerto in F major, RV 538 for Two Horns by Antonio Vivaldi . .21 Brief Compositional Analysis . .21 Performance Practice Considerations . .22 IV. Music and the Horn in the Classical Time Period . .24 Brief Historical Context . 24 Innovations to the Horn . 25 ii Texas Tech University, Lindsay Marie Smith, May 2019 Concerto in E-flat for Two horns, strings and basso continuo by Leopold Mozart . .27 Brief Compositional Analysis . .27 Performance Practice Considerations . .29 Concerto for Two horns in F major, M. C61 by Francesco Antonio Rosetti . .31 Brief Compositional Analysis . .31 Performance Practice Considerations .