Die Schwanenbrücke Fachhochschule Potsdam
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser Und Gärten Berlin-Brandenburg
Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Band 6 2004 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 04_Hanne-Wacker 28.04.2006 11:58 Uhr Seite 85 GÄRTEN SVEN HANNEMANN UND JÖRG WACKER Die Wiederherstellung des Sizilianischen und Nordischen Gartens im Park Sanssouci Der zwischen 1856 und 1866 nach Plänen von Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) und seinem Generalgartendirektor Peter Joseph Lenné (1789–1866) durch Gar- tenkondukteur Gustav Meyer (1816–1877) ausgeführte Sizilianische Garten im Park Sans- souci ist ein Fragment des gewaltigen Triumphstraßenprojektes des Königs. Nach diesen Ideen sollten italienisierende Prachtbauten den Höhenzug im Norden des Parkes zwischen dem Mühlenberg mit dem 1763 angelegten Winzerberg und dem 1770/1771 errichteten Belvedere auf dem Klausberg besetzen, sowie eine auf Viadukten geführte Höhenstraße flankieren. Seit 1844 wurden von dieser ebenso gigantischen wie phantastischen -

Reviews Summer 2019
$UFKLWHFWXUDO Jones, E, et al. 2019. Reviews Summer 2019. Architectural Histories, 7(1): 17, pp. 1–10. +LVWRULHV DOI: https://doi.org/10.5334/ah.429 REVIEW Reviews Summer 2019 Emma Jones, Carole Pollard, Mari Lending, and Ani Kodzhabasheva Jones, E. A review of Kurt W. Forster, Schinkel: A Meander Through His Life and Work, Basel: Birkhäuser Verlag, 2018. Pollard, C. A review of Susan Galavan, Dublin’s Bourgeois Homes: Building the Victorian Suburbs, 1850– 1901, London: Routledge, 2018. Lending, M. A review of Lynn Meskell, A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage, and the Dream of Peace, Oxford and New York: Oxford University Press, 2018, and Lucia Allais, Designs of Destruction: The Making of Monuments in the Twentieth Century, Chicago and London: Chicago University Press, 2018. Kodzhabasheva, A. A review of Robin Schuldenfrei, Luxury and Modernism: Architecture and the Object in Germany 1900–1933, Princeton: Princeton University Press, 2018. Meandering Through Schinkel are in many ways as immensely personal as they are informative. The personal emerges immediately through Emma Jones Forster’s lyrical essayistic prose, which contains frequent Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, CH conjectures, contradictions, asides, and diversions from [email protected] the main argument that reveal something of the char- acter and interests of the writer; while the informative Kurt W. Forster, Schinkel: A Meander Through His Life and Work, Basel: Birkhäuser Verlag, 411 pages, 2018, ISBN: 9783035607789. A meander, signifying an indirect or aimless journey, could be considered a curious choice for inclusion in the title of a book about the life and work of Prussia’s most pro- lific and industrious architect, Karl Friedrich Schinkel (1781–1841). -

1.3. Neuer Garten, Potsdam
1. Bauten und Gärten der UNESCO-Welterbestätte „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ 1.3. Neuer Garten, Potsdam Potsdam, Neuer Garten Park und Marmorpalais Ab 1787 unter König Friedrich Wilhelm II. schrittweiser Erwerb des Territoriums bis zu seiner heu- tigen Ausdehnung einschließlich des Heiligen Sees. Hauptbau 1787–1791 von Carl von Gontard für Friedrich Wilhelm II., Innenausstattung 1790–1792 von Carl Gotthard Langhans ausgeführt. Seiten- flügel 1797 von Michael Philipp Boumann, Innenausstattung 1843–1849 von Ludwig Ferdinand Hesse. Gestaltung des Gartens durch den Hofgärtner Johann August Eyserbeck im frühen sentimen- talen Landschaftsstil nach Wörlitzer Vorbild. Ab 1816 unter König Friedrich Wilhelm III. durch Peter Joseph Lenné Beginn der Überarbeitung des Gartens mit dem Ziel der Schaffung größerer Landschaftsräume statt intimer Separatbereiche und der optischen Einbeziehung der umgebenden Gärten und Landschaft. 1882 und 1904 Einrichtung des Marmorpalais für die kronprinzliche Nut- zung und nach 1918 Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Im Garten zur Kaiserzeit Veränderung kleineren Umfangs in der Umgebung des Marmorpalais und Einordnung des Schlos- ses Cecilienhof. 1927 Übernahme durch die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten. 1945 Kriegsschäden und danach Offizierskasino der Roten Armee. Bis 1954 Nutzung des Gartens als Erholungspark der sowjetischen Garnison. Von 1961–1989 Armeemuseum der DDR im Marmorpa- lais. 1954 Rückgabe des Gartens an die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam- -

Ausgabe 114 / 2011
Ausgabe 114 / 2011 Die Tagung wird veranstaltet von der Deutschen Bodenkundliche Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Technische Universtität Berlin, Institut für Ökologie, Fachgebiet Bodenkunde ( Prof. Dr. Martin Kaupenjohann ) und dem Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum ( Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Hüttl ). Die Veranstalter bedanken sich recht herzlich bei den folgenden Institutionen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich an der Vorbereitung und Durchführung des Exkursionsprogramms beteiligt haben: • Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue • Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl für Bodenschutz und Rekultivierung • Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Lehrstuhl Geo- pedologie und Landschaftsentwicklung • Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Forschungs-zentrum Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften • Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde • Humboldt Universität zu Berlin, Geographisches Institut • Landesanstalt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg • Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde • Landesumweltamt Brandenburg • Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. • Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, Großbeeren • Tempelhof-Projekt GmbH • Technische Universität Berlin, Section Building Technology and Design, Working Group „Watergy“ • Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V., Müncheberg • Leuphana Universität Lüneburg, Professur Biologie und Bodenkunde • Technische -

A Tour of the Landtag Brandenburg
External Area Inner Courtyard Exhibitions and Events Historical Development With its location on the Alter Markt (Old Market The Fortunaportal (Fortuna Gate) was the first The Landtag is not only a place for political The site of the former City Palace is one of the Square), directly in the centre of Potsdam, the part of the former City Palace to be recon- discussion about the state affairs of Branden- oldest settlement areas in Potsdam. The site Landtag building, housing the state parliament structed true to the original, and was complet- burg. It is also a place where the state presents had been home to various fortresses, castles A tour of the of Brandenburg, is part of a very attractive and ed in 2002. Among others who played a signif- and exchanges ideas regarding the diversity and palace buildings, as the Great Elector Fred- charming architectural ensemble. Designed by icant role in raising funds for the project was of its regions with their various cultural, social erick William ordered a new palace to be built King Frederick II of Prussia in the Roman style, Potsdam- based television presenter Günther and economic characteristics. For this reason, in the Dutch style between 1664 and 1669. The Landtag Brandenburg the square formed the centre of Potsdam until Jauch, who donated one million euros. The top the building regularly hosts exhibitions on top- initial architectural feature, the Fortunaportal, the middle of the 20th century. Its rebuilding and of the deep blue dome of the gate supports a ics of current social relevance. was constructed in 1701 and remained almost A modern parliament in a historic building restoration has been the objective of extensive gilded copper statue of the Roman goddess Together with external cooperation partners, unchanged until the destruction of the City Pal- construction measures, which began after the Fortuna atop a gilded column. -

A Short Biography of Heinrich Witt*
A Short Biography of Heinrich Witt* Christa Wetzel The following short biography reconstructs Heinrich Witt’s life according to the information provided by his diary as well as from other sources. It is limited to presenting the main lines of the course of his life – in the full knowledge that any definition of a life’s “main lines” is already an interpretation. A common thread of the narration, apart from those personal data and events as one expects from a biography (birth, family, education, vocation, marriage, death), are the business activities of Heinrich Witt as a merchant. Thus, the description of his life gives a sketch of the economic and social networks characterizing the life, both mobile and settled, of Heinrich Witt as a migrant. However, this biography will not and cannot provide a detailed description of each of Witt’s business activities or of his everyday life or of the many people to which he had contact in Germany, Europe and Peru. Even if, according to Bourdieu, the course a life has taken cannot be grasped without knowledge of and constant reflection on the “Metro map”, this biography also does not give a comprehensive description of the period, i.e. of the political, economic, social and cultural events and discourses in Peru, Europe or, following Witt’s view, on the entire globe.1 Furthermore, this rather “outward” biography is not the place to give a reconstruction of Witt’s world of emotions or the way in which he saw and reflected on himself. All this will be left to the discoveries to be made when reading his diary. -

The Berlin Palace Becomes the Humboldt Forum
THE BERLIN PALACE BECOMES THE HUMBOLDT FORUM The Reconstruction and Transformation of Berlin’s City Centre Manfred Rettig THE BERLIN PALACE BECOMES THE HUMBOLDT FORUM The Reconstruction and Transformation of Berlin’s City Centre Manfred Rettig Chief Executive Officer and spokesperson for the Berlin Palace—Humboldt Forum Foundation The Berlin Palace—Humboldt Forum (Berliner Schloss— Now, with the Berlin Palace—Humboldt Forum, the centre of Humboldtforum) will make this historic locality in the centre of Berlin’s inner city will be redesigned and given a new archi- the German capital a free centre of social and cultural life, tectural framework. This is not merely a makeshift solution – open to all, in a democratic spirit. Here, with the rebuilding it is a particularly ambitious challenge to create this new of the Berlin Palace, visitors can experience German history cultural focus in the skin of an old building. There are many in all its event-filled variety. The Humboldt Forum makes the lasting and valid justifications for this approach, and the Palace part of a new ensemble looking to the future. matter has been discussed for almost twenty years. Not only The building was commissioned and is owned by the will the project restore the reference point, both proportion- Berlin Palace—Humboldt Forum Foundation, founded in ally and in terms of content, for all the surrounding historic November 2009 by the German government. A legally respon- buildings – the Protestant state church with the cathedral sible foundation in civil law, it is devoted directly and exclu- (Berliner Dom), and Prussian civic culture with the Museum sively to public interests in promoting art and culture, educa- Island (Museumsinsel) – but, more importantly, the historic tion, international orientation, tolerance in all fields of culture centre of Berlin will be recognised as such and taken more and understanding between nations, and to the preservation seriously, after its almost complete destruction as a conse- and curating of historic monuments. -

The “Soldier-King” and His Potsdam Orphanage
THE “SOLDIER-KING” AND HIS POTSDAM ORPHANAGE Presentation of the FOUNDATION “Great Orphanage in Potsdam” In only a few years, one of Germany's oldest foundations will cel- ebrate its tercentenary. Whether or not the founder himself, none less than the Prussian King Frederick William I, in the founding year 1724 trusted in the continuity of his institution for an impres- 1992. In a legal sense, the foundation has thus existed without supported by eight sandstone columns, with a golden Caritas sive time span of three hundred years, is disputable. Neverthe- interruption since 1724 and was able to claim its old assets. The figure enthroned on its roof. Due to this tower construction, less, he had a provision included in the statutes of incorporation, newly formulated constitution is oriented towards the will of the destroyed in 1945 during World War II and not rebuilt until 2004, stating that his foundation should remain in existence “now and founder simultaneously relating his early modern concept of man the orphanage is visible from far and wide across Potsdam and, for all eternity”. His wish has been granted so far. To this very day to the requirements of the present. The education of children and along with other impressive buildings, determines the cityscape the foundation has been operating in the spirit of its founder, aid- youngsters as well as their development into mature, responsible of the capital of former principality. ing children and young people dependent on support in regard to personalities is still the focus of attention today. their upbringing and education. The late baroque staircase situated beneath this domed tower Nowadays the foundation operates its educational facilities counts in expert circles as one of the most beautiful represent- In Germany, foundations have been in existence since the twelfth through a subsidiary. -

Aktion Für Die Schwanenbrücke
Ausgabe 5 11/2003 Informationsblattfr die Mitglieder und Freunde des Vereins 9/2003 Aktion für die Schwanenbrücke Bei schönem Wetter und großartiger Unterstützung durch die Mitglieder war der Infostand und der Kuchenbasar ein voller Erfolg. Vielen Dank an alle Helfer dieser Aktion. Zum Tag des offenen Denkmals am 14.09.2003 veran- staltete der Verein einen Kuchenbasar zugunsten der Wiedererrichtung der Schwanenbrücke. Es entstand die Idee, einen Informationsstand direkt an der Schwa- nenbrücke einzurichten. Hier wurde an Ort und Stelle über die Spendenaktion für den Aufbau einer Brücke verkauften die 30 Kuchen und schenkten Kaffee aus, nach Originalplänen geworben. den Herr Götschmann fortwährend frisch zubereitet Das herrliche Spätsommerwetter und die vielfältigen anlieferte. Für diese Unterstützung herzlichen Dank. Angebote zum Tag des offenen Denkmals ließen viele Die Passanten zeigten sich ob der leckeren Kuchen bei wissensdurstige und hungrige Potsdamer unseren ihrer Spendenbereitschaft sehr großzügig. Es konnten Stand passieren. Herr Buhr und Herr Heinze informier- durch den Verkauf der Postkarten und des Kuchens ten alle interessierten Besucher ausführlich über die über 700 Euro eingenommen werden. Christian Heinze Spendenaktion. Die von Christian Heinze gestalteten steuerte noch 30% des Verkaufserlöses seiner an die- Postkarten, deren Verkaufserlös dem Wiederaufbau der sem Tag verkauften Kalender bei und es folgten noch Schwanenbrücke zugute kommt, fanden guten Absatz. diverse Einzelspenden auf das Vereinskonto, so dass Auch waren viele Vereinsmitglieder dem Spendenauf- sich der momentane Gesamtspendenbetrag auf über ruf gefolgt und haben sich mit Kuchen für unseren Ver- 1600 Euro beläuft. Der Tag verlief also außerordentlich kaufsstand beteiligt. Recht herzlichen Dank dafür, denn erfolgreich, und viele interessierte Besucher konnten nur durch dieses Engagement konnte der Tag ein sol- für die Sache angesprochen und gewonnen werden. -

WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Mitte Built in 2003 As the Parliamentary Library
WHAT Architect WHERE Notes Zone 1: Mitte Built in 2003 as the parliamentary library. Beautiful massive tapered Marie-Elisabeth **** Stephan Braunfels Schiffbauerdamm 25 stairway. Not open to the public. See it in the sun, with clouds, or Lüders Building at night-changes every time. Tue-Sun (11-17) Built in 1992 on top of the rebuilt Reichstag building. It symbolizes the reunification of Germany and that the people are above the ***** Reichstag Dome Norman Foster Platz der Republik 1 government (parliament is underneath the stair). Mon-Sun (8-23). FREE admission but advance registration required. Built in 1791 as a neoclassical triumphal arch. Only the royal family "Brandenburger Tor" Carl Gotthard Unter den Linden and ***** was allowed to pass through the central archway until 1919. Gate Langhans Ebertstraße St. Restored in 2002 after considerable damage in WW II. Built in 2013 as the French embassy in Berlin. On site, the building regulations around the Brandenburg Gate required the use of a Christian *** Embassy of France Parisier Platz stone basement, or concrete in this case, homage to the spirit of Portzamparc Karl Friedrich Schinkel, the architect responsible for the City Planning of Berlin. Mon-Wed, Fri (9-12), Wed (9-12/14-16.30) Built in 2000 as an office, conference, and residential building. The ***** DZ Bank Building Frank Gehry Pariser Platz 3 north facade is fairly rectilinear as there were strict limitations but the interior is spectacular in shape and form. Built in 2005 with as a memorial of the Jewish victims of the Berlin Holocaust Holocaust. 2,711 concrete slabs produce an uneasy, confusing ***** Peter Eisenman Cora-Berliner-Straße Memorial atmosphere. -

157 Christian Klusemann, Regionalism in GDR-Modernism of the 1960S and 1970S
REGIONALISM IN GDR-MODERNISM OF THE 1960s AND 1970s Christian Klusemann Philipps-Universität Marburg, Kunstgeschichtliches Institut / Philipps University Marburg, Department of Art History, Marburg, Germany Abstract The widespread narrative that all GDR-Metropolises were overwritten by a soul- and faceless socialist variant of post-war modernism must be questioned at least regarding some cities. Although whole streets were torn down in the 1960s and 1970s and history was only partially appreciated, there can be found a series of modernist buildings respecting local traditions. Thus, regionalisms express themselves in traditional building materials – in the early 1960s most prominently in the Northeastern City of Rostock, whose brick-faced postwar buildings in the centre were recently categorized as ‘Nordmoderne’ (‘northern modernism’). In the late 1960s and early 1970s, meanwhile, attempts have been made in Potsdam to adapt new modern structures to existing baroque and classicist buildings by materials, facade colours or vertical subdivisions of facades – in order to merge new and old buildings into a ‘harmonic’ unity. Regarding the development of modernism in East Germany, the regionalisms mentioned above seem to have different roots. As the Haus der Schiffahrt in Rostock’s Lange Straße could be explained as late successor of the 1950s Stalinist doctrin of the ‘National Tradition’, buildings such as the Institut für Lehrerbildung or Staudenhof in Potsdam seem to be efforts to avoid increasing monotony of east-modern architecture. Keywords: GDR, Socialism, Rostock, Potsdam Although whole streets were torn down in many East German cities in the 1960s and 1970s and history was only partially appreciated, there can be found a series of modernist buildings respecting local traditions. -
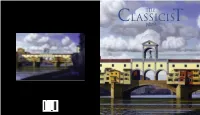
Classicist No-9
THE CLASSICIST NO-9 THE CLASSICIST o Institute of Classical Architecture & Art n 9: 2010-2011 20 West 44th Street, Suite 310, New York, NY 10036-6603 - telephone (212) 730-9646 facsimile (212) 730-9649 [email protected] WWW.CLASSICIST.ORG the classicist at large 4 Canon and Invention: The Fortuna of Vitruvius’ Asiatic Ionic Base Editor e s s a y 7 Richard John Schinkel’s Entwürfe zu städtischen Wohngebäuden: Designer Living all’antica in the New Bourgeois City Tom Maciag Dyad Communications design office Jean-François Lejeune Philadelphia, Pennsylvania Managing Editor f r o m t h e o f f i c e s 28 Henrika Dyck Taylor Printer e s s a y 49 Crystal World Printing Manufactured in China Paul Cret and Louis Kahn: Beaux-Arts Planning at the Yale Center for British Art ©2011 Institute of Classical Architecture & Art Sam Roche All rights reserved ISBN 978-0-9642601-3-9 ISSN 1076-2922 from the academies 60 Education and the Practice of Architecture Front and Back Covers David Ligare, Ponte Vecchio/ Torre Nova, 1996, Oil on Canvas, 40 x 58 inches. Private Collection, San Francisco, CA. ©D. Ligare. Michael Lykoudis This painting was created for a solo exhibition at The Prince of Wales’s Institute of Architecture in London in 1996. David Ligare described his intentions in the following terms: “The old bridge has been painted countless times by artists who have Notre Dame/Georgia Tech/Miami/Judson/Yale/College of Charleston/The ICAA utilized every style and manner of painting imaginable. I was not interested in making yet another ‘new’ view of it.