Ausgabe 114 / 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser Und Gärten Berlin-Brandenburg
Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Band 6 2004 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 04_Hanne-Wacker 28.04.2006 11:58 Uhr Seite 85 GÄRTEN SVEN HANNEMANN UND JÖRG WACKER Die Wiederherstellung des Sizilianischen und Nordischen Gartens im Park Sanssouci Der zwischen 1856 und 1866 nach Plänen von Friedrich Wilhelm IV. (1795–1861) und seinem Generalgartendirektor Peter Joseph Lenné (1789–1866) durch Gar- tenkondukteur Gustav Meyer (1816–1877) ausgeführte Sizilianische Garten im Park Sans- souci ist ein Fragment des gewaltigen Triumphstraßenprojektes des Königs. Nach diesen Ideen sollten italienisierende Prachtbauten den Höhenzug im Norden des Parkes zwischen dem Mühlenberg mit dem 1763 angelegten Winzerberg und dem 1770/1771 errichteten Belvedere auf dem Klausberg besetzen, sowie eine auf Viadukten geführte Höhenstraße flankieren. Seit 1844 wurden von dieser ebenso gigantischen wie phantastischen -

Reviews Summer 2019
$UFKLWHFWXUDO Jones, E, et al. 2019. Reviews Summer 2019. Architectural Histories, 7(1): 17, pp. 1–10. +LVWRULHV DOI: https://doi.org/10.5334/ah.429 REVIEW Reviews Summer 2019 Emma Jones, Carole Pollard, Mari Lending, and Ani Kodzhabasheva Jones, E. A review of Kurt W. Forster, Schinkel: A Meander Through His Life and Work, Basel: Birkhäuser Verlag, 2018. Pollard, C. A review of Susan Galavan, Dublin’s Bourgeois Homes: Building the Victorian Suburbs, 1850– 1901, London: Routledge, 2018. Lending, M. A review of Lynn Meskell, A Future in Ruins: UNESCO, World Heritage, and the Dream of Peace, Oxford and New York: Oxford University Press, 2018, and Lucia Allais, Designs of Destruction: The Making of Monuments in the Twentieth Century, Chicago and London: Chicago University Press, 2018. Kodzhabasheva, A. A review of Robin Schuldenfrei, Luxury and Modernism: Architecture and the Object in Germany 1900–1933, Princeton: Princeton University Press, 2018. Meandering Through Schinkel are in many ways as immensely personal as they are informative. The personal emerges immediately through Emma Jones Forster’s lyrical essayistic prose, which contains frequent Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, CH conjectures, contradictions, asides, and diversions from [email protected] the main argument that reveal something of the char- acter and interests of the writer; while the informative Kurt W. Forster, Schinkel: A Meander Through His Life and Work, Basel: Birkhäuser Verlag, 411 pages, 2018, ISBN: 9783035607789. A meander, signifying an indirect or aimless journey, could be considered a curious choice for inclusion in the title of a book about the life and work of Prussia’s most pro- lific and industrious architect, Karl Friedrich Schinkel (1781–1841). -

A Short Biography of Heinrich Witt*
A Short Biography of Heinrich Witt* Christa Wetzel The following short biography reconstructs Heinrich Witt’s life according to the information provided by his diary as well as from other sources. It is limited to presenting the main lines of the course of his life – in the full knowledge that any definition of a life’s “main lines” is already an interpretation. A common thread of the narration, apart from those personal data and events as one expects from a biography (birth, family, education, vocation, marriage, death), are the business activities of Heinrich Witt as a merchant. Thus, the description of his life gives a sketch of the economic and social networks characterizing the life, both mobile and settled, of Heinrich Witt as a migrant. However, this biography will not and cannot provide a detailed description of each of Witt’s business activities or of his everyday life or of the many people to which he had contact in Germany, Europe and Peru. Even if, according to Bourdieu, the course a life has taken cannot be grasped without knowledge of and constant reflection on the “Metro map”, this biography also does not give a comprehensive description of the period, i.e. of the political, economic, social and cultural events and discourses in Peru, Europe or, following Witt’s view, on the entire globe.1 Furthermore, this rather “outward” biography is not the place to give a reconstruction of Witt’s world of emotions or the way in which he saw and reflected on himself. All this will be left to the discoveries to be made when reading his diary. -

Aktion Für Die Schwanenbrücke
Ausgabe 5 11/2003 Informationsblattfr die Mitglieder und Freunde des Vereins 9/2003 Aktion für die Schwanenbrücke Bei schönem Wetter und großartiger Unterstützung durch die Mitglieder war der Infostand und der Kuchenbasar ein voller Erfolg. Vielen Dank an alle Helfer dieser Aktion. Zum Tag des offenen Denkmals am 14.09.2003 veran- staltete der Verein einen Kuchenbasar zugunsten der Wiedererrichtung der Schwanenbrücke. Es entstand die Idee, einen Informationsstand direkt an der Schwa- nenbrücke einzurichten. Hier wurde an Ort und Stelle über die Spendenaktion für den Aufbau einer Brücke verkauften die 30 Kuchen und schenkten Kaffee aus, nach Originalplänen geworben. den Herr Götschmann fortwährend frisch zubereitet Das herrliche Spätsommerwetter und die vielfältigen anlieferte. Für diese Unterstützung herzlichen Dank. Angebote zum Tag des offenen Denkmals ließen viele Die Passanten zeigten sich ob der leckeren Kuchen bei wissensdurstige und hungrige Potsdamer unseren ihrer Spendenbereitschaft sehr großzügig. Es konnten Stand passieren. Herr Buhr und Herr Heinze informier- durch den Verkauf der Postkarten und des Kuchens ten alle interessierten Besucher ausführlich über die über 700 Euro eingenommen werden. Christian Heinze Spendenaktion. Die von Christian Heinze gestalteten steuerte noch 30% des Verkaufserlöses seiner an die- Postkarten, deren Verkaufserlös dem Wiederaufbau der sem Tag verkauften Kalender bei und es folgten noch Schwanenbrücke zugute kommt, fanden guten Absatz. diverse Einzelspenden auf das Vereinskonto, so dass Auch waren viele Vereinsmitglieder dem Spendenauf- sich der momentane Gesamtspendenbetrag auf über ruf gefolgt und haben sich mit Kuchen für unseren Ver- 1600 Euro beläuft. Der Tag verlief also außerordentlich kaufsstand beteiligt. Recht herzlichen Dank dafür, denn erfolgreich, und viele interessierte Besucher konnten nur durch dieses Engagement konnte der Tag ein sol- für die Sache angesprochen und gewonnen werden. -
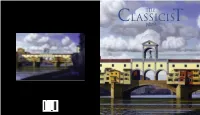
Classicist No-9
THE CLASSICIST NO-9 THE CLASSICIST o Institute of Classical Architecture & Art n 9: 2010-2011 20 West 44th Street, Suite 310, New York, NY 10036-6603 - telephone (212) 730-9646 facsimile (212) 730-9649 [email protected] WWW.CLASSICIST.ORG the classicist at large 4 Canon and Invention: The Fortuna of Vitruvius’ Asiatic Ionic Base Editor e s s a y 7 Richard John Schinkel’s Entwürfe zu städtischen Wohngebäuden: Designer Living all’antica in the New Bourgeois City Tom Maciag Dyad Communications design office Jean-François Lejeune Philadelphia, Pennsylvania Managing Editor f r o m t h e o f f i c e s 28 Henrika Dyck Taylor Printer e s s a y 49 Crystal World Printing Manufactured in China Paul Cret and Louis Kahn: Beaux-Arts Planning at the Yale Center for British Art ©2011 Institute of Classical Architecture & Art Sam Roche All rights reserved ISBN 978-0-9642601-3-9 ISSN 1076-2922 from the academies 60 Education and the Practice of Architecture Front and Back Covers David Ligare, Ponte Vecchio/ Torre Nova, 1996, Oil on Canvas, 40 x 58 inches. Private Collection, San Francisco, CA. ©D. Ligare. Michael Lykoudis This painting was created for a solo exhibition at The Prince of Wales’s Institute of Architecture in London in 1996. David Ligare described his intentions in the following terms: “The old bridge has been painted countless times by artists who have Notre Dame/Georgia Tech/Miami/Judson/Yale/College of Charleston/The ICAA utilized every style and manner of painting imaginable. I was not interested in making yet another ‘new’ view of it. -

Bulletin (KNOB)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Koninklijk erfgoed van het verlies: het Haagse Willemsparkhof in negentiende- eeuwse Europese context van der Laarse, R. Publication date 2010 Document Version Final published version Published in Bulletin (KNOB) Link to publication Citation for published version (APA): van der Laarse, R. (2010). Koninklijk erfgoed van het verlies: het Haagse Willemsparkhof in negentiende-eeuwse Europese context. Bulletin (KNOB), 109(5), 172-189. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:26 Sep 2021 Koninklijk erfgoed van het verlies. Het Haagse Willemsparkhof in negentiende-eeuwse Europese context Rob van der Laarse de hand van Willem II’s plannen met en rond Paleis Kneuter- Inleiding dijk. Het gaat mij hierbij niet om een bouwhistorische inter- In Den Haag, in de bocht van de Kneuterdijk, staat het half- pretatie, maar om de vraag wat de vorst met dit grand design ronde gebouw van de Raad van State, het hoogste adviescol- voor ogen stond. -

Potsdamer Kulturlandschaft
Dokumentation 2008 Geschäftsstelle STADT FORUM POTSDAM Dr. Ing. Günter Schlusche Dokumentation STADT FORUM POTSDAM 2008 Bassermannweg 7 12207 Berlin-Lichterfelde Tel 030 771 97 59 Fax 030 771 17 61 Email: [email protected] Inhaltsverzeichnis Seite Impressum Einführung Oberbürgermeister Jann Jakobs 3 Übersicht der Sitzungen 3 Herausgeber STADT FORUM POTSDAM Hajo Kölling 4 Dipl. Ing. Albrecht Gülzow Dipl. Phil. Saskia Hüneke Dokumentation 31. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 17.4.2008 5 Dipl. Ing. Philipp Jamme „Vom Telegraphenberg zur Speicherstadt“ Dipl. Ing. Hajo Kölling Dipl. Ing. Dieter Lehmann Leitgedanken der Kerngruppe 5 Dr. Volker Pohl Empfehlungen der Kerngruppe 6 Dr. Reiner Pokorny Prof. Dipl. Ing. Bernd Steigerwald Dokumentation 32. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 11.7.2008 7 Dipl. Ing. Christian Wendland „Der Alte Markt und sein Umfeld“ Bearbeitung Dr. Ing. Günter Schlusche Leitgedanken der Kerngruppe 7 Beitrag Ludger Brands 9 Gestaltung Erich Wrede, Grafik Design BDG, Empfehlungen der Kerngruppe 12 Potsdam Dokumentation 33. Sitzung des STADT FORUMS POTSDAM am 6.11.2008 14 Druck Druckerei Rüss, Potsdam „Die Stadt und ihr ländlicher Raum – das Beispiel Potsdamer Norden“ Weitere Informationen zum STADT FORUM POTSDAM sowie die Dokumentationen der zurückliegenden Jahre Leitgedanken der Kerngruppe 14 sind im Internet unter www.potsdam.de/stadtforum Beitrag Ramona Simone Dornbusch 15 zugänglich. Empfehlungen der Kerngruppe 19 Abbildungsnachweise: Anhang STADT FORUM POTSDAM – Ziele und Merkmale 21 Umschlagfoto: Foto vom Hochhaus des Hotels Mercure Arbeitsvereinbarung des STADT FORUMS POTSDAM 22 April 2009, Foto: Hagen Immel Pressespiegel 22 Fotos auf den Seiten 2,4,6,8,12,13,19 und 20 Barbara Plate, Potsdam Pläne auf Seite 9 und 10: Bernd Albers, Ludger Brands, Klaus Theo Brenner, 2008 Fotos auf Seite 17 und 18: Ramona Simone Dombusch Die Arbeit des STADT FORUMS POTSDAM im Jahr 2008 und die Realisierung dieser Dokumentation wurden durch finanzielle Zuwendungen der Stadtverwaltung Potsdam gefördert. -

Fernando II of Portugal and His Royal Castellated Palace of Pena (Sintra)
SANTOS, Joaquim Rodrigues dos; NETO, Maria João. “Fernando II of Portugal and his Royal Castellated Palace of Pena (Sintra): Between the Construction of Neo-Medieval Revivalist Castles and the Beginning of the Debate on the National Architectural Style in Portugal”. In: e-Journal of Portuguese History. Porto - Providence: Universidade do Porto - University of Brown, 2020, nr.2, vol.18, pp.43-82. Fernando II of Portugal and his Royal Castellated Palace of Pena (Sintra): Between the Construction of Neo-Medieval Revivalist Castles and the Beginning of the DeBate on the National Architectural Style in Portugal Joaquim Manuel Rodrigues dos Santos1 Maria João Baptista Neto2 Abstract The predominant spirit of the nineteenth century was incorporated into architecture, which adapted and reinvented itself. Great attention was paid to medieval architecture, due to its direct connections with a period considered to represent the origin of many nations. It was against this background that Fernando II of Portugal ordered the construction of his “castle” of Pena, in Sintra. This essay seeks to analyze the context in which the Palace of Pena was built, focusing on its symbolism, comparing it to other nineteenth-century castellated residences, and examining the debate in Portugal about the national architectural style and its influences on Portuguese architecture. Keywords Revivalist architecture, Neo-medieval castles, Castellated palace, Pena Palace, National architectural styles, Fernando II of Portugal Resumo A arquitectura oitocentista incorporou o espírito dominante da época, adaptando-se e reiventando-se: a arquitectura medieval tornou-se objecto de atenção, devido às relações directas com a Idade Média, considerada a origem de muitas Nações. -

Die Schwanenbrücke Fachhochschule Potsdam
Diese Publikation entstand im Rahmen des studentischen Forsch ungsprogramms „UROP – Einstieg in Forschung“ an der Die Schwanenbrücke Fachhochschule Potsdam. Sie gibt erstmals einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Schwanenbrücke im Pots im Neuen Garten zu Potsdam damer Neuen Garten und prüft deren Wichtigkeit im Bezug auf die Park landschaft. Dabei spielte die Gartenplanung der Gesamt anlage sowie die Beweggründe der wechselnden Auftrag geber eine übergeordnete Rolle. Der Wörlitzer Hofgärtner Johann August Eyserbeck entwarf 1787 den Neuen Garten unter Friedrich UROP – Forschungsprojekt der Fachhochschule Potsdam 2015 Wilhelm II. Etwa 30 Jahre später beauftragte Friedrich Wilhelm IV. Betreut durch Prof. Dr. Martina Abri und Kevin Schwenzer M.A. den jungen Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné mit der UROPKoordinatorin Dipl.Ing. Luise Albrecht, M.Sc. Überarbeitung des Parks. Der Architekt Albert Dietrich Scha dow, der zunächst unter Karl Friedrich Schinkel und Friedrich August Stüler am Berliner Stadtschloss arbeitete, entwarf die Schwanenbrücke. Melina Drexler und Annika Schäpel Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut und enthält zahlreiche, bisher unveröffentlichte Pläne, Zeichnungen und Fotografien. Durch Auswertung der Entwurfszeichnungen Schadows aus der Graphischen Sammlung der Stiftung Preußische Schlösser BerlinBrandenburg ließen sich unter anderem die Fragen klären, welche Brückenelemente bis heute erhalten sind und ob die Schwanenbrücke zu rekonstruieren wäre. Verlag der Fachhochschule Potsdam Studentische Forschung an der FHP Studentische Forschung an der FHP Die Schwanenbrücke im Neuen Garten zu Potsdam UROP Studentische Forschung an der FHP Bei diesem Buch handelt es sich um die erste Publika tion, die im Rahmen des strukturierten Forschungsprogramms » UROP – Einstieg in Forschung« an der Fachhochschule Potsdam entstanden ist. UROP steht für Undergraduate Research Opportunities Pro gram. -

25 Jahre UNESCO-Welterbestätte „Schlösser Und Parks Von Potsdam Und Berlin“
25 Jahre UNESCO-Welterbestätte „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ Bauten und Gärten der UNESCO-Welterbestätte „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS GRUSSWORT HINWEISE ZUR NUTZUNG URKUNDE KARTE WELTERBESTÄTTE SCHLÖSSER UND PARKS VON POTSDAM UND BERLIN 1. BAUTEN UND GÄRTEN DER UNESCO-WELTERBESTÄTTE „SCHLÖSSER UND PARKS VON POTSDAM UND BERLIN“ 1.1. Park Sanssouci, Potsdam 1.2. Bornstedt, Potsdam 1.3. Neuer Garten, Potsdam 1.4. Pfingstberg, Potsdam 1.5. Jüdischer Friedhof, Potsdam 1.6. Russische Kolonie Alexandrowka, Potsdam 1.7. Park Babelsberg, Potsdam 1.8. Stadtgebiet, Potsdam 1.9. Sacrow, Potsdam 1.10. Schloss und Park Glienicke sowie Jagdschloss Glienicke mit Klein Glienicke, Potsdam und Berlin 1.11. Pfaueninsel, Berlin 2. AUSSERHALB DER UNESCO-WELTERBESTÄTTE LIEGENDE BAUTEN UND GÄRTEN DER STIFTUNG PREUSSISCHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN BERLIN- BRANDENBURG 2.1. Potsdam Stadtgebiet 2.2. Berlin, Charlottenburg, Schloss und Park 2.3. Berlin, Grunewald, Schloss und Park 2.4. Berlin, Schönhausen, Schloss und Park 2.5. Caputh, Schloss und Park 2.6. Königs Wusterhausen, Schloss und Park 2.7. Paretz, Schloss und Park 2.8. Rheinsberg, Schloss und Park IMPRESSUM 25 Jahre UNESCO-Welterbestätte „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ Stand: 30.06.2016 Bauten und Gärten der UNESCO-Welterbestätte „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ Grußwort GRUSSWORT „Einzigartigkeit“, „Integrität“ und „Authentizität“ sind die Auswahlkriterien für eine Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste. So ist es seit 1972 im internationalen „Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ festgeschrieben. Die Konvention ist die erfolgreichste der UNESCO überhaupt: Mittlerweile von 192 Staaten unterzeichnet, wurde mehr als 1000 Kultur- und Naturstätten auf allen Kontinenten der Welterbe-Status zuerkannt. -

Antiquariat Banzhaf
Antiquariat Michael Kühn Early Zoo Rotterdamsche Diergaarde. Exceedingly charming & rare work on a privately organized and funded zoo- Met hochgachting opgedragen aan derzelver bestuur, heeren leden en logical garden most probably published to its opening or shortly before. The ingezetenen der stad. (= The Rotterdam Zoo. Proudly dedicated to the Rotterdam zoological garden which is one of the oldest in the Netherlands, was established by two railway employees who held some animals in their directors thereof, the lord members and residents of the city). (Rot- private gardens. They organized a zoological society which eventually built terdam, no publisher, no date, ca. 1857). 8 tinted lithographed plates this zoological garden in the midth of the 1850’s. The plates show: House in original mauve wrappers. Oblong folio (270 x 360 mm). Wrappers of the director with lion cage, view from the lion cage, monkey house & repaired at spine and slightly wrinkled. cage, bear mountain and cage, house of the zoological society, winterpalais, entrance, view from the railway station to the zoo. Front wrapper with a leopard. A scarce and ephemeral publication with only one copy traceable on KVK and OCLC - Weimar, Anna Amalia dating the series to 1850, but probably 1857 is more accurate. Klenze‘s Ideas of Town Planning Klenze, Leo von. Anweisung zur Architektur des christlichen Kultus. Mit Genehmigung des koen. Baier. Staatsministeri- ums des Innern herausgegeben ... Nebst XL Kupfern. München, no imprint 1822. Folio (435 x 305 mm). Engraved title by Unger after Klenze, with four panels with framed views of Bethlehem, the Calvary church and statues of Christ by Thorwadsen and Michelangelo. -

DĚJINY a TEORIE ZAHRADNÍHO UMĚNÍ „Anglická“ Zahrada Ve Stowe, Velká Británie (J
1 Bernard Lipavský, Johann Homme, Kroměříž – Podzámecká zahrada: detail rozšíření zahrady z roku 1850 (repro: Ondřej Zatloukal, Et in arcadia ego – Historické zahrady Kroměříže) DĚJINY A TEORIE ZAHRADNÍHO UMĚNÍ „Anglická“ zahrada ve Stowe, Velká Británie (J. Chr. Krafft, Plans des plus beaux jardins pittoresques etc., 1809) JIŘÍ KROUPA DĚJINY A TEORIE ZAHRADNÍHO UMĚNÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Brno 2004 © Jiří Kroupa 3 TEORIE A DĚJINY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ V 16.-20. STOLETÍ OBSAH Předmluva.......4 I. Počátky zahradní architektury a její teorie.......6 Teorie zahradního umění – základní terminologie.......7 Pojmy a termíny.......9 Zahrady ve starověku.......10 Zahrady ve vilách starověkého Říma.......11 II. Vila a zahrada v Toskánsku.......13 Villegiatura.......13 Perspectiva artificialis.......14 Medicejské vily v Toskánsku.......14 III. Italský manýrismus.......18 Rekonstrukce antické vily.......18 Tajuplné a magické zahrady.......20 Klasická římská villa.......22 IV. Francouzská renesance.......25 Zahrady francouzské renesance.......26 Zahrady rané francouzské klasiky.......29 V. Zahrady 16. a 17. století v Záalpí.......31 Zahrady městských patriciů a humanistů.......31 Velké knížecí zahrady.......31 Protobarokní a raně barokní zahrady na Moravě.......33 VI. André Le Nôtre.......35 Vaux-le-Vicomte a rané projekty.......35 Versailles.......36 Další příklady Le Nôtrových zahrad.......38 Rouen, půdorys zahrady-labyrintu (J. Chr. Krafft, Plans des plus beaux jardins pittoresques etc., 1809) 4 Le Nôtrovi nástupci ve Francii.......40 Le Nôtrovi nástupci v Evropě.......42 Velké rezidenční parky v Evropě.......44 Předmluva VII. Rokokové a pozdně barokní zahrady.......49 Dějiny a teorie zahradního umění jsou speciální součástí obecných dějin architektury. Pozdně barokní zahrady.......49 Jsou vyučovány jak na technických a přírodovědně orientovaných školách (Vysoké učení Proměny rokokové zahrady ve Francii.......50 technické, Vysoká škola zemědělská, Vysoká škola zahradní), tak na školách humanitních.