Mobile Business
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
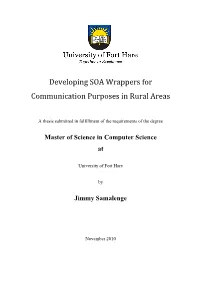
Developing SOA Wrappers for Communication Purposes in Rural Areas
Developing SOA Wrappers for Communication Purposes in Rural Areas A thesis submitted in fulfillment of the requirements of the degree Master of Science in Computer Science at University of Fort Hare by Jimmy Samalenge November 2010 Acknowledgements First and foremost I want to thank God, My Heavenly Father and Christ Jesus, My Lord and Saviour. Father, it has been a sweet and sour two years of research, but through it all, You taught me how to put my trust in You. You are the Wind beneath my wings. To my supervisor Dr Mamello Thinyane: Sir, I want to thank you for your desire to get us to research more and work hard. To my sponsor Telkom SA: Thank you for helping me further my studies through your financial support. To my lovely wife and my family: thank you for encouraging me to press forward every time I thought of giving up. Thank you for your prayers and support. To my classmates, it was nice working together as a family. God bless you all. i Declaration I, Jimmy Samalenge (Student Number: 200507134), the undersigned acknowledge that all references are accurately recorded and, unless stated otherwise, the work contained in this dissertation is my own original work. Signature:…………………………………………………………………. Date:………………………………………………………………………. ii Publications Samalenge, J. & Thinyane, M. (2009). Deploying Web Services in Rural Communities for Services of Personal Communication Synchronous and Asynchronous. SATNAC conference, Swaziland. Samalenge, J., Ngwenya, S., Kunjuzwa, D., Hlungulu, B., Ndlovu, K., Thinyane, M., & Terzoli, A. (2010). Technology Solutions to Strengthen the Integration of Marginalized Communities into the Global Knowledge Society. -

OP301 T 180504 Z2 1 Idea Dla Firm TELEFONY
CENNIK TELEFONÓW W OFERCIE PROMOCYJNEJ „IDEA DLA FIRM” Obowiazuje od 18.05.2004 r. do odwolania Czesc A Cena (w zl) telefonu w ofercie promocyjnej w planach taryfowych Cena (w zl) telefonu poza oferta Idea Firma Idea Firma Idea Top Firma Grupa Typ telefonu promocyjna 25 50 – 100 200 - 400 cenowa bez VAT z VAT bez VAT z VAT bez VAT z VAT bez VAT z VAT Alcatel OT320 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Alcatel OT332 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Alcatel OT735 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 1 199,00 1 462,78 A Motorola C200 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Motorola C350 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Motorola C550 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 999,00 1 218,78 A Motorola E365 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 1 199,00 1 462,78 A Motorola T720i 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 1 399,00 1 706,78 A Motorola T720i 99,00 120,78 49,00 59,78 1,00 1,22 1 499,00 1 828,78 A + aparat cyfrowy Motorola V500 299,00 364,78 99,00 120,78 1,00 1,22 1 999,00 2 438,78 A Motorola V60 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 1 499,00 1 828,78 A Motorola V60i 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 1 499,00 1 828,78 A Motorola V70 499,00 608,78 299,00 364,78 99,00 120,78 1 799,00 2 194,78 A Nokia 3100 49,00 59,78 1,00 1,22 1,00 1,22 1 199,00 1 462,78 A Nokia 3310 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Nokia 3410 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Nokia 3510i 1,00 1,22 1,00 1,22 1,00 1,22 850,00 1 037,00 A Nokia 6100 299,00 364,78 99,00 120,78 49,00 59,78 1 999,00 2 438,78 A Nokia 6310 49,00 59,78 -

Quarterly Focus PKI Goes Mobile Secure Licensing
An Infineon Technologies Publication Autumn/2001 Quarterly Focus Traditional Smart Cards vs. USB Token Security – And the winner is…? PKI goes Mobile New Players – New Game. Secure Licensing Securing Intellectual Property www.silicon-trust.com from Software Piracy Impressum Editorial SECURE - The Silicon Trust Quarterly Report Welcome to the Autumn 2001 issue of the is a quarterly Silicon Trust program publication, “Secure”, the Silicon Trust Report. In the sponsored by Infineon Technologies AG. midst of the current market downturn, the High Tech Industry needs, more than ever, to SECURE - The Silicon Trust Quarterly Report is an Infineon Technologies publication take innovative, unconventional steps towards market penetration and customer retention. The Silicon Trust Program Director The decision by Infineon’s partners and cus- Veronica Preysing tomers to participate in the Silicon Trust is Email: [email protected] one of those steps. Infineon Editorial Team Veronica Preysing (Infineon Technologies) Six new Silicon Trust Partners since the last Florence Raguet (Infineon Technologies) Secure issue prove the relevance of this plat- form, which now counts players from all secu- Magazine Project Development rity areas, the steepest increase coming from Krowne Communications GmbH the most traditional of the Hardware Security Munich, Germany Sectors: the Smart Card Sector. In this issue of Creative Director/Layout Secure we are challenging the hitherto Stefan Gassner untouchable position of the Smart Card by Email – [email protected] introducing and comparing the USB Dongle as a potential alternative. Aladdin, Giesecke & Advertising & Distribution Devrient as well as Infineon are contributing Karen Brindley Email – [email protected] to this Quarterly Focus: Smart Card vs. -

Listado Liberaciones 9 Sept 2011
TODO EN ACCESORIOS TARIFA LIBERACIÓN TELÉFONOS MÓVILES ALCATEL PVD PVP PVD PVP PVD PVP Alcatel 153 3 9 Alcatel E221 3 9 Alcatel OT-565 3 9 Alcatel 155 3 9 Alcatel E227 3 9 Alcatel OT-600 3 9 Alcatel 156 3 9 Alcatel E230 3 9 Alcatel OT-606 3 9 Alcatel 303 3 9 Alcatel E252 3 9 Alcatel OT-660 3 9 Alcatel 311 3 9 Alcatel E256 3 9 Alcatel OT-708 3 9 Alcatel 320 3 9 Alcatel E257 3 9 Alcatel OT-710 3 9 Alcatel 331 3 9 Alcatel E259 3 9 Alcatel OT-799 3 9 Alcatel 332 3 9 Alcatel E260 3 9 Alcatel OT-800 3 9 Alcatel 355 3 9 Alcatel E265 3 9 Alcatel OT-802 3 9 Alcatel 363 3 9 Alcatel E801 3 9 Alcatel OT-806 3 9 Alcatel 50X 3 9 Alcatel Easy 3 9 Alcatel OT-808 3 9 Alcatel 511 3 9 Alcatel ELLE 3 9 Alcatel OT-809 3 9 Alcatel 512 3 9 Alcatel Mandarina 3 9 Alcatel OT-810 3 9 Alcatel 525 3 9 Alcatel Max db 3 9 Alcatel OT-811 3 9 Alcatel 526 3 9 Alcatel Misssixty 3 9 Alcatel OT-812 3 9 Alcatel 531 3 9 Alcatel OT-090 3 9 Alcatel OT-813 3 9 Alcatel 535 3 9 Alcatel OT-103 3 9 Alcatel OT-814 3 9 Alcatel 556 3 9 Alcatel OT-104 3 9 Alcatel OT-880 3 9 Alcatel 565 3 9 Alcatel OT-105 3 9 Alcatel OT-B331 3 9 Alcatel 70X 3 9 Alcatel OT-108 3 9 Alcatel OT-BIC 3 9 Alcatel 715 3 9 Alcatel OT-109 3 9 Alcatel OT-C700 3 9 Alcatel 715 3 9 Alcatel OT-111 3 9 Alcatel OT-C701 3 9 Alcatel 735 3 9 Alcatel OT-1650 3 9 Alcatel OT-F331 3 9 Alcatel 756 3 9 Alcatel OT-203 3 9 Alcatel OT-S319 3 9 Alcatel 757 3 9 Alcatel OT-204 3 9 Alcatel OT-S320 3 9 Alcatel 835 3 9 Alcatel OT-206 3 9 Alcatel OT-S321 3 9 Alcatel C550 3 9 Alcatel OT-208 3 9 Alcatel OT-S520 3 9 Alcatel C551 3 9 Alcatel -

Dreambox - Siemens
GSM-Support ul. Bitschana 2/38, 31-420 Kraków, Poland mobile +48 608107455, NIP PL9451852164 REGON: 120203925 www.gsm-support.net DreamBox - Siemens DreamBox is a service software device for servicing and repairing Siemens phone models. It can unlock and flash C65, C66, C6C, C6V, C72, C75, CF75, CX65, CX70, CX75, CX7I, M65, M75, ME75, M6C S65, SK65, SK6R, SL65 without disassembling the phone, as well as many other phone models. Writes full flash/language at very high speed, automatic boot selection, partial flashing of ALL blocks, reports phone diagnostic codes, supports original Siemens flash file format (Winswup), works with custom settings. - unlock all locks and phone code - allow SP-Lock to any network - read/write EEPROM, firmware, flash - fast read/write language packs/T9 packs - repair all dead phones - repair IMEI - soft works at all known SW versions - works on all Windows systems (win95, win98, win ME, win2000, winXP etc.) - can flash and communicate with phones on high speeds (921600 bps ) on every PC - many boxes can be connected to one PC - fast flashing, stable work on every PC -remote UPDATE function (box firmware and software can be updgraded remotely) - from one side DreamBox is connected to PC through USB interface. From another, device has 2 inputs for connection with a phone. - can use other flash formats. DreamBox Service Software is an interface used with DreamBox to read/write flash, unlock/relock, restore/change imei, repair, read/write settings of the phone and other functions. Functional Operations Reading Phone Information This function allows you to gather important information about the phone (IMEI, flash model, SW version etc.) Reading full flash memory Use this chapter for reading and saving phone full flash. -
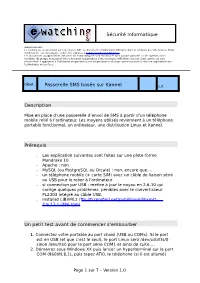
Sécurité Informatique Passerelle SMS Basée Sur Kannel Description Prérequis Un Petit Test Avant De Commencer S'embourber
Sécurité Informatique Avertissements : Le contenu de ce document est sous licence GPL. Le document est librement diffusable dans le contexte de cette licence. Toute modification est encouragée et doit être signalée à [email protected] Les documents ou applications diffusées sur e-watching.net sont en l’état et sans aucune garantie ; ni les auteurs, ni les membres du groupe ne peuvent être tenus pour responsables d’une mauvaise utilisation (au sens légal comme au sens fonctionnel). Il appartient à l’utilisateur de prendre toutes les précautions d’usage avant tout test ou mise en exploitation des technologies présentées. Date : 07/03/05 Objet : Passerelle SMS basée sur Kannel Version : 1.0 Description Mise en place d’une passerelle d’envoi de SMS à partir d’un téléphone mobile relié à l’ordinateur. Les moyens utilisés reviennent à un téléphone portable fonctionnel, un ordinateur, une distribution Linux et Kannel. Prérequis - Les explication suivantes sont faites sur une plate-forme Mandrake 10 - Apache : non - MySQL (ou PostgreSQL ou Orcale) : non, encore que…. - un téléphone mobile (+ carte SIM) avec un câble de liaison série ou USB pour le relier à l’ordinateur - si connection par USB : mettre à jour le noyau en 2.6.10 qui corrige quelques problèmes pénibles avec le convertisseur PL2303 intégré au câble USB. - Installez LIBXML2 (ftp://fr.rpmfind.net/pub/libxml/libxml2- 2.6.17-1.i386.rpm) Un petit test avant de commencer s’embourber 1. Connectez votre portable au port choisi (USB ou COMx). Si le port est en USB (et que c’est le seul), le port Linux sera /dev/usb/tts/0 sinon /dev/tts0 pour le port série COM1 et ainsi de suite…. -

Liste Eop Au 07 03 21
LISTE DE PRIX ECOL-O-POINT AU 21 MARS 2007 1 Point = 0,10 Cts CARTOUCHES JET D'ENCRE NOTE: Cette Liste est fournie à titre d'information seulement - Les informations indiquées peuvent varier à tout moment APPLE Cartridge Reference Points Apple M4609G/A or BC05 5 Apple Stylewriter M8052G/A or BC01 2 Apple Stylewriter II / 200 / 1500 M8041G/C or BC02 4 CALCOMP Cartridge Reference Points Calcomp IH 205 2 Calcomp TechJet 5500 Black IH 955B 1 Calcomp TechJet 5500 Cyan IH 955C 1 Calcomp TechJet 5500 Magenta IH 955M 1 Calcomp TechJet 5500 Yellow IH 955Y 1 CANON Cartridge Reference Points Canon BJ-10 / BJ-5 / BJ-20 BC-01 2 Canon BJ100 / 200 / 220 / 230 / BJC-150 / 210 / 240 BC-02 4 Canon BJC-150 / 210 / 241 BC-05 5 Canon BJC-150 / 210 / 242 BC-06 3 Canon BJC 4000 / 4100 / 4300 / 4400 / 5000 (black cartridge) BC-20 2 Canon BC-22 2 Canon BC-23 2 Canon B140 / 150 / 160 / 170 / 310 / 320 / 340 / 360 BX2 3 Canon B100 / 110 / Multipass 10 / 800 BX3 4 Canon B230C BX20 2 Canon PG40 Black PG 40 B 6 Canon CL41 Couleur CL 41 Couleur 6 Canon CL8 CL 8 2 Canon PG50 PG 50 B 6 Canon CL51 CL 51 Couleur 6 DELL Cartridge Reference Points Dell DEI 7Y743 6 Dell DEI 7Y745 6 Dell DEI TO529 6 Dell DEI TO530 6 Dell J5566 6 Dell J5567 6 Dell Black M 4640 6 Dell Couleur M 4646 6 Dell Black (J740) TO 601 5 Dell Couleur (J740) TO 602 5 Dell Black (5878) TO 629 5 HEWLETT PACKARD Cartridge Reference Points Hewlett Packard Black 21 9351A 5 Hewlett Packard Couleur 22 9352A 6 Hewlett Packard gris photo 59 9359E 5 Hewlett Packard 9365A 6 Hewlett Packard gris photo 100 9368A 5 -

Graduation Thesis Binne Simonides
wordt A ( () NIET OrI in Mobile devices and eCRM uitgeleend Version: Final MOBILE DEVICES AND ELECTRONIC-CRM Graduation Thesis Binne Simonides Atoy 0in 1 Atos# Origin Mobile devices and eCRM Version: Final MOBILE DEVICES AND ELECTRONIC-CRM AUTHOR(S) Binne Simonides VERSION Final INS1TTUTION Department of Mathematics and Computing Science, University of Groningen CUSTOMER Atos Origin TUM SUPERVISORS Ir. R.K. Rabbers (Atos Origin TUM) Dr. R. Smedinga (RuG, dept. Mathematics and Computing Science) Dr. Ir. T.D. Meijler (RuG, dept. Management and Organization) DOCUMENT DATE 4-07-2007 NUMBER OF PAGES 101 Atos' Origin '-ziie1ev esand eCRM ':so.: Fia1 Abstract Electronic Customer Relationship Management (eCRM) is a large enterprise application domain with complex user interaction. The dynamic market of Mobile devices introduces a lot of variability with respect to capabilities like screen-size, operating system, network support and many others. The combination of these two areas into one application makes maintainability both very important and difficult. In this thesis the primary focus will be on the possibility of increasing the maintainability of such an application through model-driven development. The following issues and solutions will be addressed. The possibility of refining a software design through a Model Driven Architecture (MDA) approach in which high-level business models are mapped to platform specific models in a multi-tiered architecture. The applicability in a model- driven development of decoupling mechanisms used by design patterns like Model View Controller (MVC) or Presentation Abstraction Control (PAC) and the possibility of using a run-time thin client approach called Wireless Universal Resource File (WURFL) for supporting the differences between the many different mobile devices. -

Product Catalogue Company Presentation
2001/2002 Product Catalogue Company presentation Smarteq Wireless AB is a Swedish company founded 1996. Smarteq headquarters are located in Stockholm, Sweden and has sales offi ces in Germany and USA. The company has 50 employees. Smarteq products are sold through after-market distributors in 35 countries, directly to the Automotive industry, to Original Equipment Manufacturers of mobile telephones and to Operators of mobile telephone networks. Business idea By using the latest technology Smarteq develops and manufactures access products for the wireless telecom market. Products are vehicle antennas, hands free equipment and telematic equipment and solutions. This makes Smarteq a complete provider of telecom products for use in vehicles. Operations are focused on development and sales of the products for after-market and OEM market. Vision Smarteq will become the leading partner in development of user- friendly solutions within wireless telecoms. Mission Smarteq develops new functions within wireless telecoms which increases people’s fl exibility, safety and security. Quality Our quality system puts the customer in focus. We emphasise on speed, accuracy and reliability in product development and production. Smarteq is certifi ed according to QS-9000:1998/ISO 9001:1994. Car kits Smarteq has a wide range of full functional hands free car kits for the profes- sional user. Those products have been developed in-house since 1996 and have been installed in countries all over the world. Vehicle antennas The vehicle antennas have its background in antenna development over 50 years. Smarteq has the reputation for high-quality and high performing anten- nas. The wide range of vehicle antennas – body mounts, magnetic mounts, glass mounts and in-car antennas will satisfy every demand in the market. -

Product Guide
Table of Contents TABLE OF CONTENTS..............................................................................................................................1 INTRODUCTION TO OZEKI SMS.......................................................................................................2 OVERVIEW OF THE FEATURES ......................................................................................................................2 IMPROVE THE EFFICIENCY OF YOUR BUSINESS WITH OZEKI SMS...........................................................3 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ..................................................................................................3 SCHEDULED SMS PLUGIN - EVENT REMINDER SERVICE ...........................................................................4 SMS BULLETIN BOARD SERVICE ..................................................................................................................4 WEBPAGE MONITOR ......................................................................................................................................4 SMS CHAT SERVICE .....................................................................................................................................5 SMS NEWSLETTER SERVICE ........................................................................................................................5 WHAT IS THE OZEKI SMS SERVER APPLICABLE FOR IN A SCHOOL?........................................................5 WHAT ARE THE ADVANTAGES OF SENDING SMS MESSAGES? -

Prvi U Telekomunikacijama I Multimediji Prvi U Telekomunikacijama Broj #100
www.mobil.hr I cafe.mobil.hr #100 PRVI U TELEKOMUNIKACIJAMA I MULTIMEDIJI BROJ #100 | LIPANJ / JUNE 2008. | GODINA X. | CIJENA 25 kn | 3,5 € / 6,5 KM / 160 DIN MOBIL(MEDIA) -OD1DO100/LGHB620MOTOROLAROKRE8SAMSUNGSGH-U900SOULJAMOS506HCS /100 3/NADT535BUGOVI HZ TELKAČI / PODEŠAVANJE TV-A / KAKO DOHDSADRŽAJA/TESTLCDIPLAZMATV-A /KAKO TV-A /PODEŠAVANJE HZ TELKAČI Omot_100_proba.indd 1 29.5.2008 1:09:26 Omot_100_proba.indd 2 29.5.2008 1:09:31 RADAR TELEKOMUNIKACIJE MULTIMEDIJA INFORMATIKA LIFESTyLE M.INFO .01 .02 .03 .04 .05 .06 WWW.MOBIL.HR | CAFE.MOBIL.HR .100 | 06.2008. 3 Naslovnica Mobil #1 (1.0).indd 3 28.5.2008 17:25:29 Uvodnik Impresum Mobil - magazin o mobilnim Poštovani, komunikacijama Glavni urednik: Pred sobom držite prvi broj magazina iskljuivo posveenog mobilnim komunikacijama Saša Or$i svih vrsta. Dulje je vrijeme u nas prisutna težnja stihijskog pisanja o ovoj problematici. Zamjenik glavnog urednika: Dosta tiskovina povremeno odvoji pokoju stranicu za opise novih GSM ureaja ili DECT Davor Petri telefona no sustavno praenje mobilne telefonije do sada je bilo zanemareno. Ureivaki kolegij: Slaven Devlin, Mario Duki , Svjetska iskustva govore da kritina masa od preko 200.000 korisnika mobilnih telefona Zvonko Pavleti , Davor Petri , zadovoljava sve uvjete neophodne za izdavanje ovakvog magazina. Saša Or$i , Darko Sko$ir S druge pak strane inozemne se izdavake kue ne bore esto s našim problemima: dugim rokovima naplate, problematinim potraživanjima, optereujuim nametima i Tehnika podrška: Komteh d.o.o. porezima... Trg sportova 11 Usprkos svemu odluili smo tržištu ponuditi magazin koji e kvalitetno progovoriti o Fotograf: Božidar Prezelj problemima koji mue prosjenog korisnika mobilnog telefona. -

NTC Type Approval No. Type of Equipment Brand/Model Marketing
LIST OF CUSTOMER PREMISES EQUIPMENT (CPE) G WC LT G NTC Type Approval No. Type of Equipment Brand/Model Marketing Name Integrated Module S DM Date Issued Applicant E PS M A ESD-CPE-1502962 HP / SIC 1ADSL; HP MSR 1-port ADSL2+ SIC Module (JD537A) 1-Port ADSL2+ SIC Module 04/14/2015 HP (Phils) Corporation ESD-CPE-1502993 1-Port E1 Voice Interface Module 1-port Voice E1 SIC Module 06/17/2015 HEWLETT PACKARD PHILIPPINES CORP. ESD-CPE-1603171 GSM Gateway with ISDN PRI Interface 2N / 2N® StarGate x 12/15/2016 CHALLENGE SYSTEMS INCORPORATED ESD-CPE-1102359 PABX with Cinterion MC55i GSM/GPRS Module 2N NetStar 03/14/2011 Wordtext Systems, Inc. ESD-CPE-1603171 GSM Gateway with ISDN PRI Interface 2N StarGate x 07/28/2016 Logic Solutions Inc ESD-CPE-1603155 GSM/GPRS VOIP Gateway 2N TELEKOMUNIKACE a.s / 2N StarGate x x 05/24/2016 Cognetics Inc ESD-CPE-1603220 VoiP GSM/WCDMA Gateway 2N TELEKOMUNIKACE a.s / 2N VoiceBlue MAX x x 11/08/2016 COGNETICS INC ESD-CPE-0100243 DATA MODEM 3C3FEM656c 3COM 10/100 LAN + 56K 05/16/2001 3COM PHILIPPINES, INC. ESD-CPE-0000173 MODEM 3COM 10/100 LAN +56K Global Modem CardBus PC Card 01/31/2000 3COM PHILIPPINES, INC. ESD-CPE-0100242 KEY TELEPHONE 3COM NBX 100 07/12/2001 3COM PHILIPPINES, INC. ESD-CPE-0000172 MODEM 3COM US ROBOTICS 56K FAX Modem USB 01/04/2001 3COM PHILIPPINES, INC. ESD-CPE-0801880 ADSL Modem 3COM WL-603 09/19/2008 3COM Corporation ESD-CPE-1703247 End Device Router with GSM/WCDMA/HSPA+ Module 3CSN/3CW4G x x 03/23/2017 3C Enterprise IP Pty Ltd Australia ESD-CPE-0200330 DATA MODEM 802.11b Wireless Ethernet + AC'97 Modem PCI Type IIIA Adapter Model: M3AWEB56GA 04/26/2002 Intel Microelectronics Philippines, Inc.