ALFRED & ID Eine Hommage an Alfred Bester
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Science Fiction List Literature 1
Science Fiction List Literature 1. “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall,” Edgar Allan Poe (1835, US, short story) 2. Looking Backward, Edward Bellamy (1888, US, novel) 3. A Princess of Mars, Edgar Rice Burroughs (1912, US, novel) 4. Herland, Charlotte Perkins Gilman (1915, US, novel) 5. “The Comet,” W.E.B. Du Bois (1920, US, short story) 6. Fahrenheit 451, Ray Bradbury (1951, US, novel) 7. Limbo, Bernard Wolfe (1952, US, novel) 8. The Stars My Destination, Alfred Bester (1956, US, novel) 9. Venus Plus X, Theodore Sturgeon (1960, US, novel) 10. Do Androids Dream of Electric Sheep?, Philip K. Dick (1968, US, novel) 11. The Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin (1969, US, novel) 12. The Female Man, Joanna Russ (1975, US, novel) 13. “The Screwfly Solution,” “The Girl Who Was Plugged In,” “The Women Men Don’t See,” “Houston, Houston Do You Read?”, James Tiptree Jr./Alice Sheldon (1977, 1973, 1973, 1976, US, novelettes, novella) 14. Native Tongue, Suzette Haden Elgin (1984, US, novel) 15. Stars in My Pocket Like Grains of Sand, Samuel R. Delany (1984, US, novel) 16. Neuromancer, William Gibson (1984, US-Canada, novel) 17. The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood (1985, Canada, novel) 18. The Gilda Stories, Jewelle L. Gómez (1991, US, novel; extended edition 2016) 19. Dawn, Octavia E. Butler (1987, US, novel); Parable of the Sower, Butler (1993, US, novel); Bloodchild and Other Stories, Butler (1995, US, short stories; extended edition 2005) 20. Red Spider, White Web, Misha Nogha/Misha (1990, US, novel) 21. The Rag Doll Plagues, Alejandro Morales (1991, US, novel) 22. -
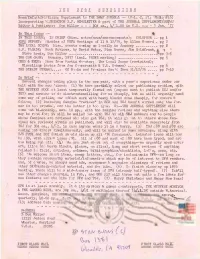
SF&F Newsletter Miller 1977-01
THE S F & F NEWSLETTER News/Info/Advertising Supplement to THE SF&F JOURNAL — (Vol. -2, #1; Whole y/16) Incorporating WASHINGTON S.F. NEWSLETTER '& part of THE JOURNAL SUPPLEMENT/SOTWJ Editor & Publisher: Don Miller - - - 300 ea., U/Sl.OO in U.S. -■-» - 3 Jan. *77 In This Issue — <| IN THIS ISSUE; IN BRIEF (Misc, notes/news/announcements); COLOPHON pg 1 ESFA REPORT: Minutes of ESFA Meetings of 11 & 12/76, by Allan Howard . pg 2 THE LCCAL SCENE: Misc. events coming up locally in January ........... pg 2 S.F. PARADE: Book Reviews, by David Bates, Stan Burns,- Jim Goldfrank, < I x Steve Lewis, Don Miller ................................................................................. 3-5 THE CON GAME: January, 1977 (incl. PRSFS meeting) .................. pg 5 ODDS & ENDS: More from Martin Wooster; The Local Scene (revisited); Miscellany (notes from Jon Coopersmith & T.L. Bohman) ............ pg 6 THE STEADY STREAM....: Of Books and Prozines Rec'd Thru 31/12/76 ..... pp 7-10 In Brief — Several changes taking place in the new year, with a year's experience under our belt with the new 'zines: (1) We have partially solved our publishing problem, with THE MYSTERY NOOK at least temporarily farmed out (anyone want to publish TSJ and/or TG?) and someone to do electrostencilling for us cheaply, but we still urgently need some way of getting our offset work with heavy blacks done cheaply, for covers & folios; (2) Including fanzine "reviews" in SFN and TSJ hasn't worked out; the for mer is too crowded, and the latter is too slow. So—THE JOURNAL SUPPLEMENT will come out bi-monthly, max. -

Souvenir Book Are Copyright© 1996 by Readercon, Inc
COMING TO BOOKSTORES EVERYWHERE SEPTEMBER 1O THE LONG-AWAITED NEW NOVEL Available in hardcover from G- P. PUTNAM'S SONS READERCON EIGHT JULY 12-14, 1996 WESTBOROUGH, MASS. Hello From the Chairman • B. Diane Martin • 3 Discovering Gibson • Barnaby Rapoport • 5 Burning Gibson • Paul Di Filippo • 6 Thoughts and Observations on William Gibson • Paul T. Riddell • 8 Junk Art City • Takayuki Tatsumi *10 Academy Leader • William Gibson *14 Idoru • William Gibson *16 William Gibson: A Bibliography • 18 Jackdaw • Stephen Brown • 20 Avant-Pop 101 • Larry McCaffrey • 22 Larry McCaffery: A Bibliography • 42 Alfred Bester & Me • William Gibson • 45 The Magpie Mind of Alfred Bester • Robert Ingria • 47 Alfred Bester: A Bibliography • 50 Richard M. Powers • David Hartwell • 53 The Readercon Committee • 55 B. Diane Martin • Con Committee Chair David G. Shaw • Programming Chair D. Shaw/B. Ingria • Track management Merryl Gross • Dealer's Room D. Walrath • Operations John O'Neil • At-con Treasurer Karl Wurst/R. Duffy • Registration Jamie Siglar • Bake Sale Brian Youmans • Hotel banquet Sheila Lightsey • Green Room & CS/GR logistics A. West/N.K. Wurst • Con Suite Kathei Logue • Kaffee Klatsches George Flynn • Fanzine display The contents of this souvenir book are Copyright© 1996 by Readercon, Inc. except where noted. Design and production by Bryan Cholfin, except the Jackdaw spread on pages 20-21 by Stephen Brown. Cover design and artwork by Joey Zone. The New York Review of Science Fiction | . A somewhat unusual critical semiprozine. It publishes general articles of remarkably varying quality on sf, as well as some of the best long reviews in the field. -

Download the Stars My Destination Pdf Ebook by Alfred Bester
Download The Stars My Destination pdf ebook by Alfred Bester You're readind a review The Stars My Destination ebook. To get able to download The Stars My Destination you need to fill in the form and provide your personal information. Book available on iOS, Android, PC & Mac. Gather your favorite books in your digital library. * *Please Note: We cannot guarantee the availability of this file on an database site. Book Details: Original title: The Stars My Destination 236 pages Publisher: iPicturebooks; 2nd ed. edition (June 30, 2011) Language: English ISBN-10: 1876963468 ISBN-13: 978-1876963460 Product Dimensions:6 x 0.5 x 9 inches File Format: PDF File Size: 5127 kB Description: #5 in the Millennium SF Masterworks series, a library of the finest science fiction ever written. Science fiction has only produced a few works of actual genius, and this is one of them-Joe Haldeman Bester at the peak of his powers is, quite simply, unbeatable -James Lovegrove Marooned in outer space after an attack on his ship, Nomad, Gulliver... Review: I read Alfred Besters Tiger! Tiger! at 12. It was good, but not all that and a side of chips. Last night, many years later, I re-read it and was crying uncontrollably by the end and realized its one of those books which comes along once a generation if we are very, very lucky. The Wild Machines havent been messing with the text and changing the... Ebook Tags: science fiction pdf, gully foyle pdf, alfred bester pdf, count of monte pdf, monte cristo pdf, demolished man pdf, years ago pdf, tiger tiger pdf, main character pdf, ever written pdf, space opera pdf, solar system pdf, gulliver foyle pdf, inner planets pdf, read this book pdf, ahead of its time pdf, ever read pdf, fiction novels pdf, best science pdf, novels ever The Stars My Destination pdf book by Alfred Bester in Literature and Fiction Literature and Fiction pdf books The Stars My Destination the stars destination my book destination the stars my ebook my stars the destination pdf destination my the stars fb2 The Stars My Destination Great Resource and very easy read. -

OF TIME, and GULLY FOYLE by Neil Gaiman You Can Tell When A
The Stars My Destination 7 OF TIME, AND GULLY FOYLE by Neil Gaiman You can tell when a Hollywood historical film was made by looking at the eye makeup of the leading ladies, and you can tell the date of an old science fiction novel by every word on the page. Nothing dates harder and faster and more strangely than the future. This was not always true, but somewhere in the last thirty years (somewhere between the beginning of the death of what John Clute and Peter Nicholls termed, in their Encyclopedia of Science Fiction, “First SF” in 1957 when Sputnik brought space down to earth and 1984, the year that George Orwell ended and William Gibson started) we lurched into the futures we now try to inhabit, and all the old SF futures found themselves surplus to requirements, standing alone on the sidewalk, pensioned off and abandoned. Or were they? SF is a difficult and transient literature at the best of times, ultimately problematic. It claims to treat of the future, all the what-ifs and if-this-goes-ons; but the what-ifs and if-this-goes-ons are always founded here and hard in today. Whatever today is. To put it another way, nothing dates harder than historical fiction and science fiction. Sir Arthur Conan Doyle’s historical fiction and his SF are of a piece—and both have dated in a way in which Sherlock Holmes, pinned to his time in the gaslit streets of Victorian London, has not. Dated? Rather, they are of their time. -

Big Sky 3 August 2557 / 2O14
for big skY loncon 3 3 sf masterworks 1 sf masterworks 1 Sooner or later all Science Fiction comes true. 3 — J.G. Ballard, interviewed in Interzone #22, Winter 1987 Part-genzine, part-perzine, variable sercon/fannish content. If you are not satisfied with this product please contact your nearest SF Masterworks dealer. The next letters column will be in issue #5 – please be part of it ! Send all Letters of Comment, articles and artwork to [email protected]. Edited and published by Peter Young. This fanzine has been produced independently of both Gollancz and Loncon 3. Cover: The Sky Is Falling — Andrew Nelson, 2011 (cc) Fanzines in trade can be sent to: Pages 2–6: Spiral Space — ©2014 Sue Jones, used by permission 136/200 Emerald Hill Village, Soi 6, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110, Thailand Pages 7 & 11: ©2014 Peter Young or if postage is less: Page 85: The Time Machine/The War of the Worlds — ©1999 Chris Moore, used by c/o 22 Tippings Lane, Woodley, Berkshire, RG5 4RX, England permission Page 139: Flow My Tears, the Policeman Said – Weeping with Philip K. Dick — James Thanks to all contributors for use of their articles and artwork. Clayton, 2011 (cc) See page 225 for full credit details and brief author bios. Page 240: Just Testing — Andrew Nelson, 2013 (cc) contents SF Masterworks: One Reader’s Brief Overview Peter Young 7 1 Joe Haldeman, The Forever War Farah Mendlesohn, Charles Dee Mitchell 12 2 Richard Matheson, I Am Legend Chris Bekofske, Charles Dee Mitchell 15 3 James Blish, Cities in Flight Manny Rayner, Brian Clegg, Peter Young, Kate Sherrod 18 4 Philip K. -

Alienating Punishment: Prisons in Science Fiction Ariel Wetzel a Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requireme
Alienating Punishment: Prisons in Science Fiction Ariel Wetzel A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of English Literature University of Washington 2014 Reading Committee: Thomas Foster, Chair Gillian Harkins Rebecca Aanderud Program Authorized to Offer Degree: English Department ©Copyright 2014 Ariel Wetzel University of Washington Abstract Alienating Punishment: Prisons and Science Fiction Ariel Wetzel Chair of the Supervisory Committee Professor Thomas Foster English Department This dissertation asserts that science fiction (SF) takes a commonplace, the prison, and estranges it to make it unfamiliar and subject to critical examination. The dissertation explores this claim through two subjects: the prison as an institution and the body of the prisoner. The institution is examined through a utopian (and dystopian) lens, as the dissertation claims that utopias, prisons are intentional communities designed to be homogeneous and orderly, as both utopias and prisons are thought of as “world apart.” Upon closer examination, this dissertation demonstrates how that when the fictional prison is made unfamiliar, it is revealed to be a simultaneously utopian and dystopian space, a dysfunctional project of control and perfection. This offers a new interpretation of the utopian tradition, one where the prison is always present and integral to the utopia itself. Then, this dissertation turns to examine the treatment of the prisoner in SF. It shows that SF represents the prisoner’s body as figuratively estranged through speculative disciplinary technologies, where incarceration is represented as literally alien. This might take the form of virtual reality prison, where incarceration is experienced subjectively, or forced imposition into the gender binary. -

The Starcomber Online
Um14n [FREE] The Starcomber Online [Um14n.ebook] The Starcomber Pdf Free Alfred Bester *Download PDF | ePub | DOC | audiobook | ebooks Download Now Free Download Here Download eBook #676983 in eBooks 2013-12-06 2013-12-06File Name: B00HK2S3N2 | File size: 76.Mb Alfred Bester : The Starcomber before purchasing it in order to gage whether or not it would be worth my time, and all praised The Starcomber: 0 of 0 people found the following review helpful. "5,271,009" retitledBy Richard LivingstonThe only problem is, this is the story "5,271,009" retitled. But a wonderful, manic story about a modern scientific warlock.2 of 2 people found the following review helpful. Anything from Alfred Bester is good.By frogzillaJust like the title of this comment says, anything Alfred wrote is good, and this is a prime example of his work.0 of 0 people found the following review helpful. Essential Bester.By A. W. MoatsBester was among the very best. And this one may be his most original. Take two parts of Beelzebub, two of Israfel, one of Monte Cristo, one of Cyrano, mix violently, season with mystery and you have Mr. Solon Aquila. He is tall, gaunt, sprightly in manner, bitter in expression, and when he laughs his dark eyes turn into wounds. His occupation is unknown. He is wealthy without visible means of support. He is seen everywhere and understood nowhere. About the AuthorALFRED BESTER was born in 1913. His fiction career included writing for the pulp magazines, comics, radio, and television. His extraordinary book, The Demolished Man, was the first winner of the Hugo Award for Best Novel and was followed by the brilliant novels The Stars My Destination, The Computer Connection, Golem100, and The Deceivers, and numerous short stories. -

From the Head Librarian It Gives Me Great Pleasure to Announce New Appointments in the Library Staff, Both New Employees and Familiar Faces
NOTESVolume 18, Number 4, Fall SeaSoN 2011 From the head Librarian It gives me great pleasure to announce new appointments in the Library staff, both new employees and familiar faces. First, Jane Goldstein is retiring this December, after a long and successful career as a Circulation Assistant, Head of Circulation, and, for the last five years, Assistant Head Librarian. Jane assures me she is looking forward to catching up on her reading, traveling with her husband, Ken, and visiting family and friends around the country. We will certainly miss Jane’s steady presence in the Library, but I am happy to report that Carolyn Waters will step into her shoes as Assistant Head Librarian. Since 2008, Carolyn has been devoted to writers’ and reference services at the desk and organized our diverse Writing Life events and writers’ groups. Andrew Corbin, previously our Renovation Projects Librarian and Circulation Assistant, is com- ing back full-time in December and will join Steve McGuirl and Janet Howard in the Acquisitions Department as Acquisi- tions and Reference Librarian. Finally, Jennifer Hanley-Leonard is the new Children’s Librarian and is working part-time with Carrie Silberman and Ana Chiu in the very active Children’s Library. Congratulations to Jane, Carolyn, Andrew, and Jennifer! The Society Library hosted this year’s meeting of directors and librarians of the Membership Libraries Group October 21- 23. I was proud to introduce my great staff and show off the gorgeous skylight and the improved and renovated fifth floor to the twenty-two representatives and guests from our cousin institutions. -

The Reluctant Famulus # 80 March/April 2011 Thomas D
The Reluctant Famulus # 80 March/April 2011 Thomas D. Sadler, Editor/Publisher, etc. 305 Gill Branch Road, Owenton, KY 40359 Phone: 502-484-3766 E-mail: [email protected] Contents Introduction, Editor 1 Old Kit Bag, Robert Sabella 6 Invention, news bit 9 Rat Stew, Gene Stewart 10 Bisbee Jewels, Matt Howard 12 Kentuckiana, Al Byrd 15 Sticker Shock, Sheryl Birkhead 19 Possum, news bit 22 Redshift, John Thiel 23 LoCs 25 Artwork “Botch” 5, 14, 24 Kurt Erichsen 6, 10 Brad Foster 34, 42 Alexis Gilliland/W. Rotsler Cover Alexis Gilliland 28, 32, 38, 40 Matt Howard 12, 13 (postcards) A. B. Kynock 1, 26,30, 36 Spore and Toe Toe Hodges 2, 3, 4 Borrowed from the Internet 12, 15, 18, 22, Back cover T. D. Sadler back cover caption The Reluctant Famulus is a product of Strange Dwarf Publications. Many of the comments expressed herein are solely those of the Editor/Publisher and do not necessarily reflect the thoughts of any sane, rational persons who know what they are doing and have carefully thought out beforehand what they wanted to say. Material not written or produced by the Editor/Publisher is printed by permission of the various writers and artists and is copyright by them and remains their sole property. Permission is granted to any persons who wish to reprint material presented herein, provided proper and due credit is given both to the author/artist who produced the material and to the original publication in which it appeared. TRF maybe obtained for The Usual but especially in return for written material and artwork, postage costs, The Meaning of Life, , and Editorial Whim. -

Alfred Bester
Bibliographie d’ Alfred Bester Alfred BESTER (1913-1987) Romans R.01. « The Demolished Man ». In : Galaxy, janvier, février & mars 1952. En volume : The Demolished Man . Chicago : Shasta Publishers, 1953. % Hugo 1953 (Roman) En français : L’homme démoli (trad. de Jacques Papy). 1) Paris : Denoël, 1955 (Présence du futur, nº 9). Réimp. : 1958, 1977, 1989, etc. 2) In : L’homme démoli/Terminus les étoiles, recueil, Denoël, 2007 [F.02]. R.01.1 (1955) R.01.1 (1958) R.01.1 (1977) R.01.1 (1989) R.02. Who He? New York : Dial, 1953. [Non S.F.]. [Autre titre : The Rat Race ]. R.03. Tiger! Tiger! London : Sidgwick & Jackson, 1956. [1 ère version de R.04]. R.04. « The Stars My Destination ». In : Galaxy, octobre, novembre, décembre 1956 & janvier 1957. En volume : The Stars My Destination . [New York] : Signet/New American Library, 1957. [Version remaniée de R.03]. En français : 1) « Jusqu’aux étoiles » (trad. anonyme “tronquée”). In : Galaxie [1 ère série] , nºs 56 & 57, juillet & août 1958. 2) Terminus les étoiles (trad. de Jacques Papy). Paris : Denoël, 1958 (Présence du futur, nº 22). Réimp. : 1982, 1990, etc. 3) In : L’homme démoli/Terminus les étoiles, recueil, Denoël, 2007 [F.02]. R.04.1 (1958) R.04.1 (1982) R.04.1 (1990) R.05. « The Indian Giver ». In : Analog Science Fiction – Science Fact, novembre, décembre & janvier 1975. En volume : The Computer Connection . New York : Berkley Publishing Corporation, 1975. [Autre titre : Extro ]. En français : Les clowns de l’Eden (trad. de Guy Abadia). 1) Paris : Robert Laffont, 1976 (Ailleurs et Demain). 2) Paris : J’ai Lu, 1981 (n° 1269). -

San Diego Public Library New Additions March 2009
San Diego Public Library New Additions March 2009 Adult Materials 000 - Computer Science and Generalities California Room 100 - Philosophy & Psychology CD-ROMs 200 - Religion Compact Discs 300 - Social Sciences DVD Videos/DVD-ROMs/Videocassettes 400 - Language eAudiobooks & eBooks 500 - Science Fiction 600 - Technology Foreign Languages 700 - Art Genealogy Room 800 - Literature Graphic Novels 900 - Geography & History Large Print Audiocassettes Newspaper Room Audiovisual Materials Biographies Fiction Call # Author Title FIC/ABERCROMBIE Abercrombie, Joe. The blade itself FIC/ADIGA Adiga, Aravind. The white tiger : a novel FIC/AGEE Agee, James, 1909-1955. A death in the family [MYST] FIC/ALBERT Albert, Susan Wittig. The tale of Briar Bank : the cottage tales of Beatrix Potter [MYST] FIC/ANDREWS Andrews, Donna. No nest for the wicket FIC/ANDREWS Andrews, Mary Kay, 1954- Deep dish [MYST] FIC/ASNER Asner, Jules, 1968- Whacked [MYST] FIC/ATKINSON Atkinson, Kate. When will there be good news? : a novel [MYST] FIC/AULT Ault, Sandi. Wild inferno FIC/AUSTEN Austen, Jane, 1775-1817. Pride and prejudice FIC/AUSTEN Austen, Jane, 1775-1817. Sense and sensibility FIC/BAKER Baker, Tiffany. The little giant of Aberdeen County : a novel FIC/BALDACCI Baldacci, David. Divine justice FIC/BALDACCI Baldacci, David. Simple genius FIC/BALDACCI Baldacci, David. The collectors FIC/BALDACCI Baldacci, David. The whole truth FIC/BANKS Banks, Iain, 1954- The crow road : a novel FIC/BANKS Banks, L. A. The forsaken : a vampire huntress legend FIC/BANKS Banks, L. A. The shadows FIC/BANKS Banks, Russell, 1940- The Reserve : a novel FIC/BARNES Barnes, Jonathan. The somnambulist [MYST] FIC/BAYARD Bayard, Louis.