Ludwig Anzengruber – Ein Verkannter Naturalist?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Xerox University Microfilms 300 North Zaab Road Ann Arbor, Michigan 46106 I I
INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. Thefollowing explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1. The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page ($)''. If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. Whan an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that die photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. You w ill find a good image of the page in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in "sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to right in equal sections w ith a small overlap. If necessary, sectioning is continued again — beginning below the first row and continuing on until complete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, however, a somewhat higher quality reproduction could be made from "photographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

Ludwig Anzengruber Und Die Zensur Anmerkungen Zur Bauernkomödie Die Kreuzelschreiber
Ludwig Anzengruber und die Zensur Anmerkungen zur Bauernkomödie Die Kreuzelschreiber Von Matthias Mansky Zensur. Ein Dichter hört in die Zukunft, er hört das Dröhnen der Schritte noch außer der Zeit. Er will warnen, da legt ihm die Polizei die Finger [auf den Mund] und sagt: Warnen Sie nicht, das beunruhigt nur!1 Es ist vonseiten der Forschung oftmals darauf hingewiesen worden, dass die Wie- ner Zensurpraxis nach 1850 einer monographischen Aufarbeitung harrt und die momentane Kenntnis der Handhabung der ‚Bachschen Zensurgesetze‘ noch immer auf Einzelfälle begrenzt ist.2 Auch wenn es in der Ära des Neoabsolutismus zu weni- ger Aufführungsverboten kam und der Liberalismus zwischenzeitlich eine toleran- tere Auslegung und Verfahrensweise der Zensurgeschäfte bewirkte, wurde mit der Theaterverordnung vom 25. November 1850 im Grunde der vormärzliche Zustand restituiert, der bis 1926 in Kraft blieb.3 Theater durften demnach nur von konzes- sionierten Unternehmern bespielt werden, die für die Erstaufführung eines Stücks weiterhin eine Aufführungsbewilligung einholen mussten. Die Staatssicherheits- behörde (Stadthauptmannschaft, Polizeidirektor, Bezirkshauptmannschaft) ver- antwortete die korrekte Umsetzung der vom Innenministerium unter Alexander von Bach erlassenen Theaterordnung. Ihr waren Instruktionen beigelegt, in denen die Vorsicht bei der Vergabe von Konzessionen akzentuiert sowie die Gründung eines Zensurbeirats befohlen wurde. Da man das Theater als „mächtige[n] Hebel 1 Ludwig Anzengruber: Sämtliche Werke. Kritisch durchgesehene Gesamtausgabe in 15 Bän- den. Unter Mitwirkung von Karl Anzengruber herausgegeben von Rudolf Latzke und Otto Rommel. Bd. 8: Gott und die Welt. Aphorismen aus dem Nachlasse. Nach den Hand- schriften herausgegeben von Otto Rommel. Wien; Leipzig: Schroll 1920, S. 222. 2 Vgl. Johann Hüttner: Theater als Geschäft. -

Zeitschrift Für Literatur- Und Theatersoziologie
Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie Herausgegeben von Beatrix Müller-Kampel und Marion Linhardt JAHRGANG 13 (2020) NUMMER 16 Das Politische, das Korrekte und die Zensur II Kulturgeschichtliche und kultursoziologische Perspektiven Medieninhaber und Verleger LiTheS. Ein Forschungs-, Dokumentations- und Lehrschwerpunkt am Institut für Germanistik der Universität Graz Leitung: Beatrix Müller-Kampel Herausgeberinnen und Lektorat Ao. Univ.-Prof. Dr. Beatrix Müller-Kampel Institut für Germanistik der Universität Graz Harrachgasse 21 / VI, 8010 Graz Tel.: ++43 / (0)316 / 380–2453 E-Mail: [email protected] Fax: ++43 / (0)316 / 380–9761 Prof. Dr. Marion Linhardt Universität Bayreuth Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät, Gebäude GW I Universitätsstraße 30, 95447 Bayreuth E-Mail: [email protected] Umschlagbild Adolf Bäuerle (?): Modeschwindel. Ein lokales Lustspiel in fünf Aufzügen. Handschrift. Format: 24 x 19,0 cm, 225 Seiten. ÖNB / Sammlung von Handschriften und alten Dru- cken (Cod. Ser. n. 175 Han). – Vgl. dazu auch: Beatrix Müller-Kampel: »À la mode«. Zu einer soziomoralischen Kategorie der Komödie und der komischen Oper (Wien, 1760er bis 1820er Jahre). In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 9 (2016), Nr. 14: Mode – Geschmack – Distinktion II, S. 43–94: http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html Gestaltung und Satz mp – design und text / Dr. Margarete Payer Gartengasse 13, 8010 Graz Tel.: ++43 / (0) 664 / 32 23 790 E-Mail: [email protected] © Copyright »LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie« erscheint halbjährlich im Internet unter der Adresse »http://lithes.uni-graz.at/lithes.html«. Ansicht, Download und Ausdruck sind kostenlos. Namentlich gezeichnete Beiträge geben immer die Meinung des Autors oder der Autorin wieder und müssen nicht mit jener der Herausgeberinnen identisch sein. -

Deutsch Ohne Grenzen Gesellschaftswissenschaften
Deutsch ohne Grenzen Gesellschaftswissenschaften Alena Jaklová, Anja Edith Ference (Hrsg.) Tribun EU 2015 Germanistenverband der Tschechischen Republik Pädagogische Fakultät der Südböhmischen Universität Budweis Philosophische Fakultät der Südböhmischen Universität Budweis Deutsch ohne Grenzen Gesellschaftswissenschaften prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. Anja Edith Ference, M.A., Ph.D. (Hrsg.) Tribun EU 2015 Vědecký výbor konference/ Wissenschaftliches Komitee/ Scientiic Comittee Doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Doc. Dr. habil. Jürgen Eder Anja Edith Ference, M.A., Ph.D. PhDr.Vít Dovalil, Ph.D. Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. Prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. Mgr. Jana Kusová, Ph.D. Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. Dr.phil. Zdeněk Pecka Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. Univ.-prof. Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Norbert Richard Wolf Vydáno s inanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Gedruckt mit inanzieller Unterstützung des Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik. Published with inancial support of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. Recenze/ Rezension/ Review Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. Dr. Torsten Lorenz his edition © Tribun EU, 2015 ISBN 978-80-263-0931-4 Inhaltsverzeichnis Předmluva ......................................................................................... 7 Vorwort ......................................................................................... -

Storia Del Teatro Tedesco Prof. Gabriella Rovagnati
Storia del Teatro Tedesco Prof. Gabriella Rovagnati BURGTHEATER E DINTORNI I Teatri di Vienna a.a. 2009 - 2010 Che a Vienna l’amore p er il teatro sia diffuso in maniera particolare e capillare è cosa nota. Nel suo libro di memorie, Il mondo di ieri , pubblicato postumo, lo scrittore Stefan Zweig, nato a Vienna nel 1881 e morto suicida a Petropolis (presso Rio de Janeiro) nel 1942, descri ve così il clima culturale che regnava nella sua città natale quand’era liceale e giovane studente: Non vi era forse città europea in cui quest’aspirazione alla cultura fosse appassionata come a Vienna. Appunto perché la monarchia austro - ungarica manca va da secoli di ambizioni politiche e non aveva avuto particolare successo nelle sue azioni militari, l’orgoglio patriottico si era intensamente rivolto al desiderio di un predominio artistico. L’antico impero asburgico, una volta dominatore dell’Europa, a veva da tempo perduto preziose e importantissime province tedesche e italiane, fiamminghe e vallone; era rimasta intatta nel suo splendore la capitale, sede della Corte, conservatrice di una tradizione millenaria. I romani avevano erette le prime pietre di quella città quale castrum , quale posto avanzato a proteggere la cultura latina dai barbari, e più di mille anni dopo l’impero degli Osmani si era infranto contro quelle mura. Qui erano passati i Nibelunghi, lì aveva mandato la sua luce immortale la sette mplice costellazione di Gluck, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms e Johann Strauss; qui avevano confluito tutte le correnti della cultura europea. A Corte, fra la nobiltà e fra il popolo, l’elemento tedesco era unito per sangue a quello slavo, ungherese, s pagnolo, italiano, francese, fiammingo ed era la vera genialità di questa città musicale il saper fondere armonicamente questi contrasti in qualcosa di nuovo e di caratteristico, nell’elemento austriaco e viennese. -

ACTIEN-VOLKSTHEATER Repertoire Der Spielzeiten 1865
ACTIEN-VOLKSTHEATER Repertoire der Spielzeiten 1865 –1872/73 KÖNIGLICHES THEATER AM GÄRTNERPLATZ Repertoire der Spielzeiten 1873/74 – 1917/18 GÄRTNERPLATZTHEATER Repertoire der Spielzeiten 1918/19 – 1930/31 Eine chronologische Dokumentation Redaktion: Dr. Thomas Siedhoff unter Verwendung der von Elke Schöninger zusammengestellten Daten Zur Benutzung Der Katalog des Gesamtrepertoires folgt den Ankündigungen auf den Theaterzetteln, den Programmheften mit ihren Besetzungszetteln sowie der Tagespresse. Diese Daten enthalten nicht selten Fehler und/oder sind unvollständig. Den die wissenschftliche Brücke zwischen täglichem Theaterbetrieb und dokumentarischem Ehrgeiz und forschungsverbundener Annäherung an den Spielplan und dessen Profil bauenden Dramaturgen gab es frühestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Daher wird/wurde der Gesamtkatalog möglichst eingehend bibliographiert und ergänzt. Diese Angaben stehen in [eckigen Klammern]. Die in KAPITÄLCHEN gesetzten TITEL fogen der Schreibweise der Ankündigung, die Schreibweise der Gattungbezeichnungen wurden behutsam den heutigen Usancen angeglichen. Die Datierungen der Enstehung möglichst aller aufgeführten Werke sollen über die jeweilige Aktualität die des Spielplans informieren. Diese Daten folgen nach Möglichkeit dem Jahr der Uraufführung, ansonsten jenem der ersten Drucklegung – entweder als Bühnenmanuskript oder als öffentliche Buchausgabe. Die eingerückten Datensätze und rot markierten bezeichnen Gastspiele ohne Mitwirkung des Gärtnerplatztheater-Ensembles; nicht eingerückte Datensätze bezeichnen -

Sprachen Des Volksstücks“ Skizze Einer Entwicklung Der Sprache Zum ‚Spiegel Der Wirklichkeit’ Bei Ludwig Anzengruber
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit: „Sprachen des Volksstücks“ Skizze einer Entwicklung der Sprache zum ‚Spiegel der Wirklichkeit’ bei Ludwig Anzengruber Verfasserin Stefanie Hackl angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 332 Studienrichtung lt. Studienblatt: Diplomstudium Deutsche Philologie UniStG Betreuer: Ass.-Prof. Mag. Dr. Werner Michler 0 Einleitung............................................................................................................ 1 1 Aspekte der Sprache .......................................................................................... 4 1.1 Korrespondenzen........................................................................................... 4 1.2 Zur Sprachsoziologie des Volksstücks........................................................ 12 1.2.1 Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen?........................................... 12 1.2.2 Die Macht des Non-Verbalen ........................................................ 15 1.2.3 Zum Schweigen gebracht............................................................... 19 1.3 Dramaturgie zwischen Realismus und Naturalismus.................................. 22 1.3.1 Volksstücktheorien 1850 – 1890 - Kritische Stimmen.................. 22 1.3.2 Die Frage nach der Darstellung des Natürlichen ........................... 28 1.3.3 Aus dem Volk für das Volk ........................................................... 29 1.3.4 Gattungsdefinition......................................................................... -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Das Kind im Drama – Kinderrollen im deutschen Schauspiel des 18. und 19. Jahrhunderts“ Verfasserin Melanie Deutsch angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil) Wien, 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 317 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theater -, Film- und Medienwissenschaft Betreuerin / Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Hilde Haider Danksagung Ich danke meiner Betreuerin Prof. Hilde Haider, die mich an dieses Thema herangeführt und mich stets mit wertvollen Ratschlägen unterstützt hat. Darüber hinaus danke ich meinem Vater Wolfgang Deutsch, meiner Mutter Wilma Deutsch und ihrem Lebensgefährten Franz Rieger, die mir soviel Liebe und Geduld schenken. Zum Abschluss möchte ich meinem Freund Stefan Kohlhauser danken, der mich in schwierigen Phasen ertragen und mir immer Mut zugesprochen hat. Für meine Mutter Inhaltsverzeichnis Einleitung 1 1. Kindheit und Kindheitsgeschichte 2 1.1. Was ist Kindheit? 2 1.2. Forschungsgeschichte der Geschichte der Kindheit 5 1.3. Kindheit bei Jean Jaques Rousseau 11 1.4. Kindheit und Familie 15 1.5. Kindheit und Arbeit 19 2. Drama um das Theater – Theater um das Drama 24 2.1. Entwicklung des deutschen Dramas im 18. Jahrhundert 24 2.2. Das bürgerliche Trauerspiel 31 2.3. Das bürgerliche Rührstück 35 2.4. Kindheit und Leben für das Theater – Karoline Schulze- Kummerfeld und Auguste Koberwein 38 3. Das Kind im Drama 44 3.1. Die Kinderrolle – ein Definitionsversuch 44 3.2. Das bürgerliche Trauerspiel 46 Gotthold Ephraim Lessing: Miß Sara Sampson 46 Resümee 48 3.3. Rührstück und Familiengemälde 50 Friedrich Ludwig Schröder: Der Vetter in Lissabon 50 August von Kotzebue: Menschenhaß und Reue 52 August Wilhelm Iffland: Die Hagestolzen 55 August Wilhelm Iffland: Das Erbtheil des Vaters 57 Karl Gutzkow: Werner 59 Charlotte Birch-Pfeiffer: Nacht und Morgen 61 Charlotte Birch-Pfeiffer: Die Waise aus Lowood 64 Resümee 68 3.4. -

Diplomarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit „Musik im Theater - Theatermusik“ Verfasserin Ines Rosa Maierbrugger angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuerin: Univ. Prof. Dr. Margareta Saary „Das österreichische Theater, eine Wiener Bühne ohne Musik - das hätten sich die alten Wiener nicht träumen lassen!“ (Österreichisch–ungarische Musiker-Zeitung, 1907) Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS VORWORT DER AUTORIN...................................................................................I 1 EINLEITUNG: FORSCHUNGSFRAGEN UND QUELLENLAGE..................1 2 HISTORISCHE UND POLITISCHE HINTERGRÜNDE IM 19. JAHR- HUNDERT UND IHRE EINFLÜSSE AUF DAS MUSIK- UND THEATERLEBEN IN WIEN ................................................................................................................5 2.1 Entscheidende Veränderungen im Wiener Volkstheater ab der Mitte des 19. Jahrhunderts ................................................................................................................................ 14 3 DIE THEATERLANDSCHAFT IN WIEN AB 1850.......................................19 3.1 Die Bühnen Wiens............................................................................................................... 19 3.1.1 Die Wiener Hofbühnen ................................................................................................ -
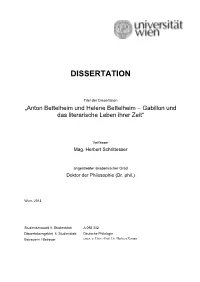
Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Anton Bettelheim und Helene Bettelheim – Gabillon und das literarische Leben ihrer Zeit“ Verfasser Mag. Herbert Schrittesser angestrebter akademischer Grad Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2013 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 092 332 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Deutsche Philologie Betreuerin / Betreuer: emer. o. Univ.-Prof. Dr. Herbert Zeman INHALT Seite Danksagung ………………………………………………………………………………….. 4 I. Einleitung 1) Allgemeines …………………………………………………………………………. 5 2) Das jüdische Bürgertum im Zeitalter Franz Josef I ………………………………… 11 a) Der emanzipierte jüdische Bürger zwischen deutschem Bürgertum, Literatur und Theater ………………………………………………………………………….. 24 b) Deutsche Bildung und christliche (jüdische) Ethik ……………………………. 36 II. Anton Bettelheim und Helene Gabillon – Biographischer Hintergrund 1) Anton Bettelheim: Herkunft und Ausbildung ……………………………………... 44 a) Die Schulzeit am Akademischen Gymnasium 1861 – 1869 ……………………. 47 b) Die Studienjahre 1869 – 1875 …………………………………………………... 49 i) Der „Leseverein der deutschen Studenten Wien’s“ ………………………… 51 ii) Die Eröffnung der Kaiser-Wilhelms-Universität in Strassburg …………….. 54 b) Die Zeit nach dem Studium – Der Weg zur biographischen Forschung ……...... 59 2) Helene Gabillon: Tochter der „Gabillons“ …………………………………………. 66 a) Ludwig Gabillon (1828 – 1896) ………………………………………………… 66 b) Zerline Gabillon (1835 – 1892) ………………………………………………….69 c) Helene Bettelheim –Gabillon; Kinder- und Jugendjahre ……………………….. 72 i) Der Hauslehrer Anton E. Schönbach (1848-1911) -

Le Théâtre De Ludwig Anzengruber: Entre Volksstück `` Éducatif '' Et Naturalisme?
Le théâtre de Ludwig Anzengruber : entre Volksstück “ éducatif ” et naturalisme ? Marc Lacheny To cite this version: Marc Lacheny. Le théâtre de Ludwig Anzengruber : entre Volksstück “ éducatif ” et naturalisme ?. Le texte et l’idée, Centre de recherches germaniques de l’Université de Nancy II, 2018, 32, pp.141-168. hal-02306216v2 HAL Id: hal-02306216 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02306216v2 Submitted on 17 Oct 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Le théâtre de Ludwig Anzengruber : entre Volksstück « éducatif » et naturalisme ? Marc Lacheny (Université de Lorraine – site de Metz) Lustige Leute lachen machen, ist kein Verdienst; aber die Falten ernster Stirnen glätten, halte ich für eines. (Ludwig Anzengruber, Aphorismen und Schlagsätze aus dem Nachlaβ, 1897) À l’occasion d’une mise en scène berlinoise de Die Kreuzelschreiber (1872), Alfred Döblin écrivait en 1924, au sujet de la réception de Ludwig Anzengruber (1839-1889) après la Première Guerre mondiale : Anzengruber ist im letzten Jahrzehnt wieder zurückgewichen. Die Bühnen bringen ihn ab und zu, aber mehr die peripheren Bühnen, die Vorstädte und Provinzen. Er hatte seine groβe Zeit vor etwa fünfzehn und zwanzig Jahren. -

Die Kreuzelschreiber by Ludwig Anzengruber
Read Ebook {PDF EPUB} Die Kreuzelschreiber by Ludwig Anzengruber Buy Die Kreuzelschreiber: Bauernkomödie mit Gesang in drei Akten (German Edition): Read Kindle Store Reviews - Amazon.com Amazon.com: Die Kreuzelschreiber: Bauernkomödie mit Gesang in drei Akten (German Edition) eBook: Ludwig Anzengruber: Kindle Store Feb 05, 2013 · Die Kreuzelschreiber: Bauernkomödie mit Gesang in drei Akten (German Edition) (German) Paperback – February 5, 2013 by Ludwig Anzengruber (Author)Author: Ludwig AnzengruberFormat: PaperbackVideos of DIE Kreuzelschreiber By Ludwig Anzengruber bing.com/videosWatch video7:22Anzengruber TEIL 1372 viewsOct 9, 2012YouTubeArno BöhlerWatch video3:00Ludwig Anzengrubers Der Meineidbauer - Jetzt auf DVD! - mit Carl Wery, Hei…8K viewsJun 12, 2013YouTubeFilm- und FernsehjuwelenWatch video on YouTube3:18Die Gruppe Kreuz und Quer Teil 186.1K viewsNov 4, 2008YouTubeVani ZalokarWatch video on YouTube3:12Rainer Hernek & DIE LUDWIG THOMA Musikanten - Der Buntspe…618 viewsJan 4, 2018YouTubeLudwig ThomaWatch video3:39Gebrüder Blattschuß - Kreuzberger Nächte13K viewsApr 21, 2016YouTubeSchlagermusikgirl47See more videos of DIE Kreuzelschreiber By Ludwig AnzengruberDie Kreuzelschreiber – Wikipediahttps://de.wikipedia.org/wiki/Die_KreuzelschreiberTranslate this pageÜbersichtHandlungAnmerkungenVerfilmungWeblinksDie Kreuzelschreiber ist eine Bauernkomödie mit Gesang in drei Akten von Ludwig Anzengruber. Die Musik dazu komponierte Adolf Müller senior. Das Stück wurde am 12. Oktober 1872 am Theater an der Wien in Wien uraufgeführt. Die Kreuzelschreiber. Ludwig Anzengruber. Books on Demand, Mar 12, 2015 - Fiction - 61 pages. 0 Reviews. Uraufführung am 12.10.1872 im Theater an der Wien. Bauernkomödie mit Gesang in drei Akten. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Sep 09, 2015 · Amazon.in - Buy Die Kreuzelschreiber book online at best prices in India on Amazon.in.