9783849816339.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ypsilanti – Vampiros Rondam O Dia Do Trabalho1 Ypsilanti Vampire May Day
YPSILANTI – VAMPIROS RONDAM O DIA DO TRABALHO1 YPSILANTI VAMPIRE MAY DAY Peter Linebaugh2 Dedicado aos estudantes, novos e antigos, do Sudeste de Michigan e Noroeste de Ohio Tradução: Denise De Sordi (UFU) Douglas Gonsalves Fávero (UFU) Revisão Técnica: Rinaldo José Varussa (UNIOESTE) Sérgio Paulo Morais (UFU) Drácula No Dia do Trabalho, em 1890, um homem inglês comum embarcou em um trem em Munique. Seu destino era um castelo na Transilvânia, um país espremido entre as Províncias da Moldávia e Valáquia. Era uma noite escura e tempestuosa quando ele chegou. “Você não sabe que hoje à noite, quando o relógio bater meia noite, todas as coisas diabólicas do mundo terão controle de tudo?” perguntou a proprietária de um hotel nas redondezas, implorando para que ele retornasse. Então, outras pessoas comuns o avisaram que era o sabá das feiticeiras. Despreocupado, ele seguiu ao castelo onde o terror mais puro o aguardava personificado em um monstro vampiresco. Conde Drácula, era esguio, educado e persuasivo – como o Presidente Obama. Era assustador, mutante e diabólico como George W. Bush. Era um morto-vivo – um zumbi ou um lobisomem – e viveria tanto quanto pudesse desfrutar de sangue humano. Quanto à crise de nossas próprias vidas, em 2009, Matt Taibbi culpou os bancos, declarando que a Goldman Sachs era “um grande vampiro com tentáculos que envolviam a 1 Publicado originalmente em <https://www.counterpunch.org/2012/04/27/ypsilanti-vampire-may-day/> . 27 abr. 2012. Nota do Editor: a padronização do artigo segue o original. 2 Professor de História na Universidade de Toledo, Ohio (EUA). Tempos Históricos • Volume 22 • 2º Semestre de 2018 • p. -
The National Herald a Weekly Greek-American Publication 1915-2016 VOL
Greek Independence Day Parade In New York This Sunday! Let's All Attend! S o C V st ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ W ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ E 101 ΑΠΟ ΤΟ 1915 anniversa ry N The National Herald www.thenationalherald.com A weekly Greek-AmericAn PuBlicATion 1915-2016 VOL. 20, ISSUE 1015 March 25-31, 2017 c v $1.50 Greek Architect Wants Dr. Yancopoulos, Grand Marshal, Talks to TNH to Change Skyline of Regeneron’s founding scientist to Manhattan lead the NY parade TNH Staff deposited daily by their inhabi - TNH Staff tants,” Oiio founder Oikonomou NEW YORK – In response to the told Time Out New York. NEW YORK – Dr. George Yan - swathe of supertall luxury resi - “Architects are now free from copoulos, President and Chief dential towers rising in New the old constraints and are scientific officer of the pharma - York, local studio Oiio owned ready to wrestle with a city fab - ceutical company Regeneron, is by Ioannis Oikonomou has pro - ric covered by layers on top of the Grand Marshal for the Greek posed a conceptual skyscraper layers, made of meaning and Independence Parade on March that loops over to boast length memory.” 26 in New York. One of the lead - rather than height. THE BIG BEND ing scientists and the head of The Big Bend would be There is an undeniable ob - one of the largest pharmaceuti - formed from a very thin struc - session that resides in Manhat - cal companies listed on the New ture that curves at the top and tan. It is undeniable because it York Stock Exchange, Dr. -

TANZIMAT in the PROVINCE: NATIONALIST SEDITION (FESAT), BANDITRY (EŞKİYA) and LOCAL COUNCILS in the OTTOMAN SOUTHERN BALKANS (1840S to 1860S)
TANZIMAT IN THE PROVINCE: NATIONALIST SEDITION (FESAT), BANDITRY (EŞKİYA) AND LOCAL COUNCILS IN THE OTTOMAN SOUTHERN BALKANS (1840s TO 1860s) Dissertation zur Erlangung der Würde einer Doktorin der Philosophie vorgelegt der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel von ANNA VAKALIS aus Thessaloniki, Griechenland Basel, 2019 Buchbinderei Bommer GmbH, Basel Originaldokument gespeichert auf dem Dokumentenserver der Universität Basel edoc.unibas.ch ANNA VAKALIS, ‘TANZIMAT IN THE PROVINCE: NATIONALIST SEDITION (FESAT), BANDITRY (EŞKİYA) AND LOCAL COUNCILS IN THE OTTOMAN SOUTHERN BALKANS (1840s TO 1860s)’ Genehmigt von der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel, auf Antrag von Prof. Dr. Maurus Reinkowski und Assoc. Prof. Dr. Yonca Köksal (Koç University, Istanbul). Basel, den 05/05/2017 Der Dekan Prof. Dr. Thomas Grob 2 ANNA VAKALIS, ‘TANZIMAT IN THE PROVINCE: NATIONALIST SEDITION (FESAT), BANDITRY (EŞKİYA) AND LOCAL COUNCILS IN THE OTTOMAN SOUTHERN BALKANS (1840s TO 1860s)’ TABLE OF CONTENTS ABSTRACT……………………………………………………………..…….…….….7 ACKNOWLEDGEMENTS………………………………………...………..………8-9 NOTES ON PLACES……………………………………………………….……..….10 INTRODUCTION -Rethinking the Tanzimat........................................................................................................11-19 -Ottoman Province(s) in the Balkans………………………………..…….………...19-25 -Agency in Ottoman Society................…..............................................................................25-35 CHAPTER 1: THE STATE SETTING THE STAGE: Local Councils -

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/191455 Please be advised that this information was generated on 2018-06-17 and may be subject to change. THE TRANSFORMATION OF THE HUMANITIES Ideals and Practices of Scholarship between Enlightenment and Romanticism, 1750 – 1850 Floris Solleveld The Transformation of the Humanities The Transformation of the Humanities Ideals and Practices of Scholarship between Enlightenment and Romanticism, 1750-1850 Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op maandag 9 april 2018 om 16:30 precies door Floris Otto Solleveld geboren op 9 juli 1982 te Amsterdam Promotoren: Prof. dr. Peter Rietbergen Prof. dr. Rens Bod (Universiteit van Amsterdam) Manuscriptcommissie: Prof. dr. Alicia Montoya Prof. dr. Christoph Lüthy Prof. dr. Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam) Prof. dr. Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht) Dr. Kasper Risbjerg Eskildsen (Roskilde Universitet, Denemarken) Contents 1. Introduction: The Transformation of the Humanities 9 What were the Humanities? 14 What was a Scholar? 24 A Map of the Learned World 31 A Scientific Revolution? 34 Enlightenment, Romanticism, and Conceptual Change 39 An Integrated Approach 47 Styles of Reasoning 48 Forms of Presentation 54 Ways of Criticism 64 Types of Intertextuality 69 2. A Science of Letters? Forms of ‘Normal Science’ in the 18th-century Humanities 79 The Ideal of Grand History and the Practice of Compilation 84 Antiquarianism and the Compendium 92 Rethinking Universal History 103 General Grammar and the ‘Science of Language’ 114 Strange Hybrids and the ‘Origin of Language’ Debate 124 The End of ‘Letters’? 136 3. -

200Th Anniversary of the Greek War of Independence 1821-2021 18 1821-2021
Special Edition: 200th Anniversary of the Greek War of Independence 1821-2021 18 1821-2021 A publication of the Dean C. and Zoë S. Pappas Interdisciplinary March 2021 VOLUME 1 ISSUE NO. 3 Center for Hellenic Studies and the Friends of Hellenic Studies From the Director Dear Friends, On March 25, 1821, in the city of Kalamata in the southern Peloponnesos, the chieftains from the region of Mani convened the Messinian Senate of Kalamata to issue a revolutionary proclamation for “Liberty.” The commander Petrobey Mavromichalis then wrote the following appeal to the Americans: “Citizens of the United States of America!…Having formed the resolution to live or die for freedom, we are drawn toward you by a just sympathy; since it is in your land that Liberty has fixed her abode, and by you that she is prized as by our fathers.” He added, “It is for you, citizens of America, to crown this glory, in aiding us to purge Greece from the barbarians, who for four hundred years have polluted the soil.” The Greek revolutionaries understood themselves as part of a universal struggle for freedom. It is this universal struggle for freedom that the Pappas Center for Hellenic Studies and Stockton University raises up and celebrates on the occasion of the 200th anniversary of the beginning of the Greek Revolution in 1821. The Pappas Center IN THIS ISSUE for Hellenic Studies and the Friends of Hellenic Studies have prepared this Special Edition of the Hellenic Voice for you to enjoy. In this Special Edition, we feature the Pappas Center exhibition, The Greek Pg. -

“The Semiotics of the Imagery of the Greek War of Independence. from Delacroix to the Frieze in Otto’S Palace, the Current Hellenic Parliament”
American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS)R) 2020 American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS) E-ISSN: 2378-702X Volume-03, Issue-01, pp 36-41 January-2020 www.arjhss.com Research Paper Open Access “The Semiotics of the Imagery of the Greek War of Independence. From Delacroix to the Frieze in Otto’s Palace, The Current Hellenic Parliament”. Markella-Elpida Tsichla University of Patras *Corresponding Author: Markella-Elpida Tsichla ABSTRACT:- The iconography of the Greek War of Independence is quite broad and it includes both real and imaginary themes. Artists who were inspired by this particular and extremely important historical event originated from a variety of countries, some were already well-known, such as Eugène Delacroix, others were executing official commissions from kings of Western countries, and most of them were driven by the spirit of romanticism. This paper shall not so much focus on matters of art criticism, but rather explore the manner in which facts have been represented in specific works of art, referring to political, religious and cultural issues, which are still relevant to this day. In particular, I shall comment on The Massacre at Chios by Eugène Delacroix, painted in 1824, the 39 Scenes from the Greek War of Independence by Peter von Hess, painted in 1835 and commissioned by King Ludwig I of Bavaria, and the frieze in the Trophy Room (currently Eleftherios Venizelos Hall) in Otto’s palace in Athens, currently housing the Hellenic Parliament, themed around the Greek War of Independence and the subsequent events. This great work was designed by German sculptor Ludwig Michael Schantahaler in 1840 and “transferred” to the walls of the hall by a group of Greek and German artists. -

Letter from the Director
UCLA SNF CENTER FOR THE STUDY OF HELLENIC CULTURE # 3 | FALL 2021 OLYMPIOS FELLOWSHIP BRINGING A HERO TO LIFE ORDER OF THE PHOENIX 3 10-14 16 Conference Room, UCLA SNF Center for the Study of Hellenic Culture Letter from the Director September 1, marking both the Byzantine and ecclesiastical New Year, seems like an appropriate moment to think backwards and forwards—to give gratitude that we have survived a challenging time and to look forward with great anticipation to the gifts before us. Throughout 2020-2021, we have had a very busy year at the UCLA SNF Hellenic Center, hosting an ambitious program of events that was both local and international, establishing strong partnerships with educational and cultural institutions in the Northern Hemisphere and Europe, and renovating a beautiful suite of offices in Rolfe Hall. We also celebrated the success of our undergraduates, three of whom were awarded scholarships by the PanHellenic Scholarship Foundation. And Sharon Gerstel, yet, it is hard not to think of what we have lost in this period—the opportunity Center Director UCLA SNF CENTER FOR THE STUDY OF HELLENIC CULTURE to gather together to listen closely to lectures, music, and performances and to savor moments of conversation over mezedes or glyka. Faculty Advisory We are celebrating important anniversaries in 2021 and 2022— the bicentennial celebration of the Greek Revolution and the one- Committee hundredth anniversary of the Asia Minor Disaster. Looking ahead, I am very excited about a number of events that commemorate these Michael Cooperson historical moments, which are critical to the understanding of modern Michael Dukakis Hellenism and underscore the resilience of the Greek people. -

Περίληψη : Member of the Society of Friends, Who Worked As a Teacher at the Greek Commercial School of Odessa
IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Συγγραφή : Ανεμοδουρά Μαρία Μετάφραση : Βελέντζας Γεώργιος Για παραπομπή : Ανεμοδουρά Μαρία , "Georgios Lassanis", Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11503> Περίληψη : Member of the Society of Friends, who worked as a teacher at the Greek Commercial School of Odessa. In 1818 he was initiated into the Society of Friends and then took part in the Revolution in the Danubian Principalities. After its unsuccessful conclusion, he followed Alexander Ypsilantis until the latter died in Vienna in 1827. He then returned to Greece and, after the foundation of the Greek state, held various military and political positions. Lassanis died in Athens in 1870. Τόπος και Χρόνος Γέννησης 1793, Kozani Τόπος και Χρόνος Θανάτου 1870, Athens Κύρια Ιδιότητα scholar, member of the Society of Friends 1. Birth – Early Years Georgios Lassanis was born in Kozani in 1793.1 At a very early age he lost his father, who was a merchant and was killed on a journey back from Vienna. He received his first education in his birthplace, where he stood out for his performance and brilliance.2 At the age of twenty he went to Budapest and worked at the shop of his compatriot Nikolaos Takiatzis, where he fell in love with his daughter and got engaged to her. To his dismay the girl’s parents married her to another young man from Kozani and Lassanis, deeply hurt by the separation, went to Leipzig to study.3 According to a different version, Lassanis left in 1813 for Leipzig, where he studied at the philosophical school of the local university for four years. -

Η Σφαγή Της Χίου, Ελαιογραφία Σε Καμβά, Αποδίδεται Στον G. Courbet (1819-1877), Αντίγραφο Έργου Του Eug
Η Σφαγή της Χίου, ελαιογραφία σε καμβά, Αποδίδεται στον G. Courbet (1819-1877), αντίγραφο έργου του Eug. Delacroix (1798-1863) The Massacre of Chios, oil on canvas, attributed to G. Courbet (1819-1877), replica from the painting of Eug. Delacroix (1798-1863) Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Χορηγός της Έκθεσης “Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη... 190 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Η συμμετοχή της Κύπρου” Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων Βυζαντινού Μουσείου Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 29 Μαρτίου - 30 Σεπτεμβρίου 2011 Επιμέλεια Έκθεσης - Καταλόγου: Δρ Ιωάννης Α. Ηλιάδης Λευκωσία 2011 Archbishop Makarios III Foundation Embassy of Greece in Cyprus Sponsor of the Exhibition “Risen from the sacred bones... 190 years from the Revolution of 1821. The contribution of Cyprus” Hall of Temporary Exhibitions of the Byzantine Museum of the Archbishop Makarios III Foundation 29 March - 30 September 2011 Curator of the Exhibition - catalogue: Dr Ioannis A. Eliades Lefkosia 2011 Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου Χαιρετισμός της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ Θερμά συγχαίρουμε το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, την Πρε- σβεία της Ελλάδος στην Κύπρο και την Τράπεζα Eurobank EIG Κύπρου για τη συνδιοργάνωση της Έκθεσης «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη... 190 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Η συμμετοχή της Κύπρου». Η Έκθεση αποτελεί συμβολική απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αθάνατους ήρωες της Εθνεγερσίας. Μέσα από τα εκθέματά της, διαγράφει, ακόμη, τη σημαντική συμβολή της νήσου μας στον αγώνα του 1821. Επιβεβαιώνει, ακόμη, η Έκθεση ότι είμαστε ένας λαός με ιστορική μνήμη και με συναίσθηση της σπουδαίας σύστασης του Πο- λύβιου: «μηδεμίαν ἑτοιμοτέραν εἶναι διόρθωσιν τοῖς ἀνθρώποις τῆς τῶν προγεγενημένων πράξεων ἐπιστήμης». -

Ancient Olympic Games
Dreamreader.net Sports – Higher Intermediate Level Ancient Olympic Games In ancient history, the Olympic Games were a series of competitions between different cities in Greece. There were athletic games as well as combat and chariot racing. According to legend, the Olympic Games were created by Zeus and his son, Heracles, both of whom were Greek gods. Heracles declared the Olympic Games would be held every four years and built a stadium to honor his father. At the earliest recorded Olympics in 776 B.C., racing was the only event. However, later Olympic Games held gradually longer races such as the marathon. In the year 393 A.D., Roman emperor Theodosius banned the Olympic Games. He was a Christian who believed that the games were a form of worshipping of a false religion. For almost 1500 years, the Olympics ceased to exist as an event. In the late 19th century, two things sparked the restoration of the Olympic Games. Writers and artists at the time were rebelling against scientific progress and politics of the 1800s. Many of them believed that humanity and nature were under threat as society became increasingly dominated by rules and rational scientific thought. To fight against these changes, these artists used their words and paintings to celebrate the beauty of nature and human emotion. Many of them were inspired by the similar themes found in ancient Greek art, such as operas and poetry. They identified heavily with the spirit of the ancient Games, which celebrated the human spirit through struggle and competition. The independence of Greece in the 1830s also helped to bring back the Olympics. -
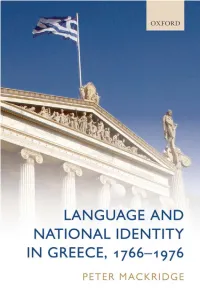
93323765-Mack-Ridge-Language-And
Language and National Identity in Greece 1766–1976 This page intentionally left blank Language and National Identity in Greece 1766–1976 PETER MACKRIDGE 1 3 Great Clarendon Street, Oxford ox2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © Peter Mackridge 2009 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2009 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mackridge, Peter. -

Die Entwicklung Griechenlands Und Die Deutsch-Griechischen Beziehungen Im 19
Südosteuropa - Studien ∙ Band 46 (eBook - Digi20-Retro) Bernhard Hänsel (Hrsg.) Die Entwicklung Griechenlands und die deutsch-griechischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert Verlag Otto Sagner München ∙ Berlin ∙ Washington D.C. Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch den Verlag Otto Sagner: http://verlag.kubon-sagner.de © bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig. «Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH. Bernhard Hänsel - 978-3-95479-690-8 Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:42:23AM via free access 00055622 SUDO STEUROPA-STUDIEN herausgegeben im Auftrag der Südosteuropa-Gesellschaft von Walter Althammer Bernhard Hänsel - 978-3-95479-690-8 Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:42:23AM via free access Die Entwicklung Griechenlands und die deutsch-griechischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert herausgegeben von Bernhard Hansel Südosteuropa-Gesellschaft München 1990 Bernhard Hänsel - 978-3-95479-690-8 Downloaded from PubFactory at 01/11/2019 09:42:23AM via free access Bayerische Staatsbibliothek München CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Die Entwicklung Griechenlands und die deutsch-griechischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert/ Südosteuropa-Ges. ,.München : Südosteuropa-Ges ־ .Hrsg. von Bernhard Hansel 1990 (Südosteuropa-Studien