Die Große Gauklerin
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

REFLECTIONS 148X210 UNTOPABLE.Indd 1 20.03.15 10:21 54 Refl Ections 54 Refl Ections 55 Refl Ections 55 Refl Ections
3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS MERCI CHÉRIE – MERCI, JURY! AUSGABE 2015 | ➝ Es war der 5. März 1966 beim Grand und belgischen Hitparade und Platz 14 in Prix d’Eurovision in Luxemburg als schier den Niederlanden. Im Juni 1966 erreichte Unglaubliches geschah: Die vielbeachte- das Lied – diesmal in Englisch von Vince te dritte Teilnahme von Udo Jürgens – Hill interpretiert – Platz 36 der britischen nachdem er 1964 mit „Warum nur war- Single-Charts. um?“ den sechsten Platz und 1965 mit Im Laufe der Jahre folgten unzähli- SONG CONTEST CLUBS SONG CONTEST 2015 „Sag‘ ihr, ich lass sie grüßen“ den vierten ge Coverversionen in verschiedensten Platz belegte – bescherte Österreich end- Sprachen und als Instrumentalfassungen. Wien gibt sich die Ehre lich den langersehnten Sieg. In einem Hier bestechen – allen voran die aktuelle Teilnehmerfeld von 18 Ländern startete Interpretation der grandiosen Helene Fi- der Kärntner mit Nummer 9 und konnte scher – die Versionen von Adoro, Gunnar ÖSTERREICHISCHEN schließlich 31 Jurypunkte auf sich verei- Wiklund, Ricky King und vom Orchester AUSSERDEM nen. Ein klarer Sieg vor Schweden und Paul Mauriat. Teilnehmer des Song Contest 2015 – Rückblick Grand Prix 1967 in Wien Norwegen, die sich am Podest wiederfan- Hier sieht man das aus Brasilien stam- – Vorentscheidung in Österreich – Das Jahr der Wurst – Österreich und den. mende Plattencover von „Merci Cherie“, DAS MAGAZIN DES der ESC – u.v.m. Die Single erreichte Platz 2 der heimi- das zu den absoluten Raritäten jeder Plat- schen Single-Charts, Platz 2 der deutschen tensammlung zählt. DIE LETZTE SEITE ections | Refl AUSGABE 2015 2 Refl ections 2 Refl ections 3 Refl ections 3 Refl ections INHALT VORWORT PRÄSIDENT 4 DAS JAHR DER WURST 18 GRAND PRIX D'EUROVISION 60 HERZLICH WILLKOMMEN 80 „Building bridges“ – Ein Lied Pop, Politik, Paris. -

Radio-Köpfe Max Schautzer – Moderator Und Conférencier
Radio-Köpfe Schautzer war nun schon einmal in Deutschland und hatte in jenen Jahren schon an seinem Hochdeutsch gefeilt. Er unterzog sich beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Köln einem Sprechertest sowie einem Test seines Allgemeinwissens und stieß – nachdem er bestanden hatte und ein Jahr Sprecherübungen mit seinem Coach, Prof. Pietsch, machte – Ende 1964 zum Sprecher- ensemble des WDR. Er wurde schon bald als Conférencier bei öffentlichen Veranstaltun- gen im Sendegebiet eingesetzt, z.B. in der Mercatorhalle in Duisburg. Begleitet wurde er dabei von Künstlern sowie der WDR-Big- band und des Orchesters Kurt Edelhagen. Schautzer wurde vielseitig eingesetzt: Er war Sprecher und Reporter bei „Allein ge- gen alle“. Diese Sendung war eine Co-Pro- duktion von RIAS und NDR mit der jeweili- gen ARD-Anstalt im betreffenden Bundes- land, in Nordrhein-Westfalen mithin mit dem WDR. An der Seite von Showlegende Hans Rosenthal war Schautzer Außenrepor- ter bei „Spaß muss sein“, Moderator von Max Schautzer – Moderator und Conférencier „Daheim und unterwegs“ (Montag bis Frei- (Radio Luxemburg / WDR / ARD / ZDF) tag) und „Freie Fahrt ins Wochenend“ (Samstag), der Autofahrersendung im zwei- Max Schautzer (78) ist vielseitig: Als ge- vor: Bei Vorspielabenden seiner Schau- ten Hörfunkprogramm. Diese Sendungen bürtiger Österreicher machte er im Rhein- spielschule war er der Redner auf der Büh- und Interviews “mit Bekannten und Unbe- land Karriere als Discjockey, wurde Spre- ne, der dem geneigten Publikum die aufge- kannten" (Schautzer) waren seinerzeit seine cher beim WDR- Hörfunk. Er ging die Kar- führten Stücke erklärte und somit in die Tätigkeitsschwerpunkte. Am Samstag- riereleiter hoch, war Leiter des Studios Handlung einleitete. -

40. Jahrgang Nr. 184 April 2020 Permanenter Gedichtwettbewerb Elisabeth Jursa, Dr.-Robert-Graf-Straße 9, 8010 Graz, [email protected]
schreiben – lesen - zuhören 40. Jahrgang Nr. 184 April 2020 Permanenter Gedichtwettbewerb Elisabeth Jursa, Dr.-Robert-Graf-Straße 9, 8010 Graz, [email protected] ZVR-Nr. 466 423 105 IM INTERNET: E-Mail: [email protected] * Druck: www.druck.at * Erscheinungsweise: 4 Hefte im Jahr. DIE PRÄSIDENTIN Liebe Lyrikfreunde! Das Jahr ist ja nun ganz anders verlaufen, als wir es erwartet haben, alles musste wegen der Corona-Pandemie verändert werden. Die Verschiebung des Sterntreffens auf 2021, die Absage aller Lesungen in den einzelnen Repräsentanzen. Das Sterntreffen in Bad Mitterndorf sollte ja heuer etwas besonders sein, die Feier des 40-jährigen Jubiläums, für das Gudrun Achenbach-Planitzer ja schon alle Vorbereitungen getroffen hatte, für die ich mich erst einmal ganz herzlich bedanken möchte. Die Preisträger werden ihre Urkunden und Medaillen mit der Post bekommen, anstelle der Laudatio beim Sterntreffen stelle ich sie anschließend näher vor. Für mich bedeutet die Verschiebung des Sterntreffens auch eine Änderung. Ich wollte als Präsidentin zurücktreten, da es ja auch ein persönliches Jubiläum gewesen wäre, meine 25- jährige Tätigkeit. Und ich wollte mich doch auch persönlich verabschieden und für die Zusammenarbeit bedanken. Nach langen Überlegungen habe ich mich doch entschlossen, noch bis nächstes Jahr als “Übergangsjahr“ zu bleiben. 2021 findet ja auch die Neuwahl des Vorstandes statt, so geht alles dann in einem. Nun zu den Preisträgern: Die Leserpreisgewinnerin Ilse Pauls stelle ich anschließend in einem eigenen Bericht vor. Den 2. Platz erhält Werner Somplatzki für sein Gedicht “Sommerlicht“. Werner Somplatzki war bereits Leserpreisgewinner 2012 mit dem Gedicht „Freunde“. Aber er hat schon zwei weitere zweite Preise gewonnen: 2006 (Ein 1 Jahr), 2oo9 (Mein Leben). -

# 183 Dossiers # 1972 Fichiers # Update 27 Avr. 2019
############################################# # 183 dossiers # 1972 fichiers # update 27 avr. 2019 ############################################# [1958 EP & singles Greece] 01 Hartino To Fengaraki (The Paper Moon) (Nana Mouskouri) 02 Mazi Me Sena (Together) (Nana Mouskouri) 03 Ilissos (Nana Mouskouri) 04 Ela Pare Mou Ti Lipi (Take My Sorrow Away) (Nana Mouskouri) 05 I mana mou me dernei (Nana Mouskouri) 06 Annista mou Annoula mou (Nana Mouskouri) 07 Pame Mia Volta Sto Fengari (Walking On The Moon) (Nana Mouskouri) 08 Kanella Kaneloritsa (Kato sto Yialo) (Nana Mouskouri) 09 Eri Erini (Nana Mouskouri) 10 Tha rtho mia vradia (Fascination) (Nana Mouskouri) 11 Fascination (Nana Mouskouri) [1959 EP & singles Greece] 01 Kapou Iparhi I Agapi Mou (Somewhere Is My Love) (Nana Mouskouri) 02 O Imittos (Mount Himittos) (Nana Mouskouri) 03 Xero Kapio Asteri (The Little Star) (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 04 Mia Sinnefia (Cloudy Sky) (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 05 O Kalos Kalo den echi (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 06 San Paramithi San Istoria (Like A Tale) (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 07 I Vrochoula (The Rain) (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 08 La-la-la (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 09 Ena chamogelo agapo (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 10 Eiha Pistepsei S'Oneira (I Had Believed In Dreams) (Nana Mouskouri & Trio Kantzone) 11 Ti Krima (What A Pity) (Nana Mouskouri , E.I.P. Orchestra) 12 O Erotas Pou M'Akouse (Love That Heard Me) (Nana Mouskouri , E.I.P. Orchestra) 13 Perase, Helie (Pass By, O Sun) (Nana Mouskouri , E.I.P. Orchestra) -

Allemagne 13
25e Eurovisie Songfestival 1980 Finale - Le samedi 19 avril 1980 à La Haye - Présenté par : Marlous Fluitsma Du bist musik (Tu es musique) 1 - Autriche par Blue Danube 64 points / 8e Auteur/Compositeur : Klaus-Peter Sattler Petr'oil 2 - Turquie par Ajda Pekkan 23 points / 15e Auteur : Şanar Yurdatapan / Compositeur : Atilla Özdemiroglu Ωτοστοπ - Autostop - (Auto-stop) 3 - Grèce par Anna Vissy & Epikouri 30 points / 13e Auteur : Rony Sofou / Compositeur : Jick Nakassian Le papa pingouin 4 - Luxembourg par Sophie & Magali 56 points / 9e Auteurs : Pierre Delanoë, Jean-Paul Cara / Compositeurs : Ralph Siegel, Bernd Meinunger (Bitakat hob - (Message d'amour - ﺐﺣ ﺔﻗﺎﻂﺑ 5 - Maroc par Samira Bensaïd 7 points / 18e Auteur : Malou Rouane / Compositeur : Abdel Ati Amenna Non so che darei (Que ne donnerais-je pas) 6 - Italie par Alan Sorrenti 87 points / 6e Auteur/Compositeur : Alan Sorrenti Tænker altid på dig (Je penserais toujours à toi) 7 - Danemark par Bamses Venner 25 points / 14e Auteur : Flemming Bamse Jørgensen / Compositeur : Bjarne Gren Jensen Just nu (C'est maintenant) 8 - Suède par Tomas Ledin 47 points / 10e Auteur/Compositeur : Tomas Ledin Cinéma 9 - Suisse par Paola 104 points / 4e Auteurs : Peter Reber, Véronique Müller / Compositeur : Peter Reber Huilumies (Le flûtiste) 10 - Finlande par Vesa Matti Loiri 6 points / 19e Auteur : Vexi Salmi / Compositeur : Aarno Raninen Samiid ædnan (Terre lappone) 11 - Norvège par Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta 15 points / 16e Auteur : Ragnar Olsen / Compositeur : Sverre Kjelsberg Theater (Théatre) -
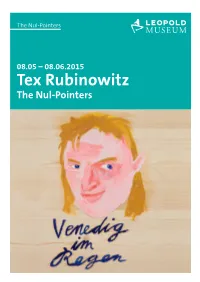
The Nul-Pointers Biographies
The Nul-Pointers 08.05 – 08.06.2015 Tex Rubinowitz The Nul-Pointers FUD LECLERC (1924–2012) DE SPELBREKERS representing Belgium with »Ton Nom« in Luxembourg, 1962 representing the Netherlands with »Katinka« in Luxembourg, 1962 Fud Leclerc was once the pianist of the famous chanteuse The Dutch duo Theo Rekkers (1923–2012) and Huug Kok (1918– Juliette Greco and competed in the contest four times. His last 2011) met during World War II in a forced labour camp in Germa- appearance in 1962 saw him go out with the dubious honour ny. After the War they started their singing career that brought of having become the first »nul-pointer« ever (the entries from them to the Eurovision in 1962. Unfortunately this was the first Spain, the Netherlands and Austria would follow him the very year in which the term »nul pointer« appeared. Nevertheless, same evening). After travelling around the world he returned to »Katinka« proved a success within the Netherlands. After years Belgium and began a new career as a building contractor. of releasing further singles to declining interest, they decided in the mid-1970s to move into music management. VICTOR BALAGUER (1921–1984) representing Spain with »Llámame« in Luxembourg, 1962 ANNIE PALMEN (1926–2000) The namesake of a 19th century Catalan folk hero, Victor was representing the Netherlands with »Een speeldos« in London, 1963 known as an adaptable singer who moved between popular mu- Annie was already a successful singer when she presented her sic and zarzuela, singing in Spanish as well as Catalan. Follow- song »Een Speeldos« in London, one of four songs which failed ing his Eurovision appearance, Balaguer returned to performing to score that year. -

Venedig Im Regen. Über Politisches Engagement Und Magie in Der Kunst
Page 1 of 13 03/22/16 - Venedig im Regen. Über politisches Engagement und Magie in der Kunst. Danh Vo, "Mother Tongue" im Dänischen Pavillon (Foto: WgK) Venedig im Regen. Über politisches Engagement und Magie in der Kunst. von Conny Habbel. Zuerst erschienen in: Kursbuch 184. Hamburg: Murmann 2015. In einer eisigen Herbstnacht steige ich in den Euro Night der Österreichischen Bundesbahn von Wien nach Venedig. Mein Schlafabteil begrüßt mich mit einer in die Jahre gekommenen Reproduktion von Klimt's "Kuss", unter kaltem Neonlicht, im Format Din A4 (das Original ist eigentlich quadratisch). Das Bild wurde hinter getrübtem Plexiglas in die grauen Plastikwände meiner Kapsel versenkt. Was hier hängt verweist nur im Entferntesten auf Klimts auratisches Jugendstilgemälde: schillernd, virtuos, visuell mächtig, kleinteilige, golden schimmernde Flächen, zwei Figuren, in inniger Umarmung, die zarte Blässe der Gesichter gerahmt von den floralen Ornamenten ihrer Kleider. Auch dort, wo ich hinfahre, wird es Kunst zu sehen geben, ob schillernd, verstaubt, konzeptionell oder ganz anders. Die Biennale von Venedig, eines der weltweit wichtigsten Kunstereignisse, fällt diesmal in eine Zeit, in der ich an meinen behüteten Wohnorten, Wien und München, mit der Flüchtlingskrise eine weltpolitische Notlage deutlicher mitbekomme als je zuvor. Im österreichischen Erstaufnahmelager Traiskirchen, sozusagen vor meiner Haustür, müssen fiebernde Kinder bei niedrigen Temperaturen im Regen schlafen. Auf einer Autobahn im Burgenland werden 71 Leichen aus einem luftdicht verschlossenen Kühlwagen geborgen. Auf Facebook ist ein Video zu sehen, das Menschen zeigt, wie sie, teilweise schreiend vor Schmerz, durch einen halbgefrorenen Fluss an der slowenischen Grenze waten. Tag für Tag die Untätigkeit der europäischen Politik, Tag für Tag neue schreckliche Nachrichten. -

Various International Grand Prix 1991 Mp3, Flac, Wma
Various International Grand Prix 1991 mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Pop / Folk, World, & Country Album: International Grand Prix 1991 Country: Denmark Released: 1991 Style: Europop MP3 version RAR size: 1317 mb FLAC version RAR size: 1482 mb WMA version RAR size: 1391 mb Rating: 4.1 Votes: 623 Other Formats: VOX MPC APE WAV MMF MP4 MP3 Tracklist Hide Credits Control/Brazil A1 –Baby Doll* Written-By – Baby Doll*, Zoran Vracevic* Nina A2 –Stefan & Eyfi Written-By – Eyjolfur Kristjansson –Paul Giordimaina & Could It Be? A3 Georgina* Written-By – Paul Abela, Raymond Mahoney Spring A4 –Sofia Vossou* Written-By – Andreas Mikroutsikos* Canzone Per Te A5 –Sandra Simó Written-By – Renato Mascetti Venedig Im Regen A6 –Thomas Forstner Written-By – Hubert Moser, Robby Musenbichler*, Wolfgang Eltner Un Baiser Vole A7 –Sarah Bray Written-By – Linda Lecomte, Mick Wersant, Patrick Hippert Fångad Av En Stormvind A8 –Carola Written-By – Stephan Berg Le Dernier Qui A Parle A9 –Anisa Written-By – Amina Annadi*, W. Diop* Iki Dakika A10 –Izel, Reyhan & Can* Written-By – Aysel Gürel, Sevket Ugurluel Could It Be That I'm In Love A11 –Kim Jackson Written-By – Liam Reilly Lusitana Paixao B1 –Dulce* Written-By – Fredo Micaelo*, Jorge Quintela, Ze da Ponte* Lige Der Hvor Hjertet Slår B2 –Anders Frandsen Written-By – Michael Elo Mrs. Thompson B3 –Four You Written-By – D. Kolsrud*, K. Skevik Jr.*, P. G. Rollnes* Come Along B4 –Duo Datz Written-By – Shimrit Or*, Uzi Hitman One More Lonely Night B5 –Kaija* Written-By – Ile Kallio, Jukka Hakoköngäs, Jukka Välimaa, Kaija Kärkinen Dieser Traum Darf Niemals Sterben B6 –Atlantis 2000 Written-By – A. -

1980 Tracks : 10 Playtime : 00:33:51
Artist : Nana Mouskouri Album : Come with me Genre : Pop Year : 1980 Tracks : 10 Playtime : 00:33:51 01. Come With Me (03:03) 02. If It's So Easy (04:06) 03. Smooth Sailing (02:26) 04. Lullabye of Love (03:27) 05. When I Dream (03:41) 06. Love Ain't The Question (04:02) 07. Love is All That Matters (03:32) 08. Don't Go My Love (02:53) 09. Someone is Looking for Someone Like you (03:22) 10. If (03:14) 01. Come With Me (03:03) Performer : Nana Mouskouri Music : Chuck Howard Lyrics : Chuck Howard If you're in a valley Come with me I'll take you where With a troubled mind Come with me You never been before I'm a mountain The feeling's free Once we're there Come on and climb Just come with me You'll cry for more 'Cuz ya look so good We'll get on a cloud If its dark in your world To be so down And ride it high Come walk in mine It won't take much Say hello sun My love's a light To turn it all around As we sail by Its on all the time 1 Come with me Say hello sun Just come with me Come with me As we sail by We'll get on a cloud The feeling's free And ride it high Just come with me Come with me Say hello sun We'll get on a cloud Come with me As we sail by And ride it high The feeling's free -------------------------- 02. -

Ein Bisschen Scheitern Beim Eurovision Song Contest
Presseinformation / Zur Rezension Ein bisschen Scheitern beim Eurovision Song Contest Bielefeld, 11. April 2007 − Wir alle mögen schon mal beim Karaoke versagt haben, aber wer kann die monumentalen Demütigungen derer erfassen, die sich anschickten, Menschen in ganz Europa mit ihrer Stimme zu erfreuen, und dann keine einzige Stimme zurückbekamen? Der Brite Tim Moore, bekannt für humorvolle Reiseerzählungen wie „Zwei Esel auf dem Jakobsweg“, will es genau wissen: Er macht er sich auf die Suche nach jenen 14 Interpreten, die auf Grand-Prix-Bühnen ihr Waterloo erlebten, seit ein wundersamer Norweger namens Jahn Teigen im Mai ´78 mit nordischen Kehllauten und einer verhängnisvollen Kombination aus laszivem Hosenträgergezupfe und missglücktem Scherensprung für das erste Totalversagen beim modernen Eurovision Song Contest sorgte. In „Null Punkte“ erzählt Moore die schmerzlichen, die haarsträubenden, die Mut machenden TIM MOORE: Geschichten dieser ultimativen Verlierer des Showgeschäfts. Und er rekapituliert die unerhörte Geschichte des Eurovision Song Contests selbst – eines bizarren, NULL PUNKTE − EIN BISSCHEN überkandidelten Paralleluniversums der deplatzierten Pailletten, Pumps und SCHEITERN BEIM Plattitüden. EUROVISION SONG CONTEST Es ist das wahre Fest des vereinten Europas: Fast 500 Millionen Menschen lümmeln sich ISBN-13: 978-936973-28-0 an einem Samstagabend im Mai erwartungsfroh auf dem Sofa, um dem Eurovision Song Hardcover, 380 Seiten im Format Contest zu huldigen. Einst mag es bei diesem Grand Prix der seichten Unterhaltung darum 21 x 14,8 cm gegangen sein, „hochwertige Eigenkompositionen auf dem Gebiet der populären Musik zu Ladenpreis: fördern“ und die Rivalitäten der europäischen Nationen in einen ritualisierten künstleri- EUR 19,80 [D] EUR 20,40 [A] schen Wettstreit zu überführen. -

Andreas Gabalier
Andreas Gabalier - Engel 2012 Andreas Gabalier - Vergiss die Heimat nie Andreas Gabalier - Amoi seg' ma uns wieder 2012 Andreas Gabalier - Meine Heimat Andreas Gabalier - Ewig, ewig Andreas Gabalier - Edelweiss Andreas Gabalier - Sie Andreas Gabalier - Steirerbluat Andreas Gabalier - So liab hob i di Andreas Gabalier - Das Kleine Haus Andreas Gabalier - Obersteirer 2015 Andreas Gabalier - Dahoam Andreas Gabalier - A Meinung haben Andreas Gabalier - Das kleine Haus Andreas Gabalier mit Romina Michel - I sing a Liad für di Heino - Hohe Tannen weisen die Sterne Heino - Das Ostpreussenlied (Land der dunklen Wälder) Heino - Es steht ein Soldat am Wolgastrand (Wolgalied) Heino - Die Wacht am Rhein Heino - Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren Volkslied - Ade du mein lieb Heimatland ) Pfadfinderlied - Wenn der Abend naht D'Artagnan - Neue Helden (KutschPutsch) D'Artagnan - Seit an Seit D'Artagnan - So wie Du D´Artagnan - Komm mit Uwe Busse - Sommer 76 Nockalm Quintett - Prinz Rosenherz Nockalm Quintett - Schwarzer Sand von Santa Cruz Nockalm Quintett - Und über Rhodos küss' ich dich Heino - Hohe Tannen Heino - Wir sind durch Deutschland gefahren Mitch Keller - Zuhause (Ich bleib bei dir) KLIMA - Nicht mehr weit (BR Abendschau) KLIMA - Zum 1000ten Mal KLIMA - Unterwegs (unplugged) Julian le Play | Wir haben noch das ganze Leben | Joel Brandenstein - Diese Liebe Joel Brandenstein - Zeitmaschine Annett Müller - Eine Rose für Mein Deutschland Annet Müller - Wenn der Wind sich dreht in diesem Land Revolverheld - Ich lass für Dich das Licht an Revolverheld -
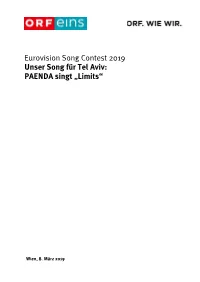
Eurovision Song Contest 2019 Unser Song Für Tel Aviv: PAENDA Singt „Limits“
Eurovision Song Contest 2019 Unser Song für Tel Aviv: PAENDA singt „Limits“ Wien, 8. März 2019 Eurovision Song Contest PAENDA singt für Österreich PAENDA vertritt Österreich im Mai 2018 beim „Eurovision Song Contest“ in Lissabon. Das ORF-Team hat wie auch schon in den Vorjahren gemeinsam mit dem Song-Contest-erfahrenen Musikexperten Eberhard Forcher in der österreichischen Musikszene gescoutet. Die Wahl fiel auf die 1988 in der Steiermark geborene Künstlerin, Songwriterin und Produzentin PAENDA. PAENDA, die Vollblutkünstlerin Mit 14 Jahren schrieb PAENDA erste eigene Songs und lernte Gitarre und Klavier, um diese musikalisch umzusetzen. Als klar wurde, dass die Musik für sie nicht bloß ein leidenschaftliches Hobby war, sondern eine Berufung, zog sie mit Anfang 20 nach Wien, um Jazz- und Populargesang zu studieren. Engagements in mehreren Musikprojekten folgten, bis sie 2015 mit ihrem Einzelprojekt PAENDA startete. Als Solokünstlerin begann sie nicht nur selbst zu komponieren und Songtexte zu verfassen, sondern auch ihre Musik selbst zu produzieren. „Das hätte ich als junges Mädchen im Schulchor in der Steiermark nicht einmal zu träumen gewagt“, so PAENDA. Die ersten Singles „Waves“ und „Good Girl“, zogen bereits einige Aufmerksamkeit auf sich, auch das Debütalbum „EVOLUTION I“, erschienen im Februar 2018 bei Wohnzimmer Records, wurde begeistert aufgenommen. PAENDAs zweites Album, folgerichtig „EVOLUTION II“ betitelt, erscheint am 26. April 2019 bei Wohnzimmer Records. PAENDA: „Im Rahmen dieser wunderbaren Veranstaltung passiert so viel Schönes: Musik wird zur universellen Sprache, Grenzen lösen sich auf und es wird gezeigt, dass Liebe bunt, vielfältig und in keine Schublade einzuordnen ist. Der Song Contest ist sozusagen ein Brückenbauer, der es schafft, eine Zeit lang verschiedene Kulturen und Religionen zu vereinen.