Auf Blinde Flecken Zeigen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Men at Arms Books
Osprey Men-at-Arms PUBLISHING German Army Elite Units 1939-45 Gordon Williamson * Illustrated by Ramiro Bujeiro CONTENTS INTRODUCTION ‘GROSSDEUTSCHLAND’ ‘FELDHERRNHALLE* GORDON WILLIAMSON was INFANTERIE-REGIMENTER 119 & 9 ‘LIST’ born in 1951 and currently works for the Scottish Land Register. He spent seven years with the Military Police PANZERGRENADIER-DIVISION TA end has published a ‘BRANDENBURG* number of books and articles on the decorations of the Third Reich and their winners. KAVALLERI E-REGIMENT 5 He is author of a number of World War II titles for Osprey. ‘FELDMARSCHALL VON MACKENSEN’ 44. REICHSGRENADIER-DIVISION ‘HOCH UND DEUTSCHMEISTER’ 116. PANZER-DIVISION {‘Windhund’) 21. PANZER-DIVISION 24. PANZER-DIVISION (130.) PANZER-LEHR-DIVISION RAMIRO BUJEIRO has illustrated many Osprey titles including Warrior 23; US 3. GEBIRGS-DIVISION Afanne in Vietnam and Men- at-Arms 357: Allied Women's 5. GEBIRGS-DIVISION Service. He is an experienced commercial artist who lives and works in his native city THE TIGER TANK BATTALIONS of Buenos Aires, Argentina. His main interests are the political and military history THE PLATES of Europe in the first half of the 20th century. INDEX first published In Great Britain In 2002 by Osprey Publishing. Artist’s Note Qms Court. Chapel Way. BotJay, Oxford 0X2 9LB United Kingdom GERMAN ARMY ELITE UNITS Email] info® osprey publishing, com Readers may care to note that the original paintings from which the colour plates in this book were prepared are available for private © 2002 Osprey Publishing Ltd. sale. All reproduction copyright whatsoever is retained by the 1939-45 Publishers, All enquiries should be addressed to: All rights reserved- Apart From any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright, Designs end Ramiro Sujeiro, GC 28, 1602 Florida, Argentina Patents Act, 1983. -

Scientific Contributions of the First Female Chemists at the University of Vienna Mirrored in Publications in Chemical Monthly 1
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly (2019) 150:961–974 https://doi.org/10.1007/s00706-019-02408-4 ORIGINAL PAPER Scientifc contributions of the frst female chemists at the University of Vienna mirrored in publications in Chemical Monthly 1902–1919 Rudolf Werner Soukup1 · Robert Rosner1 Received: 29 November 2018 / Accepted: 1 March 2019 / Published online: 29 April 2019 © The Author(s) 2019 Abstract In 1897, the frst female students were admitted at the Faculty of Philosophy at Vienna University. The frst dissertation in chemistry was approved in 1902. In the following years, only one or two women were annually enrolled, while the number of male students of chemistry continuously fuctuated around 22. Whereas four women completed their doctorate in the frst year of WWI, six followed in 1917, and ten more in 1919. Strikingly, in that year the number of female students even exceeded that of male colleagues. Margarethe Furcht, the daughter of a Jewish stockbroker, was the frst female chemist with a doctoral degree certifcate in the Austro-Hungarian Empire. Her paper “Über die Veresterung von Sulfosäuren…”, which she published in 1902 together with her academic supervisor Rudolf Wegscheider, was one of the frst scientifc chemical publications of women in Austria. However, of all female graduates, only a small number worked as chemists within the next two decades. After the occupation of Austria by German Troops in March 1938, seven of the Jewish women managed to emigrate, four were murdered in the Holocaust. Given the importance of this period within the landscape of European scientifc history, we here aim to provide the frst comprehensive overview of the history of women studying chemistry at the University of Vienna. -

Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals
Worldwide Investigation and Prosecution of Nazi War Criminals (April 1, 2009 – March 31, 2010) An Annual Status Report Dr. Efraim Zuroff Simon Wiesenthal Center – Israel Office Snider Social Action Institute November 2010 2 TABLE OF CONTENTS Executive Summary 5 Introduction 7 The Period Under Review: April 1, 2009 – March 31, 2010 9 Convictions of Nazi War Criminals Obtained During the Period Under Review 14 Convictions of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 15 New Cases of Nazi War Criminals Filed During the Period Under Review 16 New Cases of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 18 New Investigations of Nazi War Criminals Initiated During the Period Under Review 19 New Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 20 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals As of April 1, 2010 21 Ongoing Investigations of Nazi War Criminals: Comparative Statistics 2001-2010 22 Investigation and Prosecution Report Card 23 Investigation and Prosecution Report Card: Comparative Statistics 2001-2010 36 SWC Most Wanted List of Nazi War Criminals 38 About the Simon Wiesenthal Center 43 Index of Countries 47 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 1. During the period in question the investigation and prosecution of Nazi war criminals continued in fourteen countries, among them countries such as Germany, Austria and Poland in which the crimes of the Holocaust were committed and others like the United States and Canada, which afforded a postwar haven to Holocaust perpetrators. 2. During the period from April 1, 2009 until March 31, 2010, five individuals were convicted for Nazi war crimes, three (in absentia) in Italy and two in Germany. -

Kesselring and German War Crimes in Italy
Richard Raiber. Anatomy of Perjury: Field Marshal Albert Kesserling, Via Rasella, and the Ginny Mission. Edited and with a preface by Dennis E. Showalter. Newark: University of Delaware Press, 2008. 269 pp. $55.00, cloth, ISBN 978-0-87413-994-5. Reviewed by Waitman W. Beorn Published on H-German (November, 2009) Commissioned by Susan R. Boettcher Historians sometimes despair that we may from promising careers in the Heer to the Luft‐ never fnd a "new" or "groundbreaking" docu‐ waffe in autumn 1933" (p. 26). Raiber points out ment in the archives, especially in collections that Kesselring's origins in the middle class, not the have been much pawed over. With this book, the Prussian aristocracy. Having won favor over Er‐ late Richard Raiber proves that important discov‐ win Rommel, he became one of Adolf Hitler's eries still remain. A World War II veteran and re‐ trusted commanders. This characterization be‐ tired physician who embarked on a second career comes important in explaining his later behavior. as a historian, he took as his subject German Field On March 23, 1944, Italian partisans detonated a Marshal Albert Kesselring and his involvement in bomb in the Via Rasella in Rome as a German po‐ two specific atrocities that occurred while Kessel‐ lice company marched by, killing thirty-three sol‐ ring was Oberbefehlshaber Heeresgruppe Süd‐ diers. Upon notification, an incensed Hitler or‐ west in Italy: the reprisal shootings at the Ardea‐ dered reprisals carried out on the order of ten tine Caves and the execution of ffteen American civilians executed for every dead German. -

LXIX. Armeekorps Zbv (LXIX Army Corps) Hi
LXIX. Armeekorps z.b.V. (LXIX Army Corps) Hi- LXIX. Armeekorps z.b.V. (LXIX Array Corps for Special Em~ "Schach," "Schlusselblume," and "Rouen" (action against large p.1 - yment) was formed in Vienna, Wehrkreis XVII, on July 13, 1943, units of partisans and Communists in Croatia), including various e~ the LXIX. Reservekorps, and transferred to Zagreb, Croatia, on other antipartisan operations with the aid of Croatian units and A.1 just 11, 1943. The Corps was responsible for maintenance and the 1. Kosaken-Division. On January 9, 1944, the LXIX. Reserve- security of roads and railroad lines in Croatia and northern korps was redesignated Generalkommando LXIX. Armeekorps z.b.V. Serbia, training of Croatian troops, and antipartisan warfare. During March 1944 the Corps also participated in Operation D. ring September 1943, it participated in the disarming of "Lechfeld" (the occupation of Budapest and nearby airfields and Italian troops and in the occupation of the Adriatic coast. the disarming of Hungarian troops) and in Operation "Margarets" From October 1943 until August 1944, the Corps was engaged in (the occupation of Hungary). Operations "Herbst II," "Ferkel," "Wildsau," "Cannae," "Ungewitter," Item Dates Item No. Roll 1st Frame la, Kriegstagebuch 1. War journal concerning activation of the Corps in Vienna, transfer to Croatia, and antipartisan operations in the area north of the Sava River. Also, a register of officers. The Corps was subordinate to Pz.AOK 2 during this period under the command of Gen.d.Inf. Ernst Dehner from Jul 15, 1943 to Apr 1, 1944. Jul 13 - Dec 31, 1943 46521/1 1544 la, Anlage 3 z. -

Jahrbuch 2002
okumentationsarchiv de österr 1chisch Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes JAHRBUCH Redaktion: Christine Schindler INHALT FRITZ V ERZETNITSCH Festvortrag anlässlich der Jahresversammlung des DÖW, Wien, 13. März 2001 5 PETER STEINBACH/ JOHANNES TUCHEL Der Einzeltäter Georg Elser Interpretationen und Missdeutungen des Attentats auf Hitler vom 8. November 1939 9 SIEGWALD ÜANGLMAIR Feldwebel Anton Schmid 25 KARL ÜLAUBAUF Oberst i. G. Heinrich Kodre Ein Linzer Ritterkreuzträger im militärischen Widerstand ' 41 MICHAEL GEHLER © 2002 by Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), Wien Anpassung, Mittun, Resistenz und Widerstand Printed in Austria Charakteristika, Probleme und Ambivalenzen von Umschlaggestaltung: Atelier Fuhrherr, Wien Oppositionsverhalten am Beispiel des Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Karl Gruber 1934-1945 69 Hersteller: Plöchl-Druck Ges. m. b. H„ 4240 Freistadt DANIEL HEINZ ISBN 3-901142-48-7 Der Widerstand der Reformadventisten im „Dritten Reich" 88 FRITZ VERZETNITSCH FESTVORTRAG ANLÄSSLICH DER ANTOON HULLEN JAHRESVERSAMMLUNG DES Erinnerungen an Karl Hilferding, DÖW, Opfer von Nazi-Judenhass 99 WIEN, 13. MÄRZ 2001 PETER HILFERDING-MrLFORD Karl Hilferding und Sir Karl R. Popper Eine Anmerkung zum Gedenkartikel von „Die Verkennung und Missachtung der Menschenrechte hat zu Akten der Bar Frater Antoon Hullen 118 barei geführt, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben", heißt es in der Präambel zur 1948 erfolgten Allgemeinen Erklärung ebendieser Menschen rechte. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes beschäf• HARTMUT MEHRINGER / ALBERT A. FEIBER tigt sich genau mit diesen „Wunden im Gewissen der Menschheit". „Eine gelungene Ausstellung über eine schreckliche Zeit" Eine Beschäftigung auch im Sinne eines Arztes, der die Krankheit und ihre Die Dokumentation Obersalzberg bei Berchtesgaden 119 Ursachen erforscht, um der Gesellschaft zu ennöglichen, sie zu bekämpfen und Heilung und Gesundheit zu ermöglichen. -

Battle of Monte Cassino
Battle of Monte Cassino 17 January thru 18 May 1944 Monte Cassino Abbey in November 2004 The Battle of Monte Cassino (also known as the Battle for Rome and the Battle for Cassino) was a costly series of four assaults by the Allies against the Winter Line in Italy held by the Germans and Italians during the Italian Campaign of World War II. The intention was a breakthrough to Rome. At the beginning of 1944, the western half of the Winter Line was being anchored by Germans holding the Rapido, Liri, and Garigliano valleys and some of the surrounding peaks and ridges. Together, these features formed the Gustav Line. Monte Cassino, a historic hilltop abbey founded in AD 529 by Benedict of Nursia, dominated the nearby town of Cassino and the entrances to the Liri and Rapido valleys, but had been left unoccupied by the German defenders. The Germans had, however, manned some positions set into the steep slopes below the abbey's walls. 1 Fearing that the abbey did form part of the Germans' defensive line, primarily as a lookout post, the Allies sanctioned its bombing on 15 February and American bombers proceeded to drop 1,400 tons of bombs onto it. The destruction and rubble left by the bombing raid now provided better protection from aerial and artillery attacks, so, two days later, German paratroopers took up positions in the abbey's ruins. Between 17 January and 18 May, Monte Cassino and the assaulted four times by Allied troops, the last involving twenty divisions attacking along a twenty-mile Gustav defenses were front. -
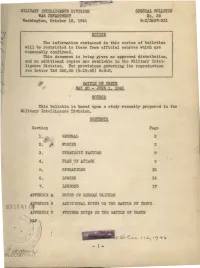
Oct 18 !41 Appendix C Further Notes on the Battle of Crete
MILITARY INTELLIG~~CE DIVISION SPECIAL BULLETIN W.AR DEPARTMENT No. 35 Washington. October 15, 1941 G-2/ 2657-231 NOTICE The information contained in this series of bulletins will be restricted to items from official sources which are . reasonably confirmed. This document is being given an approved distribution, and no additional copies are available in the Military Intel ligence Division. For provisions governing its reproduction see Letter TAG 350.05 (9-19-40) M-B-M. BATTLE OF CRETE MAY 20 - JUNE l, 1941 SOURCE This bulletin is based upon a stud~r recently prepe..red in the Military Intelligence Division. CONTENTS Section Page l. GENERAL 2 2. FORCES 3 r 3. STRAT~GIC FACTORS 8 4. PLAN OF ATTACK 9 5. OPERATIONS 10 6. LOSSES 16 ?. LESSONS 17 APPENDIX A NOTES ON GEPJ·IAN GLIDERS PENDIX B ADDITIONAL NOTES ON THE BATTLE OF CRETE OCT 18 !41 APPENDIX C FURTHER NOTES ON THE BATTLE OF CRETE - l- ·' . -- .- - _.,._·~-·: ·~;;; .... ·~ . ~;.; ,.,-, ··;. ::--·_ ~ . -- 13A'l'TLE OF CBET.E* MAY 20 - JUliE 1, 1941 1. G.ElmBAL The German conquest of Crete, effected bet\v-een Hay 20 and June 1, 1941, constitutes the first occasion in history \V"hen an ex peditionary force tr~~sported by air and e~ air fleet conquered a distant island protected by an overwhelmingly superior navy and a land garrison \IThich was considerably stronger, numerically, th~~ the invading force. Such an outcome would have been ~thinkable two years ago. Today, however, the result of that campaign a\ITakens among soldiers merely a mild feeling of surprise; the importance of air po\'ler has been brought home to the world since 1939. -

Fantasque Time Line | 1940
Appendice 1 Le XI. FliegerKorps (général des troupes aéroportées Kurt Student) dans l’opération Merkur 7e Flieger-Division, lieutenant-général Wilhelm Süssmann, puis major-général Alfred Sturm - 1er Régiment parachutiste, colonel Bruno Bräuer - 2e Régiment parachutiste sous le commandement personnel du major-général Sturm, assisté par le major Karl-Lothar Schulz - 3e Régiment parachutiste, colonel Richard Heidrich - Régiment d’assaut parachutiste, major-général Eugen Meindl - Détachement d’artillerie du 3e Régiment parachutiste, colonel Hermann-Bernhard Ramcke (rattaché à la 1ère division parachutiste italienne, en Sardaigne) 5. Gebirgs-Division, général-major des troupes de montagne Julius Ringel - 100e Régiment de montagne, colonel Willibald Utz - 85e Régiment de montagne, colonel August Krakau - 95e Régiment d’artillerie de montagne, colonel August Wittmann 22. Luftlande-Infanterie-Division, Generalleutnant Hans von Sponeck - 16e Régiment aéroporté, colonel Ludwig Wolff (seul engagé le premier jour) - 47e Régiment aéroporté, colonel Kurt Heyser - 65e Régiment aéroporté, colonel Ernst Haccius - 22e Régiment d’artillerie aéroportée, colonel Johann De Boer ……………………… Note sur les divisions d’infanterie légère allemandes (Leichte-Infanterie) A l’issue des durs combats de juin-juillet 1940 dans le sud de la France, l’état-major de la Wehrmacht, tirant les enseignements de la campagne, décide de créer un nouveau format de troupe : la division d’Infanterie Légère. La “Leichte” est une troupe polyvalente, équipée et formée pour combattre dans les pays méditerranéens, à été chaud et à relief souvent montagneux. La 5e DI (bavaroise), qui s’est illustrée à plusieurs reprises, du Chemin des Dames au Lubéron, est choisie pour cette expérience. Le lieutenant-général Wilhelm Fahrmbacher dirige la reconversion, avant d’être nommé général d’artillerie et inspecteur général de l’Infanterie légère, laissant sa division au major-général Karl Allmendinger. -

SCSL Press Clippings
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Friday, 21 August 2009 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 Local News “ I did Not Act Alone”-Taylor / The Exclusive Page 3 ECOWAS Leaders Recruited RUF Leadership in Salone / The Spark Pages 4-5 Taylor Negotiated With RUF Rebels for Release of UN Hostages / The Spectator Pages 6-7 Social Realities In Accessing Justice in Sierra Leone / Standard Times Pages 8-9 International News Special Court Prosecutor Meets the Press in Monrovia / The Patriotic Vanguard Pages 10-11 Charles Taylor Did Not Have Individual Influence Over The RUF… / CharlesTaylorTrial.org Pages 12-13 UNMIL Public Information Office Media Summary / UNMIL Pages 14-17 UN Nominates New Co-Prosecutor for ECCC / Voice of America Page 18 Tribunal Judge Says Karadzic Case Ready to Start / Radio Netherlands Worldwide Page 19 Like Al Bashir BDP Leaders Must Face ICC / Mmegi Online Pages 20-21 Prosecute Austrian Soldiers for WWII Crimes / Agence France Presses Page 22 DOJ Nazi Hunters Shift Focus to Perpetrators of New Atrocities / Aba Journal Page 23 An International Tribunal for Guantanamo Detainees? / Jurist Pages 24-25 Here's a Good Case for Killing the Death Penalty / Daily News Pages 26-27 3 The Exclusive Friday, 21 August 2009 4 The Spark Friday, 21 August 2009 5 6 The Spectator Friday, 21 August 2009 7 8 Standard Times Friday, 21 August 2009 Social Realities In Accessing Justice in Sierra Leone 9 10 The Patriotic Vanguard Thursday, 20 August 2009 Special Court prosecutor meets the press in Monrovia Statement by Stephen Rapp, Prosecutor of the Special Court for Sierra Leone Press Briefing, Monrovia, Liberia I am very pleased to be with you today. -

SCSL Press Clippings
SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE OUTREACH AND PUBLIC AFFAIRS OFFICE PRESS CLIPPINGS Enclosed are clippings of local and international press on the Special Court and related issues obtained by the Outreach and Public Affairs Office as at: Monday, 10 August 2009 Press clips are produced Monday through Friday. Any omission, comment or suggestion, please contact Martin Royston-Wright Ext 7217 2 Local News 50 Controlled and Restrainers Get Certificate / Awoko Page 3 Taylor Lashes at UK, USA / The Torchlight Pages 4-5 Taylor’s Lawyer Poisoned? / The Exclusive Pages 6-7 “ ECOMOG Trained Liberians” / Total News Page 8 RUFP Writes International Community / The Satellite Page 9 Needed: TRC Follow-Up Committee / The Senator Page 10 “I Thank God for NaCSA” / The New Citizen Page 11 Liberian President Faces TRC / The African Champion Page 12 International News Ex-Liberian Chief Pushes Back at US Government / Associated Press Pages 13-14 Ex-Liberian Chief Tells War Crimes Court US Radio Intercepts…/ Associated Press Page 15 Sierra Leone: Kabbah - It's Difficult to Forgive Charles Taylor / This Day Pages 16-17 Taylor Tells Court He Has No Secret Bank Accounts / Charlestaylortrial.org Pages 18-20 ECOMOG Peacekeepers Trained Liberians To Fight In Sierra Leone / Charlestaylortrial.org Pages 21-22 Report from The Hague / BBC World Service Trust Pages 23-25 UNMIL Public Information Office Media Summary / UNMIL Pages 26-27 Verdict Due for Ex-Nazi Officer, 65 Years After Italy Massacre / Agence France Presses Page 28 Suddenly, US Inclines Towards World Court -
Court Upholds ONE-Vote Decree, Scraps Assembly
SUBSCRIPTION MONDAY, JUNE 17, 2013 SHAABAN 8, 1434 AH www.kuwaittimes.net Court upholds one-vote Max 43º Min 31º decree, scraps Assembly High Tide 05:48 & 17:16 New elections to be held • Opposition to boycott polls Low Tide 11:48 & 23:50 40 PAGES NO: 15842 150 FILS By B Izzak conspiracy theories KUWAIT: In yet another dramatic day in Kuwait’s politi- cal crisis, the constitutional court yesterday nullified the Is 8 a lucky election process held on Dec 1 last year and dissolved the National Assembly, but at the same time it upheld the controversial Amiri decree that amended the elec- number? toral law and sparked street protests. Head of the court’s five-judge panel Youssef Al-Mutawa read out the verdict in the Palace of Justice auditorium that was packed with journalists and lawyers. The court, whose verdicts are final, called for holding fresh elections on the basis of the single-vote law that has been repeated- ly described by the opposition as unconstitutional. By Badrya Darwish The court based its decision to scrap the Assembly for the second time in a year on the basis that another Amiri decree issued in October last year to establish the National Election Committee is “unconstitutional”, say- ing there was no urgency in issuing the decree. In June [email protected] last year, the constitutional court nullified the election process and scrapped the opposition-dominated Assembly that was elected in Feb 2012 on the basis of ongratulations and celebrations, but it seems flawed procedures. like the one vote is the only option for you A few months later, HH the Amir issued the contro- Cand me.