PECKELS, Nina (2CD) Gesetze Und Ethik Im Konflikt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
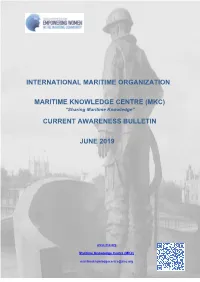
(Mkc) Current Awareness Bulletin June 2019
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION MARITIME KNOWLEDGE CENTRE (MKC) “Sharing Maritime Knowledge” CURRENT AWARENESS BULLETIN JUNE 2019 www.imo.org Maritime Knowledge Centre (MKC) [email protected] www d Maritime Knowledge Centre (MKC) About the MKC Current Awareness Bulletin (CAB) The aim of the MKC Current Awareness Bulletin (CAB) is to provide a digest of news and publications focusing on key subjects and themes related to the work of IMO. Each CAB issue presents headlines from the previous month. For copyright reasons, the Current Awareness Bulletin (CAB) contains brief excerpts only. Links to the complete articles or abstracts on publishers' sites are included, although access may require payment or subscription. The MKC Current Awareness Bulletin is disseminated monthly and issues from the current and the past years are free to download from this page. Email us if you would like to receive email notification when the most recent Current Awareness Bulletin is available to be downloaded. The Current Awareness Bulletin (CAB) is published by the Maritime Knowledge Centre and is not an official IMO publication. Inclusion does not imply any endorsement by IMO. Table of Contents IMO NEWS & EVENTS ............................................................................................................................ 2 UNITED NATIONS ................................................................................................................................... 4 CASUALTIES........................................................................................................................................... -

Report 2021, No. 6
News Agency on Conservative Europe Report 2021, No. 6. Report on conservative and right wing Europe 20th March, 2021 GERMANY 1. jungefreiheit.de (translated, original by jungefreiheit.de, 18.03.2021) "New German media makers" Migrant organization calls for more “diversity” among journalists media BERLIN. The migrant organization “New German Media Makers” (NdM) has reiterated its demand that editorial offices should become “more diverse”. To this end, the association presented a “Diversity Guide” on Wednesday under the title “How German Media Create More Diversity”. According to excerpts on the NdM website, it says, among other things: “German society has changed, it has become more colorful. That should be reflected in the reporting. ”The manual explains which terms journalists should and should not use in which context. 2 When reporting on criminal offenses, “the prejudice still prevails that refugees or people with an international history are more likely to commit criminal offenses than biographically Germans and that their origin is causally related to it”. Collect "diversity data" and introduce "soft quotas" Especially now, when the media are losing sales, there is a crisis of confidence and more competition, “diversity” is important. "More diversity brings new target groups, new customers and, above all, better, more successful journalism." The more “diverse” editorial offices are, the more it is possible “to take up issues of society without prejudice”, the published excerpts continue to say. “And just as we can no longer imagine a purely male editorial office today, we should also no longer be able to imagine white editorial offices. Precisely because of the special constitutional mandate of the media, the question of fair access and the representation of all population groups in journalism is also a question of democracy. -

Unhcr Position on the Designations of Libya As a Safe Third Country and As a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea
UNHCR POSITION ON THE DESIGNATIONS OF LIBYA AS A SAFE THIRD COUNTRY AND AS A PLACE OF SAFETY FOR THE PURPOSE OF DISEMBARKATION FOLLOWING RESCUE AT SEA UNHCR POSITION ON THE DESIGNATIONS OF LIBYA AS A SAFE THIRD COUNTRY AND AS A PLACE OF SAFETY FOR THE PURPOSE OF DISEMBARKATION FOLLOWING RESCUE AT SEA September 2020 Introduction .................................................................................................................................................... 1 Situation of Foreign Nationals (Including Asylum-Seekers, Refugees and Migrants)................................... 3 Humanitarian Situation ................................................................................................................................. 11 International Protection Needs of Foreign Nationals Departing from/through Libya .................................. 16 Libya as a Country of Asylum ...................................................................................................................... 16 Designation of Libya as Safe Third Country ................................................................................................ 16 Designation of Libya as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation following Rescue at Sea ... 17 Introduction 1. This position supersedes and replaces UNHCR’s guidance on foreign nationals in Libya contained in the Position on Returns to Libya – Update II of September 2018; however, UNHCR guidance in relation to Libyan nationals and habitual residents as provided in the September -

Feeling Humanitarianism During the Spanish Civil War and Republican Exile
Journal Feeling humanitarianism during the spanish civil war and republican exile MARTIN MORUNO, Dolorès (Guest Ed.) Reference MARTIN MORUNO, Dolorès (Guest Ed.). Feeling humanitarianism during the spanish civil war and republican exile. Journal of Spanish Cultural Studies, 2020, vol. 4, no. 1, p. 1-13 DOI : 10.1080/14636204.2020.1842092 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:145176 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 Journal of Spanish Cultural Studies ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/cjsc20 Feeling humanitarianism during the Spanish Civil War and Republican exile Dolores Martín-Moruno To cite this article: Dolores Martín-Moruno (2020): Feeling humanitarianism during the Spanish Civil War and Republican exile, Journal of Spanish Cultural Studies To link to this article: https://doi.org/10.1080/14636204.2020.1842092 Published online: 17 Nov 2020. Submit your article to this journal View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cjsc20 JOURNAL OF SPANISH CULTURAL STUDIES https://doi.org/10.1080/14636204.2020.1842092 INTRODUCTION Feeling humanitarianism during the Spanish Civil War and Republican exile Dolores Martín-Moruno Institute for Ethics, History and the Humanities, University of Geneva, Geneva, Switzerland Until two decades ago, a mere “handful of historians” were concerned with the study of humanitarianism (Taithe and Borton 2016, 210). The reason is that humanitarianism has traditionally been presented as a moral imperative “located out of history” (Taithe 2017a), rather than as a movement whose long-term evolution needs to be understood in political (Arendt [1963] 1990; Boltanski [1993] 1999), economic (Haskell 1985; Roddy, Strange, and Taithe 2018), social (Brodiez and Dumons 2009) and cultural terms (Festa 2010). -

FBM19 Pressemappe 0.Pdf
• • • PRESSEMITTEILUNG Neue Hörwelt auf der Buchmesse: Frankfurt Audio Mit Melanie Raabe, Rafik Schami, Iny Lorentz, Mieze Katz, Rita Falk, Sascha Lobo, Lars Amend und stern Crime / Podcast-Wettbewerb / Frankfurt Audio Summit mit Michael Krause von Spotify Der Audiobereich gehört international zu den wachstumsstärksten Segmenten in der Medienbranche. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse rückt die Welt der Hörbücher, Podcasts und Audio-Trends ins Rampenlicht: Frankfurt Audio heißt der neue Themenbereich, der ein Areal in Halle 3.1 mit einer eigenen Bühne, der Frankfurt Audio Stage, und eine Fachkonferenz am Messedonnerstag, den Frankfurt Audio Summit, umfasst. „Bei Frankfurt Audio dreht sich alles um das gesprochene Wort. Hörbare Inhalte waren schon immer präsent auf der Buchmesse. Im neuen Frankfurt Audio Areal werden die Trends rund um Hörbuch und Podcast nun in einem zentralen Bereich erlebbar“, sagt Matthäus Cygan, Director Business Development Trade International bei der Frankfurter Buchmesse, der den Themenbereich initiiert hat. „Auf mehr als 600 Quadratmetern werden im Frankfurt Audio Areal deutschsprachige Hörbuchverlage neben internationalen Streamingplattformen anzutreffen sein. Ein hochkarätiges Fachprogramm für Akteure aus der Publishing- und Audio-Branche wird durch Veranstaltungen mit bekannten Autorinnen, Hörbuchsprechern und Podcasterinnen ergänzt.“ Bestseller-Autorinnen und Podcaster: spannende Stimmen auf der Bühne Auf der Frankfurt Audio Stage (Halle 3.1 L 59) werden Gäste mit guter Stimme erwartet: Autor und Erzähler Rafik Schami, das Autorenpaar hinter Iny Lorentz, Sascha Lobo und DJ-Legende Talla2XLC stellen ihre neuesten Hörbücher vor. Die Frontfrau der Berliner Elektropop-Band MIA, Mieze Katz, interviewt gemeinsam mit RollingStone-Autor Ralf Niemczyk die Bestseller-Autorin Rita Falk. Wie schreibt man als Buchautorin einen Podcast? Melanie Raabe, Bestseller-Autorin und federführende Kraft hinter der erfolgreichen Podcast-Serie Der Abgrund, steht Rede und Antwort auf der Bühne. -

The Migration Conference 2020 Tetovo Online
The Migration Conference 2020 Book of Abstracts and Programme The Migration Conference 2020 Book of Abstracts and Programme by The Migration Conference Team Organised with support of: TRANSNATIONAL PRESS LONDON 2020 The Migration Conference 2020 - Book of Abstracts and Programme By The Migration Conference Team Copyright © 2020 by Transnational Press London All rights reserved. First Published in 2020 by TRANSNATIONAL PRESS LONDON in the United Kingdom, 12 Ridgeway Gardens, London, N6 5XR, UK. www.tplondon.com Transnational Press London® and the logo and its affiliated brands are registered trademarks. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review or scholarly journal. Requests for permission to reproduce material from this work should be sent to: [email protected] Paperback ISBN: 978-1-912997-38-1 Cover Design: Nihal Yazgan www.tplondon.com Chair’s Welcome Dear colleagues, We’re pleased to welcome you to the 8th Migration Conference. The Migration Conference 2020 is held online via Microsoft Teams platform due to COVID-19 Pandemic restrictions. We have as usual covering a wide array of topics in this year’s edition too. There are about 350 presentations and debates running over 4 days from 8th to 11th September 2020. We have tried to address the time zone differences by moving sessions towards mid-day and grouping presentations, where possible, according to time zones. However, we believe this is not perfect to accommodate hundreds of colleagues from Brazil to Japan, and Australia to Canada. -

Tätigkeitsbericht Des Parteivorstandes an Die 1
Tätigkeitsbericht des Parteivorstandes an die 1. Tagung des 7. Bundesparteitages der Partei DIE LINKE Erfurt, 30. Oktober bis 1. November 2020 Gemäß § 9 (5) des Parteiengesetzes der Bundesrepublik Deutschland und § 15 (2) e der Bundessat- zung der Partei DIE LINKE legt der Parteivorstand dem Bundesparteitag einen Tätigkeitsbericht vor. Der Berichtszeitraum begann mit der Wahl des Parteivorstandes auf der 1. Tagung des 6. Bundespar- teitages vom 8. bis 10. Juni 2018 in Leipzig. Redaktionsschluss für diesen Bericht war der 12. Sep- tember 2020. Grundlagen der Arbeit des Parteivorstandes Der Parteivorstand arbeitete auf Grundlage des Parteiprogramms, der Bundessatzung, der Ordnungen der Partei, des 2019 beschlossenen Europawahlprogramms, des 2017 beschlossenen Bundestags- wahlprogramms und der weiteren 2007 beschlossenen Gründungsdokumente der Partei DIE LINKE. Im Berichtszeitraum gaben die Bundesparteitage die grundsätzliche Orientierung für die Vorstandsar- beit: Die 1. Tagung des 6. Parteitages der Partei DIE LINKE am 8./9./10. Juni 2018 in Leipzig mit folgen- den Beschlüssen und Resolutionen: . DIE LINKE – in Bewegung . Abrüsten! – Deeskalation ist das Gebot der Stunde . Für ein Leben in Würde - jenseits von Selektion, Menschenverachtung und Rassismus . Für ein Recht auf gute Arbeit und gutes Leben . Gegen Rassismus und rechte Hetze – unsere Alternative heißt soziale Gerechtigkeit! . Solidarität konkret: »nd« abonnieren! Zeitung und Arbeitsplätze sichern . Nein zu BAMF-Untersuchungsausschuss . Solidarität mit #Besetzen – Hausbesetzungen entkriminalisieren . Völkerrecht einhalten – Atomabkommen mit dem Iran beibehalten . Leipziger Gießerei »Halberg & Guss« . Solidarität mit Venezuela Die 2. Tagung des 6. Parteitages der Partei DIE LINKE vom 22. bis 24. Februar 2019 in Bonn mit fol- gendem Beschluss (neben dem Wahlprogramm): . Weg mit § 219 und § 218 Alle von Bundesparteitagen an den Parteivorstand überwiesenen Anträge wurden von diesem behan- delt. -

Standardised Achievement Test System for Schools Planned
BUSINESSB | 13 SPORT | 20 Side hustles are Xavi tells ththe new norm for Al Sadd to Doha’s women ‘fight until go-getters the end’ Wednesday 28 August 2019 | 27 Dhul-Hijja 1440 www.thepeninsula.qa Volume 24 | Number 7997 | 2 Riyals Join the elite, with beIN and Ooredoo ONE Standardised Prime Minister witnesses launch of Najah Qatari 2019 achievement test system for schools planned A Ministerial decision was issued to form a committee to establish a national evaluation system for state schools, aiming to provide data on the level of performance of schools and the extent of the development of students’ learning, to develop the indicators “I am delighted to be present at the third used by the Ministry to measure the quality edition of Najah Qatari festival. We are proud of education in state schools. of youth initiatives aimed at highlighting Qatari talent and competencies in various fields, and emphasize that human beings QNA learning, in order to develop the are our most important resource. Thanks DOHA indicators used by the Ministry to the organizers of this forum and I look to measure the quality of edu- forward to more distinctive editions in the Minister of Education and Higher cation in state schools and the coming years." Education H E Dr Mohammed bin effectiveness of curricula in Abdul Wahed Ali Al Hammadi order to establish the necessary yesterday issued a ministerial plans to develop the educational decision on the system of process. national tests in public schools, Under this decision, the stipulating that this system be committee is chaired by the replaced by standardised Undersecretary of the Ministry, Prime Minister and Interior Minister H E Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani witnessed the launch of the third edition achievement tests, in order to and comprises three members of Najah Qatari festival at the Doha Exhibition and Convention Center. -

QF Student Develops a Dual-Role Robot
INDEX QATAR 2,12 COMMENT 10 BUSINESS | Page 1 QATAR | Page 12 ARAB WORLD 3 BUSINESS 1-8 Credit to trading INTERNATIONAL 4-9,11 SPORTS 1-8 QU graduates and services DOW JONES QE NYMEX serve MoPH as sectors rises volunteers to 28,665.82 9,882.93 42.96 double-digit +173.55 -0.16 -0.08 fi ght pandemic +0.61% -0.16% -0.19% in July Latest Figures published in QATAR since 1978 SATURDAY Vol. XXXXI No. 11655 August 29, 2020 Muharram 10, 1442 AH GULF TIMES www. gulf-times.com 2 Riyals Amir wishes Futuristic stadium Japanese PM speedy recovery Plans for more His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani has wished Japanese Prime Minister Shinzo Abe, a speedy recovery. greenhouses to In a tweet yesterday, he said: “We wish a speedy recovery for our friend Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. You have always been supporting the deeply strong rela- boost Qatar’s tions between Qatar and Japan, and work with you have been a source of happiness”. farming sector Japan’s Abe resigning By Joey Aguilar for health reasons Staff Reporter Japan’s Prime Minister Shinzo Abe announced yesterday he will lans to develop 1.5mn sq m of resign, ending his record-breaking diff erent types of greenhouses in tenure in a bombshell development With its critically acclaimed design inspired by Qatar’s seafaring past, Al Janoub Stadium will welcome 40,000 football Pthe next two years is expected to that kicks off a leadership race fans in 2022, the Supreme Committee for Delivery & Legacy tweeted yesterday. -

Fridays for Future – Die Jugend Gegen Den Klimawandel
Sebastian Haunss, Moritz Sommer (Hg.) Fridays for Future – Die Jugend gegen den Klimawandel X-Texte zu Kultur und Gesellschaft Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch den Fachinformationsdienst Politikwissenschaft POLLUX und ein Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozial- und Geisteswissenschaften (transcript, Politikwissenschaft 2020) Die Publikation beachtet die Qualitätsstandards für die Open-Access-Publikation von Büchern (Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt et al. 2018), Phase 1 https://oa2020-de.org/blog/2018/07/31/empfehlungen_qualitätsstandards_oabücher/ Universitätsbibliothek Bayreuth | Uni- versitätsbibliothek Kassel | Universitäts- und versitätsbibliothek der Humboldt-Universität Stadtbibliothek Köln | Universität Konstanz, zu Berlin | Staatsbibliothek zu Berlin | Uni- Kommunikations-, Informations-, Medien- versitätsbibliothek FU Berlin | Universitäts- zentrum | Universitätsbibliothek Koblenz- bibliothek Bielefeld (University of Bielefeld) | Landau | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität Zentral- u. Hochschulbibliothek Luzern | Bochum | Universitäts- und Landesbibliothek Universitätsbibliothek Mainz | Universitäts- | Sächsische Landesbibliothek - Staats- bibliothek Marburg | Ludwig-Maximilians- und Universitätsbibliothek Dresden | Universität München Universitätsbibliothek | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | Max Planck Digital Library | Universitäts- und Universitäts- u. Landesbibliothek Düsseldorf -

Journal of International Law and International Relations
08 2 0 2 0 JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS ISSN 2341-0868 DOI: http://dx.doi.org/10.25267/Paix_secur_int.2020.i8 JOAN DAVID JANER TORRENS Citation: JANER TORRENS, J. D: «Migrant Search and Rescue Operations in the Mediterranean by Humanitarian Organizations: Migrant Smuggling or Humanitarian Assistance?», Paix et Sécurité Internationales, num. 8, 2020, pp. 381-401. Received: 20 September 2020. Accepted: 13 October 2020. MIGRANT SEARCH AND RESCUE OPERATIONS IN THE MEDITERRANEAN BY HUMANITARIAN ORGANIZATIONS: MIGRANT SMUGGLING OR HUMANITARIAN ASSISTANCE? Joan David JANER TORRENS1 I. INTRODUCTION – II. PROCEEDINGS AGAINST HUMANITARIAN SEA RESCUE ORGANIZATIONS – III. MIGRANT SMUGGLING OR HUMANITARIAN ASSISTANCE? THE NEED TO ESTABLISH COMMON GUIDELINES – IV. THE CRIMINALIZATION OF HUMANITARIAN ASSISTANCE, COMBATTING MIGRANT SMUGGLING AND HUMAN RIGHTS – V. FINAL REMARKS ABSTRACT: In contrast with the world’s other migratory routes, the Mediterranean is the one where more migrants die or disappear in their attempt to reach Europe’s coasts. Although different international instruments refer to the obligation of States and the captains of vessels to provide assistance to anyone who is in distress at sea, the truth is that there has been a progressive reduction in search and rescue operations by the European Union and its Member States. Faced with this inaction, various NGOs dedicated to humanitarian aid have deployed vessels in the Mediterranean in order to search for and rescue migrants in distress at sea. NGOs have come to play an important role in assisting migrants, although they have encountered substantial hostility on the part of certain States, which regard these NGOs as acting as accomplices in illegal migrant smuggling. -

Voll Freude Jesus Entdecken
Nr. 19 I Donnerstag, 9. Mai 2019 Einzelpreis: € 1,50 I www.kirchenblatt.at KirchenBlatt ELKE LENZ Jesus - unser Schatz, lautete das Thema der Erstkommunion heuer in Schwarzach. Den Voll Freude vier Jungs ist die Freude an diesem Tag ins Ge- sicht geschrieben. Denn dieser Tag gehört ih- nen. Sie werden von ihren Familien selbst als Schatz gefeiert - kostbar und einmalig, behü- Jesus entdecken tet und geschützt. „Du bist mein Schatz!“ Wer diesen Satz in seiner ganzen Fülle begreifen lernt, wird auch den Weg zu jenem Schatz n- den, der durch Jesus gegenwärtig ist: das be- Erstkommunionfeiern im ganzen Land führen Kinder zur Eucharistie. dingungslose Geliebt-Sein durch Gott. Die Eucharistie ist ein guter Weg dorthin, ein Übungs- und Kraftweg. PB 2 Thema 9. Mai 2019 Vorarlberger KirchenBlatt AUF EIN WORT Erwachsenenfirmung Mutters Tag Firmung mit 35 Am Sonntag ist Muttertag. Als Kinder haben wir drei Ge- schwister an diesem Sonn- Wer sich im Erwachsenenalter für die „Der Glaube ist überall, viele Entscheidun- tag immer das Frühstück Firmung entscheidet, lässt sich auf eine gen haben mit dem Glauben zu tun“, erklärt gemacht - Mama konnte aus- besondere Auseinandersetzung mit dem Landowski. „Es geht darum, wie man sich schlafen. Es war auch für uns Glauben ein. Dass diese sehr bereichernd mit einem Thema beschäftigt, wie man an Frühstücksmacher/innen ein sein kann, davon erzählt Nicholas Landow- ein Problem herangeht. Glaube ist Rückhalt, schöner Tag - weil es anders ski. Er wird kommenden Samstag gefirmt. Kraft und Hoffnung.“ war als sonst und wir Eifer und Freude an den Tag legten PATRICIA BEGLE Keine Zugangsbedingungen.