„Faccend'ognitoscan Di Te Tremare“: Resonanzen Politischer
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TRECENTO FRAGMENTS M Ichael Scott Cuthbert to the Department Of
T R E C E N T O F R A G M E N T S A N D P O L Y P H O N Y B E Y O N D T H E C O D E X a thesis presented by M ichael Scott Cuthbert t the Depart!ent " M#si$ in partia% "#%"i%%!ent " the re&#ire!ents " r the de'ree " D $t r " Phi% s phy in the s#b(e$t " M#si$ H ar)ard * ni)ersity Ca!brid'e+ Massa$h#setts A#'#st ,--. / ,--.+ Mi$hae% S$ tt C#thbert A%% ri'hts reser)ed0 Pr "0 Th !as F rrest 1 e%%y+ advisor Mi$hae% S$ tt C#thbert Tre$ent Fra'!ents and P %yph ny Bey nd the C de2 Abstract This thesis see3s t #nderstand h 4 !#si$ s #nded and "#n$ti ned in the 5ta%ian tre6 $ent based n an e2a!inati n " a%% the s#r)i)in' s #r$es+ rather than n%y the ! st $ !6 p%ete0 A !a( rity " s#r)i)in' s #r$es " 5ta%ian p %yph ni$ !#si$ "r ! the peri d 788-9 7:,- are "ra'!ents; ! st+ the re!nants " % st !an#s$ripts0 Despite their n#!eri$a% d !i6 nan$e+ !#si$ s$h %arship has )ie4 ed these s #r$es as se$ ndary <and "ten ne'%e$ted the! a%t 'ether= " $#sin' instead n the "e4 %ar'e+ retr spe$ti)e+ and pred !inant%y se$#%ar $ di6 $es 4 hi$h !ain%y ri'inated in the F% rentine rbit0 C nne$ti ns a! n' !an#s$ripts ha)e been in$ !p%ete%y e2p% red in the %iterat#re+ and the !issi n is a$#te 4 here re%ati nships a! n' "ra'!ents and a! n' ther s!a%% $ %%e$ti ns " p %yph ny are $ n$erned0 These s!a%% $ %%e$ti ns )ary in their $ nstr#$ti n and $ ntents>s !e are n t rea%%y "ra'!ents at a%%+ b#t sin'%e p %yph ni$ 4 r3s in %it#r'i$a% and ther !an#s$ripts0 5ndi)id#6 a%%y and thr #'h their )ery n#!bers+ they present a 4 ider )ie4 " 5ta%ian !#si$a% %i"e in the " #rteenth $ent#ry than $ #%d be 'ained "r ! e)en the ! st $are"#% s$r#tiny " the inta$t !an#s$ripts0 E2a!inin' the "ra'!ents e!b %dens #s t as3 &#esti ns ab #t musical style, popularity, scribal practice, and manuscript transmission: questions best answered through a study of many different sources rather than the intense scrutiny of a few large sources. -

Madrigal, Lauda, and Local Style in Trecento Florence
Madrigal, Lauda, and Local Style in Trecento Florence BLAKE McD. WILSON I T he flowering of vernacular traditions in the arts of fourteenth-century Italy, as well as the phenomenal vitality of Italian music in later centuries, tempts us to scan the trecento for the earliest signs of distinctly Italianate styles of music. But while the 137 cultivation of indigenous poetic genres of madrigal and caccia, ac- corded polyphonic settings, seems to reflect Dante's exaltation of Italian vernacular poetry, the music itself presents us with a more culturally refracted view. At the chronological extremes of the four- teenth century, musical developments in trecento Italy appear to have been shaped by the more international traditions and tastes associated with courtly and scholastic milieux, which often combined to form a conduit for the influence of French artistic polyphony. During the latter third of the century both forces gained strength in Florentine society, and corresponding shifts among Italian patrons favored the importation of French literary and musical culture.' The cultivation of the polyphonic ballata after ca. 1370 by Landini and his contem- poraries was coupled with the adoption of three-part texture from French secular music, and the appropriation of certain French nota- tional procedures that facilitated a greater emphasis on syncopation, Volume XV * Number 2 * Spring 1997 The Journal of Musicology ? 1997 by the Regents of the University of California On the shift in patronage and musical style during the late trecento, see Michael P. Long, "Francesco Landini and the Florentine Cultural Elite," Early Music History 3 (1983), 83-99, and James Haar, Essays on Italian Poetry and Music in the Renaissance, 1350-1600 (Berkeley, CA, 1986), 22-36. -

Sources of Donatello's Pulpits in San Lorenzo Revival and Freedom of Choice in the Early Renaissance*
! " #$ % ! &'()*+',)+"- )'+./.#')+.012 3 3 %! ! 34http://www.jstor.org/stable/3047811 ! +565.67552+*+5 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=caa. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit organization founded in 1995 to build trusted digital archives for scholarship. We work with the scholarly community to preserve their work and the materials they rely upon, and to build a common research platform that promotes the discovery and use of these resources. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. http://www.jstor.org THE SOURCES OF DONATELLO'S PULPITS IN SAN LORENZO REVIVAL AND FREEDOM OF CHOICE IN THE EARLY RENAISSANCE* IRVING LAVIN HE bronze pulpits executed by Donatello for the church of San Lorenzo in Florence T confront the investigator with something of a paradox.1 They stand today on either side of Brunelleschi's nave in the last bay toward the crossing.• The one on the left side (facing the altar, see text fig.) contains six scenes of Christ's earthly Passion, from the Agony in the Garden through the Entombment (Fig. -

La Caccia Nell'ars Nova Italiana
8. Iohannes Tinctoris, Diffinitorium musice. Un dizionario Il corpus delle cacce trecentesche rappresenta con «La Tradizione Musicale» è una collana promossa di musica per Beatrice d’Aragona. A c. di C. Panti, 2004, ogni probabilità uno dei momenti di più intenso dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali pp. LXXIX-80 e immediato contatto tra poesia e musica. La viva- dell’Università di Pavia, dalla Fondazione Walter 9. Tracce di una tradizione sommersa. I primi testi lirici italiani cità rappresentativa dei testi poetici, che mirano Stauffer e dalla Sezione Musica Clemente Terni e 19 tra poesia e musica. Atti del Seminario di studi (Cre mona, alla descrizione realistica di scene e situazioni im- Matilde Fiorini Aragone, che opera in seno alla e 20 febbraio 2004). A c. di M. S. Lannut ti e M. Locanto, LA CACCIA Fonda zione Ezio Franceschini, con l’intento di pro- 2005, pp. VIII-280 con 55 ill. e cd-rom mancabilmente caratterizzate dal movimento e dalla concitazione, trova nelle intonazioni polifo- muovere la ricerca sulla musica vista anche come 13. Giovanni Alpigiano - Pierluigi Licciardello, Offi - niche una cassa di risonanza che ne amplifica la speciale osservatorio delle altre manifestazioni della cium sancti Donati I. L’ufficio liturgico di san Do nato di cultura. «La Tradizione Musicale» si propone di of- portata. L’uso normativo della tecnica canonica, de- Arezzo nei manoscritti toscani medievali, 2008, pp. VIII-424 NELL’ARS NOVA ITALIANA frire edizioni di opere e di trattati musicali, studi 8 finita anch’essa ‘caccia’ o ‘fuga’, per l’evidente me- con ill. a colori monografici e volumi miscellanei di alto valore tafora delle voci che si inseguono, si dimostra 16. -

JAMES D. BABCOCK, MBA, CFA, CPA 191 South Salem Road Ridgefield, Connecticut 06877 (203) 994-7244 [email protected]
JAMES D. BABCOCK, MBA, CFA, CPA 191 South Salem Road Ridgefield, Connecticut 06877 (203) 994-7244 [email protected] List of Addendums First Addendum – Middle Ages Second Addendum – Modern and Modern Sub-Categories A. 20th Century B. 21st Century C. Modern and High Modern D. Postmodern and Contemporary E. Descrtiption of Categories (alphabetic) and Important Composers Third Addendum – Composers Fourth Addendum – Musical Terms and Concepts 1 First Addendum – Middle Ages A. The Early Medieval Music (500-1150). i. Early chant traditions Chant (or plainsong) is a monophonic sacred form which represents the earliest known music of the Christian Church. The simplest, syllabic chants, in which each syllable is set to one note, were probably intended to be sung by the choir or congregation, while the more florid, melismatic examples (which have many notes to each syllable) were probably performed by soloists. Plainchant melodies (which are sometimes referred to as a “drown,” are characterized by the following: A monophonic texture; For ease of singing, relatively conjunct melodic contour (meaning no large intervals between one note and the next) and a restricted range (no notes too high or too low); and Rhythms based strictly on the articulation of the word being sung (meaning no steady dancelike beats). Chant developed separately in several European centers, the most important being Rome, Hispania, Gaul, Milan and Ireland. Chant was developed to support the regional liturgies used when celebrating Mass. Each area developed its own chant and rules for celebration. In Spain and Portugal, Mozarabic chant was used, showing the influence of North Afgican music. The Mozarabic liturgy survived through Muslim rule, though this was an isolated strand and was later suppressed in an attempt to enforce conformity on the entire liturgy. -
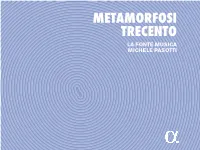
Philippe De Vitry
METAMORFOSI TRECENTO LA FONTE MUSICA MICHELE PASOTTI MENU TRACKLIST LE MYTHE DE LA TRANSFORMATION DANS L’ARS NOVA PAR MICHAEL SCOTT CUTHBERT METAMORFOSI TRECENTO PAR MICHELE PASOTTI MICHELE PASOTTI & LA FONTE MUSICA BIOS FRANÇAIS / ENGLISH / DEUTSCH TEXTES CHANTÉS MENU METAMORFOSI TRECENTO FRANCESCO LANDINI DA FIRENZE (c.1325-1397) 1 SÌ DOLCE NON SONÒ CHOL LIR’ ORFEO 2’21 PAOLO DA FIRENZE (c.1355-after 1436) 2 NON PIÙ INFELICE 5’51 JACOPO DA BOLOGNA (f.1340-c.1386) 3 FENICE FU’ 2’11 ANONYME (c.1360?) 4 TRE FONTANE (INSTRUMENTALE) 7’15 PHILIPPE DE VITRY (1291-1361) 5 IN NOVA FERT/GARRIT GALLUS/NEUMA 2’49 GUILLAUME DE MACHAUT (c.1300-1377) 6 PHYTON, LE MERVILLEUS SERPENT 4’32 SOLAGE (f.1370-1403) 7 CALEXTONE 4’40 ANTONIO ‘ZACARA’ DA TERAMO (1350/60-after 1413) 8 IE SUY NAVRÉS/GNAFF’A LE GUAGNELE 2’44 4 FILIPPOTTO DA CASERTA (f.2nd half XIVth century) 9 PAR LE GRANT SENZ D’ADRIANE 9’54 MAESTRO PIERO (f.first half XIVth century) 10 SÌ COM’AL CANTO DELLA BELLA YGUANA 4’02 NICCOLÒ DA PERUGIA (f.2nd half XIVth century) 11 QUAL PERSEGUITA DAL SUO SERVO DANNE 4’33 BARTOLINO DA PADOVA (c.1365-1405) 12 STRINÇE LA MAN (INSTRUMENTALE) 1’17 JACOPO DA BOLOGNA 13 NON AL SU’ AMANTE PIÙ DIANA PIACQUE 3’26 MATTEO DA PERUGIA (fl. ca.1400-1416) 14 GIÀ DA RETE D'AMOR 5’02 JACOPO DA BOLOGNA 15 SÌ CHOME AL CHANTO DELLA BELLA YGUANA 3’02 TOTAL TIME: 63’39 5 MENU LA FONTE MUSICA MICHELE PASOTTI MEDIEVAL LUTE & DIRECTION FRANCESCA CASSINARI SOPRANO ALENA DANTCHEVA SOPRANO GIANLUCA FERRARINI TENOR MAURO BORGIONI BARITONE EFIX PULEO FIDDLE TEODORO BAÙ FIDDLE MARCO DOMENICHETTI RECORDER FEDERICA BIANCHI CLAVICYMBALUM MARTA GRAZIOLINO GOTHIC HARP 6 MENU LE MYTHE DE LA TRANSFORMATION DANS L’ARS NOVA PAR MICHAEL SCOTT CUTHBERT Il a fallu une sorcière ayant le pouvoir de transformer les hommes en porcs pour amener Ulysse à perdre tous les autres plaisirs au monde ; mais, pour moi, il suffirait que tu sois mienne pour me faire renoncer à tout autre désir. -

Jubal, Pythagoras and the Myth of the Origin of Music with Some Remarks Concerning the Illumination of Pit (It
Philomusica on-line 16 (2017) Jubal, Pythagoras and the Myth of the Origin of Music With some remarks concerning the illumination of Pit (It. 568) Davide Daolmi Università degli Studi di Milano [email protected] § Alla fine del Trecento l’iconografia § At the end of the fourteenth century della Musica mostra una forma the iconography of Music shows a complessa basata sul mito del primo complex morphology based on the padre fondatore dell’arte musicale. La myth of the first founding father of the sua raffigurazione più sofisticata appa- musical art. Its most sophisticated re nella miniatura d’apertura di Pit image appears in the opening (Parigi, Bibl. Nazionale, It. 568), uno illumination of Pit (Paris, Bibl. dei più importanti manoscritti di Ars Nationale, It. 568), one of the most Nova italiana. important manuscripts of the Italian Nel riconsiderare la bibliografia Ars Nova. esistente, la prima parte dell’articolo After reviewing the existing biblio- indaga il contesto culturale che ha graphy, the first part of the article prodotto la miniatura, per poi, nella traces the cultural context that seconda, ripercorrere l’intera storia del produced this illumination. The mito, la sua tradizione biblica (Iubal), il second part reconstructs the whole suo corrispondente pagano (Pitagora), history of the myth of the origin of il rapporto con il mito della translatio music, its biblical tradition (Jubal), its studii (le colonne della conoscenza), e pagan equivalent (Pythagoras), their la sua forma complessa adottata a association with the myth of translatio partire dal XII secolo. Il modello studii (the pillars of knowledge), and iconografico fu concepito in Italia nel its syncretic form adopted from the Trecento e la forma ormai matura twelfth century onward. -

«Diverse Voci…» 14 in Copertina: Modena, Biblioteca Estense, Ms
«Diverse voci…» 14 In copertina: Modena, Biblioteca Estense, ms. α.M.5.24, c. 32r: Matheus de Perusio, Le greygnour bien que nature UNIVERSITÀ DI PAVIA DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA E BENI CULTURALI CARA SCIENTIA MIA, MUSICA STUDI PER MARIA CARACI VELA a cura di ANGELA ROMAGNOLI, DANIELE SABAINO, RODOBALDO TIBALDI E PIETRO ZAPPALÀ * * EDIZIONI ETS «Diverse voci…» Collana del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali Università di Pavia Comitato scientifco Elena Ferrari Barassi, Maria Caraci Vela, Fabrizio Della Seta, Michela Garda, Giancarlo Prato, Daniele Sabaino La pubblicazione è stata realizzata con il contributo dFM © Copyright 2018 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa [email protected] www.edizioniets.com Distribuzione Messaggerie Libri SPA Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI) Promozione PDE PROMOZIONE SRL via Zago 2/2 - 40128 Bologna ISBN 978-884675180-5 ISMN M 979-0-705015-37-9 Cara scientia mia, musica.indb 4 09/09/18 19:26 (Foto Gianfranco Negri) INDICE Tabula gratulatoria XIII Giancarlo Prato Prefazione XV Maria Caraci Vela – Nota biografica XVII Nota dei curatori XIX Elenco delle pubblicazioni di Maria Caraci Vela XXI Elenco delle tesi curate da Maria Caraci Vela XXIX Sigle delle biblioteche XXXV TOMO I TESTI Luigi Galasso L’armonia delle sfere celesti in un frammento di Vario (157 Hollis; F 2 Schauer) 3 Sandra Martani Un esempio di notazione ecfonetica del sistema post-classico: il manoscritto Alex. Patr. gr. 10 (a.D. 1338) 15 Marco D’Agostino Tradition and innovation in the Greek printed book of -

Extra Moenia»
-~ PAOLO TENORlSTA, FIORENTINO ~EXTRA MOENIA» I Tra i polifonisti dell' ars nova italiana Paolo va indubbia mente annoverato nel gruppo cospicuo dei fiorentini. E tut tavia con sorpresa si riscontra che le sue opere sono tutt'altro che frequenti nella maggior parte dei codici che rappresen tano l'ottima e abbondante tradizione musicale fiorentina di quel periodo. Nessuna composizione porta il suo nome nel più antico e autorevole di quei codici, il Panciatichiano 26 (FP) \ n è vi sono elementi per attribuirgliene alcuna delle adespote; nessuna ne fu annotata nelle sedici carte rimaste vuote -benchè l'intestazione le dichiari destinate ad acco gliere le opere di "Magister Dominus Paulus Abbas de Flo rentia"- nel famoso codice che prende il nome dall'organista 1 P er brevità i principali mss. saranno dtati con le sigle in uso fra gli .specialisti di questo periodo di storia musicale qui riportate, per comodità dei lettori, in ordine alfabetico: FL = Firenze, Laurenz. P alat. 87 (Squarcialupi). FP = Firenze, Bibl. N az., Panciatich. 26. Lo Londra, British Museum, add. mss. 29987. Mn frammenti a Lucca, Archivio di Stato e Perugia. Bibl. Comunale (cod. Mancini). p P arigi, Bibl. Nationale, fonds ital. 568. PR = Parigi, Bibl. Nationale, nouv. acq. frç . 6771. 37 [l] 5 78 ESTUDIOS DEDICADOS A D. RAMON MENÉNDEZ PIDAL mediceo Antonio Squarcialupi, il Laurenziano Palat. 87 (FL) 1. un solo "Madriale di don paghollo" è contenuto in un altro manoscritto, il cod. add. mss. 29987 del British Museum (Lo ), anch'esso da porre in relazione con i Medici z. E poichè altret tanto accade per le fonti non toscane, clacchè un solo codice, proveniente dall'Italia settentrionale (PR), contiene una bal lata "Dompni Pauli", del nostro musicista poco più che il nome, la patria e la qualità di abate ci sarebbe noto senza il provvidenziale contributo di un ultimo codice toscano. -

Apéndice - Principales Manuscritos Musicales Medievales
Rafael Fernández de Larrinoa [email protected] APÉNDICE - PRINCIPALES MANUSCRITOS MUSICALES MEDIEVALES POLIFONÍA PRIMITIVA (Tratados con ejemplos musicales) Bamberg, SB, Msc. Var. l Musica enchiriadis y Scholia enchiriadis (ca. 900). Originarios de Reims. Primera descripción de (alt HJ IV 20). la polifonía en movimiento paralelo. Con ejemplos en notación dasiana. Varios manuscritos. Micrologus , de Guido d’Arezzo (ca. 1030). Uno de los tratados musicales más influyentes y más difundidos de la Edad Media, se conserva en más de 70 manuscritos de entre los siglos XI al XV. Primera descripción del movimiento contrario para (junto con el oblicuo) cerrar las frases del organum . Con ejemplos musicales. http://www.music.indiana.edu/tml/9th-11th/GUIMIC_TEXT.html Milán, BA, M. 17 sup. Ad organum faciendum [tratado de organum de Milán] (ca. 1100). Descripción de cómo componer organa en estilo discanto. Se emplea casi exclusivamente el movimiento contrario salvo en los finales de frase, en el que se utiliza también el paralelo y el oblicuo. Con ejemplos en notación alfabética. http://www.music.indiana.edu/tml/9th-11th/ADORFA_TEXT.html http://www.musicologie.org/Biographies/a/ad_organum.html http://puffin.cch.kcl.ac.uk:8080/diamm/Source.jsp?navToggle=1&sourceKey=926 Roma, BAV, Ottoboni lat. Ars organi [tratado de organum vaticano] (ca. 1170 -1180). Método para la composición de 3025 organa floridos. Con ejemplos en notación diastemática. http://www.music.indiana.edu/tml/12th/ARSORG_TEXT.html POLIFONÍA PRIMITIVA (Repertorios musicales) Cambridge, CCC, MS 473 ca. 1000. Contiene 150 organa a 2 voces que exhiben principalmente movimiento paralelo, (Tropario de Winchester) reservándose el contrario y el oblicuo para los finales de frase. -

Komponieren in Italien Um 1400. Studien Zu Dreistimmig
Philomusica on-line 13 (2014) – Recensioni SIGNE ROTTER-BROMAN Komponieren in Italien um 1400. Studien zu dreistimmig überlieferten Liedsätzen von Andrea und Paolo da Firenze, Bartolino da Padova, Antonio Zacara da Teramo und Johannes Ciconia Georg Olms Verlag, Hildesheim, 2012 („Musica Mensurabilis“ 6) pp. IX, 463, es. mus. Review by Maria Caraci Vela Università di Pavia-Cremona [email protected] «Philomusica on-line» – Rivista del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali e-mail: [email protected] – Università degli Studi di Pavia <http://philomusica.unipv.it> – ISSN 1826-9001 – Copyright © 2014 Philomusica on-line – Pavia University Press Philomusica on-line 13 (2014) his is the sixth volume in the series “Musica Mensurabilis”, directed by T Oliver Huck and published by Olms (Hildesheim). It re-elaborates, integrates and reformulates the results of various researches carried out by the author in recent years on Italian Trecento music, which have been published in specialized periodicals and miscellanies such as: — Die Grenzen der Dreistimmigen Trecento-Satztechnik. Zur Mehrfachüberlieferung von Ballaten und Madrigalen in Italien um 1400 — Geschichtsbild(2007); und Analyse. Überlegungen zur musik des späten Trecento (2007); — Musikzeit und Textzeit in Ballaten des späten des Trecento (2008); — Was there an Ars Contratenoris in the Music of the Late Trecento? (2008); — Temporal Process in Ballatas of the Late Trecento: The Case of Andrea da Firenze’s Non più doglie ebbe Dido (2010); — Analyse – Meistererzählungen – Geschichtsbilder, Zum Zusammenhang zwishcen Historiographic uns Analyse der Musik des späten Mittelalters (2010); — Zur Funktion musikhistorischer Master narratives für musikalische Analysen (2012). The author’s methods and ideas, which are amply illustrated in the above- mentioned contributions, are quite well-known to musicologists concerned with the Middle Ages, and have given rise at times to favourable appreciation as well as reservations, as is normal in the on-going debate within every discipline. -

UNIVERSITY of OREGON • SCHOOL of MUSIC Vielle with Margriet Tindemans
Cecilia, the Clemencic Consort (Vienna), Studio de la Musique Ancienne de Montréal, and La Fontegara (Mexico). She has taught voice at Harvard and Brown Universities, been a guest lecturer at Wellesley and Bowdoin Colleges, and has taught workshops in medieval music from Vancouver to Mexico City. In addition to singing, Knutson is a doctor of chiropractic with a private practice in the Boston area. Shira Kammen has spent well over half her life performing and teaching music. She received her degree in music from UC Berkeley and studied UNIVERSITY OF OREGON • SCHOOL OF MUSIC vielle with Margriet Tindemans. A member for many years of Ensemble Alcatraz, Ensemble Project Ars Nova, and Medieval Strings, she has also Beall Concert Hall Saturday evening worked with many other ensembles including Sequentia, Hesperion XX, the 8:00 p.m. November 6, 2004 Boston Camerata, the King’s Noyse, Magnifi cat Baroque Orchestra, Teatro Bacchino, and is the founder of Class V Music, a group created to perform on rafting trips. For fi fteen years Kammen happily collaborated with singer/ storyteller John Fleagle. Along with Fortune’s Wheel, she currently works with the contemporary music ensemble, Ephemeros, and Trouz Bras, a group UNIVERSITY OF OREGON devoted to the dance music of Celtic Brittany. Robert Mealy has received much critical acclaim for his eloquent and SCHOOL OF MUSIC imaginative performances on a wide variety of historical strings: he performs around the world on baroque violin, renaissance violin, lira da braccio, and GUEST ARTIST SERIES medieval vielle and harp. He has recorded over fi fty CD’s with groups like Les Arts Florissants, Sequentia, the King’s Noyse, and the Boston Camerata.