Kopie Von Diplomarbeit 07.03.2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ICLA 2016 – Abstracts General Conference Sessions, July 17Th, 2016
ICLA 2016 – Abstracts General Conference Sessions, July 17th, 2016 ICLA 2016 – Abstracts General Conference Sessions Content Fri, July 22nd, 09:00, Urmil Talwar , C. Many cultures, many idioms ..................................................... 7 Fri, July 22nd, 11:00, Marjanne Gooze, D. The language of thematics ................................................... 8 Fri, July 22nd, 11:00, Marta Teixeira Anacleto, D. The language of thematics ....................................... 9 Fri, July 22nd, 18:00, no chair yet, E. Comparatists at work - professional communication ................ 11 Fri, Huly 22nd, 16:00, no chair yet, C. Many cultures, many idioms ..................................................... 11 Fri, July 22nd, 11:00, no chair yet, D. The language of thematics ......................................................... 12 Fri, July 22nd, 14:00, no chair yet, D. The language of thematics ......................................................... 13 Fri, July 22nd, 09:00, no chair yet , C. Many cultures, many idioms ..................................................... 14 Fri, July 22nd, 11:00, Yiu-wai Chu , C. Many cultures, many idioms ..................................................... 15 Fri, July 22nd, 14:00, Gabriele Eckart, C. Many cultures, many idioms ................................................ 17 Fri, July 22nd, 16:00, Nagla Bedeir, E. Comparatists at work - professional communication ............... 18 Fri, July 22nd, 09:00, no chair yet, D. The language of thematics ........................................................ -

Branka Radović SEARCHING for the IDENTITY of THE
Article received on October 10, 2005 UDC 78.071(047.53) Branka Radović SEARCHING FOR THE IDENTITY OF THE COMPOSER AND MAN AN INTERVIEW WITH RASTISLAV KAMBASKOVIĆ Rastislav Kambasković was born in Prokuplje in 1939, graduated from the Departments of Theory and Composition (the class of V. Mokranjac) of the Music Academy in Belgrade, obtained his MA degree at the Department of Composition (P. Milošević). He was a long-standing programme editor and music producer at Radio Belgrade and then professor at the Department of Theory of the Faculty of Music and was twice elected Dean for Academic Affairs. In his rather small, albeit diverse oeuvre, he tried his skill in a number of genres, from solo, vocal and chamber music to symphonic and vocal- instrumental music, only to become more focused on opera in recent years. He is the recipient of numerous awards of the Serbian Composers’ Association and RTV Belgrade, as well as of the BEMUS Award. There are many reasons for this interview, first and foremost your jubilee, and also the fact that the opera Hasanaginica, on which you have been working for the past few years, has still not been performed. I would much rather the occasion for this interview were a stage premiere, a concert presentation, a recording, a television production… but seeing as that is not the case, can you tell me what inspired the interest in opera at your mature age? The interest in that music-scenic genre was kindled in me already in my high school days. The fever among musicians in that far 1956, caused by the efforts of the then music activists in Niš, principally Ilija Marinković, PhD, composer and conductor of the Symphonic orchestra, and professor Stevan Guščin, conductor of the city choir in Niš, to stage the first opera in Niš (Verdi’s Rigoletto), most of its performers being from the local, Niš area, gripped me, too. -

STECSP-8.Pdf
Уредништво Др РАСТКО ВАСИЋ Др ИВАН ЈОРДОВИЋ Др СНЕЖАНА ФЕРJАНЧИЋ Др СВЕТОЗАР БОШКОВ Др КСЕНИЈА МАРИЦКИ ГАЂАНСКИ, главни уредник Лого РИМСКА БОГИЊА ДИЈАНА Аутор ДАМЈАН ВАСИЋ графички дизајнер Одржавање Међународног скупа и припрему ове књиге су помогли МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АРХИВ СРЕМА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДРУШТВО ЗА АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ СРБИЈЕ АНТИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ: ТУМАЧЕЊЕ АНТИКЕ Зборник радова ДРУШТВО ЗА АНТИЧКЕ СТУДИЈЕ СРБИЈЕ БУКЕФАЛ E.O. Н. Научне публикације Друштва за античке студије Србије Едиција Антика и савремени свет Том 1: Антика и савремени свет, 2007, стр. 404 Скуп одржан 2006. године Том 2: Европске идеје, античка цивилизација и српска култура, 2008, стр. 496 Скуп одржан 2007. године Том 3: Антички свет, европска и српска наука, 2009, стр. 432 Скуп одржан 2008. године Том 4: Античка култура, европско и српско наслеђе, 2010, стр. 508 Скуп одржан 2009. године Том 5: Антика и савремени свет: култура и религија, 2011, стр. 507 Скуп одржан 2010. године Том 6: Антика, савремени свет и рецепција античке културе, 2012, стр. 524 Скуп одржан 2011. године Том 7: Антика и савремени свет: научници, истраживачи и тумачи 2012, стр. 350 Скуп одржан 2012. године Том 8: Антика и савремени свет: тумачење антике, 2013; стр. 472 Скуп одржан 2013. године Proceedings of the Serbian Society for Ancient Studies Series Antiquity and Modern World Antiquity and Modern World, Proceedings of the Serbian Society for Ancient Studies,Vol. I, Belgrade 2007, pp. 404 European Ideas, Ancient Civilization and Serbian Culture, Proceedings of the Serbian So- ciety for Ancient Studies, Vol. II, Belgrade 2008, pp. 496 Ancient World, European and Serbian Scholarship, Proceedings of the Serbian Society for Ancient Studies, Vol. -

Normativna Baza Podataka CONOR.SR
PUNOPRAVNI ČLANOVI SISTEMA COBISS.SR I NJIHOVO UČEŠĆE U SISTEMU UZAJAMNE KATALOGIZACIJE Normativna baza podataka CONOR.SR Broj zapisa na dan 31. decembra 2018. 24. 01. 2019 Doprinos zapisa u CONOR.SR u 2018. Broj Ukupni Broj Od toga kreatora doprinos u prisvojenih Red. br. Naziv institucije/biblioteke Uključena Ukupno Kreirani Preuzeti u 2018. CONOR.SR zapisa 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 291 291 0 4 537 0 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 12 12 0 7 272 0 Ukupno 303 303 0 *11 809 0 UNIVERZITETSKE I VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE 1. Agronomski fakultet, Čačak 10/2011 0 0 0 0 0 0 2. Akademija umetnosti, Novi Sad 11/2011 0 0 0 0 0 0 3. Arhitektonski fakultet, Beograd 02/2003 0 0 0 0 0 0 4. Biološki fakultet, Beograd 01/2010 0 0 0 0 0 0 5. Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd 07/2004 0 0 0 0 0 0 6. Državni univerzitet u Novom Pazaru 01/2012 0 0 0 0 0 0 7. Ekonomski fakultet, Beograd 09/2004 0 0 0 0 0 0 8. Ekonomski fakultet, Kragujevac 08/2006 0 0 0 0 0 0 9. Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd 05/2004 0 0 0 0 0 0 10. Fakultet bezbednosti, Beograd 05/2005 0 0 0 0 0 0 11. Fakultet dramskih umetnosti, Beograd 01/2018 0 0 0 0 0 0 12. Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac 03/2004 0 0 0 0 0 0 13. Fakultet likovnih umetnosti, Beograd 02/2003 0 0 0 0 0 0 14. -

Sretenovic Dejan Red Horizon
Dejan Sretenović RED HORIZON EDITION Red Publications Dejan Sretenović RED HORIZON AVANT-GARDE AND REVOLUTION IN YUGOSLAVIA 1919–1932 kuda.org NOVI SAD, 2020 The Social Revolution in Yugoslavia is the only thing that can bring about the catharsis of our people and of all the immorality of our political liberation. Oh, sacred struggle between the left and the right, on This Day and on the Day of Judgment, I stand on the far left, the very far left. Be‑ cause, only a terrible cry against Nonsense can accelerate the whisper of a new Sense. It was with this paragraph that August Cesarec ended his manifesto ‘Two Orientations’, published in the second issue of the “bimonthly for all cultural problems” Plamen (Zagreb, 1919; 15 issues in total), which he co‑edited with Miroslav Krleža. With a strong dose of revolutionary euphoria and ex‑ pressionistic messianic pathos, the manifesto demonstrated the ideational and political platform of the magazine, founded by the two avant‑garde writers from Zagreb, activists of the left wing of the Social Democratic Party of Croatia, after the October Revolution and the First World War. It was the struggle between the two orientations, the world social revolution led by Bolshevik Russia on the one hand, and the world of bourgeois counter‑revolution led by the Entente Forces on the other, that was for Cesarec pivot‑ al in determining the future of Europe and mankind, and therefore also of the newly founded Kingdom of Serbs, Cro‑ ats and Slovenes (Kingdom of SCS), which had allied itself with the counter‑revolutionary bloc. -

Normativna Baza Podataka CONOR.SR
PUNOPRAVNI ČLANOVI SISTEMA COBISS.SR I NJIHOVO UČEŠĆE U SISTEMU UZAJAMNE KATALOGIZACIJE Normativna baza podataka CONOR.SR Broj zapisa na dan 31. decembra 2017. 15. 01. 2018 Doprinos zapisa u CONOR.SR u 2017. Broj Ukupni Broj Od toga kreatora doprinos u prisvojenih Red. br. Red. Naziv institucije/biblioteke Uključena Ukupno Kreirani Preuzeti u 2017. CONOR.SR zapisa 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 60 60 0 4 246 0 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 59 59 0 7 260 0 Ukupno 119 119 0 *11 506 0 UNIVERZITETSKE I VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE 1. Agronomski fakultet, Čačak 10/2011 0 0 0 0 0 0 2. Akademija umetnosti, Novi Sad 11/2011 0 0 0 0 0 0 3. Arhitektonski fakultet, Beograd 02/2003 0 0 0 0 0 0 4. Biološki fakultet, Beograd 01/2010 0 0 0 0 0 0 5. Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd 07/2004 0 0 0 0 0 0 6. Državni univerzitet u Novom Pazaru 01/2012 0 0 0 0 0 0 7. Ekonomski fakultet, Beograd 09/2004 0 0 0 0 0 0 8. Ekonomski fakultet, Kragujevac 08/2006 0 0 0 0 0 0 9. Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd 05/2004 0 0 0 0 0 0 10. Fakultet bezbednosti, Beograd 05/2005 0 0 0 0 0 0 11. Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac 03/2004 0 0 0 0 0 0 12. Fakultet likovnih umetnosti, Beograd 02/2003 0 0 0 0 0 0 13. Fakultet muzičke umetnosti, Beograd 02/2006 0 0 0 0 0 0 14. -

Članovi Društva Matematičara Srbije
Članovi Društva matematičara Srbije Red. br. Br. čl. karte Prezime Ime Škola Mesto škole Podružnica Tekuća uplata 1 1 Mićić Vladimir POČASNI ČLAN DMS Beograd DMS 2 2 Zolić Arif POČASNI ČLAN DMS Beograd DMS 3 3 Marjanović Milo POČASNI ČLAN DMS Beograd DMS 4 4 Tošić Ratko POČASNI ČLAN DMS Novi Sad DMS 5 5 Dimitrijević Radoslav POČASNI ČLAN DMS Niš DMS 6 110001 Kadelburg Zoran Matematički fakultet Beograd BEOGRAD 7 110002 Lipkovski Aleksandar Matematički fakultet Beograd BEOGRAD 8 110003 Mladenović Pavle Matematički fakultet Beograd BEOGRAD 9 110004 Dragović Vladimir Matematička gimnazija Beograd BEOGRAD 10 110005 Babić Milica Društvo matematičara Srbije Beograd BEOGRAD 11 110006 Pavlićević Ružica OŠ "Drinka Pavlović" Beograd BEOGRAD 12 110007 Pavlićević Dragana OŠ "Ruđer Bošković" Beograd BEOGRAD 13 110008 Stojanović Mirjana OŠ "Drinka Pavlović" Beograd BEOGRAD 14 110009 Đelić Biljana OŠ "Drinka Pavlović" Beograd BEOGRAD 15 110010 Jevremović Olivera OŠ " Dr Arčibald Rajs" Beograd BEOGRAD 16 110011 Lukić Dušica OŠ "Dr Arčibald Rajs" Beograd BEOGRAD Thursday, February 15, 2018 Page 1 of 168 Red. br. Br. čl. karte Prezime Ime Škola Mesto škole Podružnica Tekuća uplata 17 110012 Lalović Željka OŠ "Vasa Pelagić" Beograd BEOGRAD 18 110013 Milivojčević Miroljub Viša građ.-geodetska škola Beograd BEOGRAD 19 110014 Jordanov Stojanka OŠ "Vožd Karađorđe" Beograd BEOGRAD 20 110015 Kadžiibanov Vera OŠ "Branislav Nušić" Beograd BEOGRAD 21 110016 Ljubić Javorka OŠ "Branislav Nušić" Beograd BEOGRAD 22 110017 Belča Jelena OŠ "Branislav Nušić" Beograd BEOGRAD -

Architectural Work of Aleksandar Deroko – Beauty of Emotional Creativity
S A J _ 2019 _ 11 _ admission date 08 06 2018 original scientific article approval date 15 01 2019 UDC 72.071.1 Дероко А. ARCHITECTURAL WORK OF ALEKSANDAR DEROKO – BEAUTY OF EMOTIONAL CREATIVITY A B S T R A C T This paper studies significant and forgotten, but not less important, built and unrealised designs by Serbian architect Aleksandar Deroko. It seeks to achieve a continuous view in dealing with Deroko`s architectural work versus the historical discontinuity of political, territorial-geographic and social circumstances. It is impossible to separate Deroko as an architect from Deroko as a scholar, researcher, historian of architecture and art, an academic professor, painter, artist, writer, chronicler of his time, protector, conservator and historiographer of Serbian cultural heritage. The main aim of this paper is to apply comprehensive research approach within which his work in the field of architectural design will be considered in a complementary and pluralistic way. Deroko’s architectural projects examined in their details and altogether represent distillate of Deroko’s erudite personality, which casts shadow on relevant questions of Serbian history of architecture placement: How to understand it, observe and examine it, from Yugoslav or Serbian perspective, from the position of continuity or discontinuity, through characteristics of general or particular? Irena Kuletin Ćulafić 1 University of Belgrade - Faculty of Architecture [email protected]; [email protected] key words designs of aleksandar deroko historical and cultural aspect aesthetic aspect vernacular architecture medieval serbian architecture modernism plurality of meaning S A J _ 2019 _ 11 _ INTRODUCTION Today, thirty years after the death of Professor Deroko, much has been forgotten about this fascinating Belgrade architect. -

Vorbemerkung Des Herausgebers 5 Vorwort 7 Laza Kostic Santa Maria
Vorbemerkung des Herausgebers 5 Vorwort 7 Laza Kostic Santa Maria della Salute - Zoran Konstantinovic/Atmemarie Bostroem . 37 Aleksa Santic Meine Nacht - Reinhard Lauer 42 Abend am Skolj - Annemarie Bostroem 43 Meine Väter - Annemarie Bostroem 44 Luzifer - Annemarie Bostroem 45 Jovan Ducic Pappeln - Uwe Grüning 46 Gesang an die Frau - Uwe Grüning 47 Grenze - Uwe Grüning 48 Dubrovniker Requiem - Uwe Grüning 49 Rückkehr - Uwe Grüning 50 Warten - Uwe Grüning 51 Mann und Hund - Uwe Grüning 52 Gebet - Uwe Grüning 53 Milan Rakic Es fällt der Tau... - Reinhard Lauer 54 Jefimija - Annemark Bostroem 55 Espe - Annemarie Bostroem 56 Erbe - Annemarie Bostroem 58 Velimir Rajic Vor dem Lenz - Astrid Philippsen 59 Letzter Wille - Astrid Philippsen 60 Vladislav Petkovic-Dis Unsere Tage - Astrid Philippsen 62 Vielleicht schläft sie - Astrid PMippsen 64 Nirwana - Astrid Philippsen 66 Sima Pandurovic Ein Festtag - Hans-Joachim Brandstäter 68 Jamben der Vollendung - Hans-Joachim Brandstäter 70 Milutin Bojic Schönheit - Brigitte Stmzyk 71 Das blaue Grab - Brigitte Strupfe 73 Milos Crnjanski Prolog - Annemarie Bostroem 76 Epilog - Cornelia Marks/Andre Schinkel 77 Serenade - Annemarie Bostroem 78 Sumatra - Annemarie Bostroem 79 Strazllovo - Cornelia Marks/Annemarie Bostroem 80 Stanislav Vinaver Klingende Landschaft - Annemarie Bostroem 89 Augenblick der Sonnenblume- Annemarie Bostroem 90 Arabeske- Annemarie Bostroem . 91 Traumfluß - Annemarie Bostroem 92 Momälo Nastasijevic Hirtenflöte - Waltraud Jähnkhen 93 Espen - Waltraud Jähnkhen 94 Abenddämmerung - Waltraud -

Serbica » P O É
♦ Bibliothèque « Serbica » ♦ www.serbica.fr LES POÈTES DE LA GRANDE GUERRE ПЕСНИЦИ ВЕЛИКОГ РАТА PESNICI VEKOG RATA CHOIX DE POÈMES par Boris Lazić Traduits du serbe par Miodrag Ibrovac, Boris Lazić et Kolja Mićević Juillet 2014 ♦ P o é s i e ♦ Les Poètes de la Grande Guerre La Ballade des encore vivants www.serbica.fr SOMMAIRE VLADISLAV PETKOVIĆ DIS (1880-1917) Fleurs de la gloire / Cvetovi slave (Traduit par Boris Lazić) MILUTIN JOVANOVIĆ (1881-1935) Après la bataille / Posle bitke (Traduit par Miodrag Ibrovac) TODOR MANOJLOVIĆ (1883-1968) Souvenirs de guerre (Traduit par Miodrag Ibrovac) Rencontres / Susreti (Traduit par Boris Lazić) STANISLAV VINAVER (1891-1955) Ranisav l’insecte / Ranisav Buba (Traduit par Boris Lazić) TIN UJEVIĆ (1891-1955) Complainte quotidienne / Svakidašnja jadikovka (Traduit par Boris Lazić) IVO ANDRIĆ (1892-1975) 1915 (Traduit par Kolja Mićević) MILUTIN BOJIĆ (1892-1917) Le tombeau bleu / Plava grobnica (Traduit par Svetislav Petrović et Miodrag Ibrovac) MILOŠ CRNJANSKI (1893-1977) Hymne / Himna Memorial de Princip / Spomen Principu (Traduit par Boris Lazić) 1 Les Poètes de la Grande Guerre La Ballade des encore vivants www.serbica.fr MOMČILO NASTASIJEVIĆ (1894-1938) La trompette / Truba (Traduit par Boris Lazić) RASTKO PETROVIĆ (1898-1949) Le poète sur les eaux / Pesnik na vodama (Traduit par Boris Lazić) RADE DRAINAC (1899-1943) L’amante nommée catastrophe / Ljubavnica koja se zove katastrofa (Traduit par Boris Lazić) DUŠAN VASILJEV (1900-1924) L’homme chante après la guerre / Čovek peva posle rata (Traduit par Kolja Mićević) 2 Les Poètes de la Grande Guerre La Ballade des encore vivants www.serbica.fr VLADISLAV PETKOVIĆ DIS (1880-1917) FLEURS DE LA GLOIRE / CVETOVI SLAVE Ils dorment tous alignés l’un auprès de l’autre, Sans leur linceul et couverts de misère Les mains croisées, dans un ridicule sépulcre, Et pourrissent paisibles comme dans une bière. -
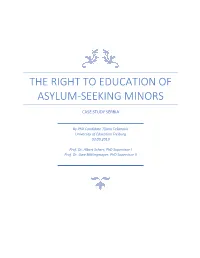
The Right to Education of Asylum-Seeking Minors
THE RIGHT TO EDUCATION OF ASYLUM-SEEKING MINORS CASE STUDY SERBIA By PhD Candidate Tijana Tešanović University of Education Freiburg 03.09.2019 Prof. Dr. Albert Scherr, PhD Supervisor I Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer, PhD Supervisor II The Right to Education of Asylum-Seeking Minors Case Study Serbia Von der Pädagogischen Hochschule Freiburg zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation Von Tijana Tešanović aus Novi Sad, Serbien Promotionsfach: Soziologie Erstgutacher: Prof. Dr. Albert Scherr Zweitgutachter: Prof. Dr. Uwe H. Bittlingmayer Tag der mündlichen Prüfung: 03. März 2020 Acknowledgements Foremost, I would like to express my eternal gratitude to my PhD mentor, Prof. Dr. Albert Scherr, for his trust in me and my research proposal back in Spring 2015 when I contacted him with a kind request to supervise my research, and for choosing me to be one of his students. I feel blessed to have found such an expert, who has provided his unconditional support throughout the whole process. Not only did he provide his expertise and valuable advice whenever I needed it, but he also supported me in my professional engagements and, among other things, wrote recommendation letters. One of which secured me the Erasmus + Traineeship scholarship and excellent academic position with the Vienna Master of Arts in Human Rights at the University of Vienna. I could not have imagined having a better mentor and for this I stay eternally deeply indebted. In addition, I would also like to thank Prof. Dr. Uwe Bittlingmayer, who acted in a supervisor capacity as well. He took the time to see me when I needed him and for his valuable and insightful comments and guidance. -
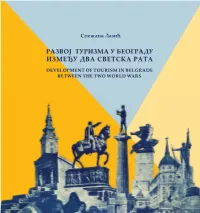
РАЗВОЈ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ Између Два Светска Рата Development of Tourism in Belgrade Between the Two World Wars
снежана Лазић РАЗВОЈ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ ИЗМЕђУ ДВА сВЕТскА РАТА development of tourism in Belgrade Between the two world wars Издавач Историјски архив Београда Палмира Тољатија 1 Београд www.arhiv-beograda.org За издавача Мр Драган Гачић Главни и одговорни уредник Мр Драган Гачић Аутор Снежана Лазић Рецензент Др Весна Алексић Лектор Мр Наташа Николић Превод на енглески Тијана Ковчић Ликовно-графичко решење Зорица Нетај Тираж 500 Штампа ТИПОГРАФИК ПЛУС д.о.о. Земун Издавање публикације реализовано уз подршку Секретаријата за културу Града Београда Снежана Лазић РАЗВОЈ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ између два светска рата кроз документа Историјског архива Београда Београд, 2017 РАЗВОЈ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА 5 6 DEVELOPMENT OF TOURISM IN BELGRADE BETWEEN THE TWO WORld WARS Истражујући богату грађу фондова Историјског архива Београда, за потребе реализације изложбе,1 којом је обележено 80 година од проглашења Београда за туристичко место у ужем смислу (22. децембра 1936), ауторка Снежана Лазић, виши архивиста, излази из оквира изложбене поставке и приређује ову значајну публикацију, у којој на целовит и свеобухватан начин расветљава историјске околности и аспекте развоја туризма између два светска рата, како у Београду тако и у Краљевини СХС/Југославији. Двојезична (српско-енглеска) богато илустрована публикација Развој туризма у Београду између два светска рата, заслужује сваку пажњу домаће и стране јавности. Ауторка је уложила велики напор, али очито и своју страст и љубав према путовањима и туризму, да нас проведе кроз време и подсети на међуратни Београд, на услове и разлоге настајања организованог туризма у престоници, какви смо били домаћини, али и какви смо били као туристи. Зналачки састављена структура публикације стручно нас води од прве историјске грађе о организованом доласку страних туриста у Београд и почетака туризма у Србији са краја ХIХ века, преко општих услова за развој туризма, до организоване туристичке делатности и законских прописа утемељених крајем 30-их година ХХ века.