Seite 44.79, Rætikon | Elexikon
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2021 Übersichtsflyer Mehrsprachig Parc
Was ist ein Naturpark Exkursionen und Veranstaltungen Regionale Produkte Parc Ela What is a nature park | C’est quoi un parc naturel | Cos’è un parco naturale Excursions and events | Excursions et événements | Escursioni e manifestazioni Regional products | Produits régionaux | Prodotti regionali — Ein Naturpark zeichnet ich durch verschiedenste Lebensräume — Lassen Sie sich von der artenreichen Flora und Fauna über- — Entdecken Sie die feine Auswahl an regionalen Produkten — Der grösste Naturpark der Schweiz mit einer reichen Flora und Fauna sowie vielfältigen Kulturgütern raschen: über 70 Säugetiere, darunter grosse Bestände an Steinwild, aus dem Naturpark. Die Parc Ela-Produkte (80% Rohstoffe aus dem Die abwechslungsreiche Landschaft rund um die Alpenpässe Albula, aus. 2012 wurde der Parc Ela mit dem Label «Regionaler Naturpark» Hirschen und Rehe sowie eine grosse Pflanzenvielfalt. Entdecken Park) sind in den verschiedensten Hof- und Dorfläden erhältlich. Julier und Septimer bezaubert durch ihren ursprünglichen Charakter, ausgezeichnet. In der Schweiz gibt es noch 15 weitere. Die Park- Sie imposante Bauwerke und Kulturgüter oder die reiche Natur mit — Discover the fine selection of regional products from the nature die intakten Dörfer und die lebendige Kultur, die sich aus Romanisch, bevölkerung setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung ein – ohne unseren Wander- und Exkursionsleitenden. park. Parc Ela products (80% of raw materials from the park) are Deutsch und Italienisch zusammensetzt. Die 6 Parkgemeinden zusätzliche Verbote und Gebote. — Be surprised by the species-rich flora and fauna: more than 70 available in various farm and village shops. setzen sich dafür ein, dass Natur und Landschaft erhalten bleiben — A nature park is characterised by a wide variety of habitats with mammals, including large populations of ibex, deer and roe deer, as — Découvrez la succulente sélection de produits régionaux du parc und die nachhaltige regionale Wirtschaft gestärkt wird. -

A Hydrographic Approach to the Alps
• • 330 A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS A HYDROGRAPHIC APPROACH TO THE ALPS • • • PART III BY E. CODDINGTON SUB-SYSTEMS OF (ADRIATIC .W. NORTH SEA] BASIC SYSTEM ' • HIS is the only Basic System whose watershed does not penetrate beyond the Alps, so it is immaterial whether it be traced·from W. to E. as [Adriatic .w. North Sea], or from E. toW. as [North Sea . w. Adriatic]. The Basic Watershed, which also answers to the title [Po ~ w. Rhine], is short arid for purposes of practical convenience scarcely requires subdivision, but the distinction between the Aar basin (actually Reuss, and Limmat) and that of the Rhine itself, is of too great significance to be overlooked, to say nothing of the magnitude and importance of the Major Branch System involved. This gives two Basic Sections of very unequal dimensions, but the ., Alps being of natural origin cannot be expected to fall into more or less equal com partments. Two rather less unbalanced sections could be obtained by differentiating Ticino.- and Adda-drainage on the Po-side, but this would exhibit both hydrographic and Alpine inferiority. (1) BASIC SECTION SYSTEM (Po .W. AAR]. This System happens to be synonymous with (Po .w. Reuss] and with [Ticino .w. Reuss]. · The Watershed From .Wyttenwasserstock (E) the Basic Watershed runs generally E.N.E. to the Hiihnerstock, Passo Cavanna, Pizzo Luceridro, St. Gotthard Pass, and Pizzo Centrale; thence S.E. to the Giubing and Unteralp Pass, and finally E.N.E., to end in the otherwise not very notable Piz Alv .1 Offshoot in the Po ( Ticino) basin A spur runs W.S.W. -

Schweizer Alpen-Club SAC Schweizer Club Alpin Suisse Club Alpino Svizzero Alpen-Club SAC Club Alpin Svizzer 100 Jahre Vereinsgeschichte Der Sektion
Sektion Arosa Schweizer Alpen-Club SAC Schweizer Club Alpin Suisse Club Alpino Svizzero Alpen-Club SAC Club Alpin Svizzer 100 Jahre Vereinsgeschichte der Sektion 1 Inhalts- verzeichnis Vorwort des Naturschutz 2 Verfassers 34 Vereinsgeschichte Vortragswesen 5 der Sektion 35 Die ersten Jahre Und dann noch das 6 der Sektion Arosa 36 9 Bibliothek 39 Die Ramozhütte 10 Klublokal 44 Jugendorganisation (JO) Rettungsstation – Rettungs- Tourenwesen 11 48 kolonne – Rettungsdienst Interview mit drei Ausblick 30 Clubmitgliedern 53 Vorwort des Verfassers Hanspeter Pitschi Autor ur Vorbereitung dieser Festschrift Die initiativen Einwohner hatten das Elektrizitäts- und zwar als touristische Dienstleistung. Auch das Zi habe ich Hunderte von Protokollen werk gebaut, den Bau der Chur-Arosa-Bahn ini- Bergführerwesen hatte im Gebirgskurort Arosa und auch viele Jahres berichte gelesen. Die tiiert, Sanatorien, Hotels und Pensionen errichtet einen höheren Stellenwert als in der Stadt Chur, und betrieben. 1885 war der Kur- und Verkehrs- da wollte man als Touristiker mitreden. Den Natur- Fülle an Informationen kann unmöglich verein gegründet worden. Seine Aufgabe bestand schutz als wichtiges Anliegen des SAC wollte man in dieser kleinen Festschrift Platz finden. in den ersten Jahren darin, den Kurgästen Wander- vor Ort angehen. Aber schlussendlich gab für die Das Vereins leben nach der Gründung wege zur Verfügung zu stellen. Die erste Anschaf- Gründung der Sektion doch die persönliche Berg- hat sich beim Lesen aber belebt, und mich fung war deshalb ein Pickel und eine Schaufel. begeisterung den entscheidenden Impuls. haben der Pioniergeist, die Leidenschaft Der Verein sorgte dafür, dass die Poststrasse von für die Berge und die Liebe zur Natur Langwies nach Arosa gebaut wurde, und er war im Allen voran soll hier der Gründungspräsident sehr beein druckt. -

Luftseilbahn Gondelbahn Schienen-Rodelbahn Restaurant
Mon 1231m Bergün St. Moritz Albula Savognin Julierpass Surava 904m Filisur 1032m Tiefencastel 851m Stierva 1375m Piz Linard 2768m Luftseilbahn Brienz/Brinzauls 1144m Mutten 1395m Alvaneu Bad 957m Vazerol 1125m Lenzerhorn 2906m Gondelbahn Davos Scasaluir 2200m Solas 1122m Punt da Solas 1004m 6er Sesselbahn Alvaneu Dorf 1181m Landwasserviadukt Piz Mulain 2627m Alvaschein 1004m 206 4er Sesselbahn Schmitten GR 1301m 1411m A Lantsch/Lenz 1314m Muldain 1210m lbula 3er Sesselbahn 524 524 Thusis 597m Crap la Tretscha Parnegl 206 814m 2er Sesselbahn Aclas Dafora 1693m Zorten 1186m a l u Sils im Domleschg B Lain 1318m Chur Anlagen ausschliesslich 683m Pizza Naira 2870m 1430m Crap la Pala 2151m für Skifahrer und Snowboarder St. Cassian i La l Winterwanderweg ig Piz Scalottas 2323m 667m d n Fürstenaubruck i Piz Scalottas a Furcletta 2573m R 201A Tourenvorschläge Winterwandern Alp Sanaspans 2044m Aroser Rothorn 2980m Parpaner Rothorn 2865m Alp Fops 1886m Heidi und Gigi Weg 205 523 Rothorngipfel Scharans 766m Golf Restaurant Sporz 1585m 1790m Scalottas Neu Guggernell 2810m 205 Tgantieni Piz Danis 2497m Kulinarischer Höhenweg Tolles Bergpanorama auf 12 km, Kulinarischer Höhenweg kulinarische Spezialitäten in den 523 Bergrestaurants entlang des Weges Acla Grischuna Rothorn 2 Tgantieni 1747m Erzhorn 2924m 205 Alp Nova 1980m Schneeschuhroute 202 Alp Nova Erzhornsattel 2744m 202 524 Tourenvorschläge Schneeschuhlaufen 205 Val Sporz 202 Pedra Grossa 203 Lenzerheide 1475m 202 Avant Clavo Lavoz 2330m 522 Schlittelweg Scharmoin Scuntrada Totseeli 2396m Crest‘ -

MOUNTAIN SUMMER 2016 in AROSA Event Summer 2016
Visit us in winter 2016/17 and enjoy 225 km AUBACHER WERBEAGENTUR AUBACHER L of pistes just like Heidi and Gigi do! KÜTTEL KÜTTEL Event Summer 2016 JUNE 15.– 30. CULTURE SUMMER AROSA 23.– 25. TRAMPOLINE: NISSEN WORLD CUP 26. AROSA BEACH VOLLEYBALL TOURNAMENT 26. LÄNDLER (FOLK) MEETING JULY 01.– 31. Culture Summer Arosa Tennis: 13th Young Senior Open Arosa 01.– 03. Arosa at Züri-Fäscht 02.– 03. Motor Bike: Orienteering 03. Fistball Tournament 10.– 15. Football: referee training week Ice hockey: Ochsner Hockey Camps Tennis: 15th Intern. Senior Open Arosa 09.– 10. Floorball: 22nd 7eck-Cup Makes your heart beat faster. 16.– 17. Football: Fun tournament by the EHC fan clubs 22. Village market (alternative date: 23.7.) 23.– 24. Suzuki Swiss Beach Soccer League 31. Kids Land Open Air 30.– 31. Arosa Summer Party WINTER SEASON 2016/17: 3 DECEMBER 2016 TO 17 APRIL 2017 SUBJECT TO MODIFICATIONS AUGUST 01. National Day with high altitude bonfires NOVEMBER HIGH, 29 OCTOBER TO 27 NOVEMBER 2016: Ice hockey: Ochsner Hockey Camps ENJOY THE VIEW ACROSS THE SEA OF FOG AND THE FIRST TURNS 01.– 31. Culture Summer Arosa IN THE SNOW ON ALL NOVEMBER WEEKENDS. 05.– 07. Swiss Iron Trail MOUNTAIN SUMMER 2016 11.– 14. Arosa Jazz Days 14. Arosa Sports Relay 18.– 21. GrischaTrail RIDE 19.– 21. Arosa summer running days (prov.) IN AROSA 19.– 20. Handball entrepreneur forum 21.– 27. arosa music academy 22.– 24. Arosa BBQ get-together for guests Two Valley Golf Challenge Arosa Lenzerheide SEPTEMBER 01.– 30. Culture Summer Arosa 01.– 04. 12. Arosa ClassicCar, int. -
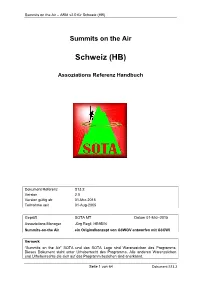
Summits on the Air – ARM V2.0 Für Schweiz (HB)
Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Summits on the Air Schweiz (HB) Assoziations Referenz Handbuch Dokument Referenz S13.2 Version 2.0 Version gültig ab 01-Mrz-2015 Teilnahme seit 01-Aug-2005 Geprüft SOTA MT Datum 01-Mrz–2015 Assoziations Manager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the Air ein Originalkonzept von G3WGV entworfen mit G3CWI Vermerk “Summits on the Air” SOTA und das SOTA Logo sind Warenzeichen des Programms. Dieses Dokument steht unter Urheberrecht des Programms. Alle anderen Warenzeichen und Urheberrechte die sich auf das Programm beziehen sind anerkannt. Seite 1 von 64 Dokument S13.2 Summits on the Air – ARM v2.0 für Schweiz (HB) Inhaltsverzeichnis 1 ÄNDERUNGSPROTOKOLL..................................................................................................................... 4 ASSOZIATIONS REFERENZ DATEN ........................................................................................................... 11 1.1 REGIONSEINTEILUNG ........................................................................................................................... 12 1.2 GENERELLE INFORMATIONEN .............................................................................................................. 12 1.3 KARTENMATERIAL ............................................................................................................................... 12 1.4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS ....................................................................................................................... 13 1.5 LETZTE WORTE................................................................................................................................... -

Tourenverzeichnis
Tourenverzeichnis Objekttyp: Group Zeitschrift: Jahresbericht / Akademischer Alpen-Club Zürich Band (Jahr): 46-47 (1941-1942) PDF erstellt am: 03.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch — 27 — Premier gendarme. Monter sur un bloc puis traverser environ 4 m à droite jusqu'à une fissure versant Moiry (délicat). Gagner ensuite le sommet du bloc sans difficultés (troisième degré). Deuxième gendarme. Monter sur le tranchant de l'arête puis à droite (ver- sant Moiry) au moyen d'une courte échelle et d'un piton (cinquième degré). On redescend de l'autre côté par un court rappel de 3 m. -

Switzerland's Grisons Alps'
Switzerland's Grisons Tour Code: 19340 Grade 6/FL Alps Holiday Duration: 14 nights HOLIDAY DATES Extend your time in Switzerland, combing 19th Jun 2019 - 3th Jul 2019 the alpine resorts of Arosa and Klosters Why not extend your time in the Swiss Alps by combining Alpine Arosa with Klosters, with magnificent hiking opportunities HOLIDAY HIGHLIGHTS Walk above the treeline and experience breathtaking views. A fantastic mix of walks from the doorstep combined with easy transport links. Explore a remote and undiscovered area of Switzerland. Enjoy easy access to over 400 miles of hiking trails. Ascend the Rätschenhorn (2703m), via the Saaser Calanda col, which offers fabulous views. Experience the ridge walk to the Weissfluh (2843m) with the possibility of traversing some easy snowfields. Switzerland's Grisons Alps' Arosa has all the ingredients for the perfect Alpine holiday. The village itself lies between 1700m and 1800m, so many walks start with a short ascent through trees, but beyond that the landscape opens into alpine meadows with peaks in every direction. Higher up you enter the realm of the ibex, and certainly for the higher grade options this is a peak-baggers dream. The Aroser Rothorn is a challenging walk reaching nearly 3000m, but there are lesser peaks such as the Schiesshorn, Weisshorn, Tiejer Flue and Matlishorn. The attraction of the area extends beyond these peaks to the remote valleys and ridges and the pretty villages such as Tschiertchen. The beautiful grassy ridge above Langwies is a joy and the remote walk passing the tiny collection of barns at Alp Farur is both wild and charming. -

Bike-Panoramakarte
Touren Enduro Touren Genuss Touren Familien Bergstation Scharmoin 1904m Scharmoin 144 1 WELSCHTOBEL-TOUR 8 LENZ RUNDE 9 HÖRNLI TRAIL 1A Bike Route: Parpaner Rothorn – Culmet – Furcletta – Arosa – Route: Lenzerheide – Kieswerk Bovas – Lantsch/Lenz – Länge: 6.8 km Hörnli – Urdenfürggli – Scharmoin – Golfplatz – Lenzerheide Höhendifferenz: -590 m Talstation Rothorn Panorama karte Länge: 15.3 km Fahrzeit: 30 min Länge: 35 km 1B Höhendifferenz: -311 m / +311 m Kondition: Höhendifferenz: -2 937 m / +930 m Fahrzeit: 2 h Technik: Fahrzeit: 4 h Kondition: 3A 2A Kondition: Technik: Technik: 2B 1C 616 BIKETICKET 2 RIDE ROT 603 ALPENTOUR 11 LANGWIES 2C 5A Route: Piz Scalottas – Parpan – Mittelberg – Fanülla – Route: Lenzerheide – Lain – Got – Alp Fops – Alp Nova – Route: Arosa – Litzirüti – Langwies 4A Chur – Brambrüesch – Churwalden – Alp Stätz – Alp Lavoz – Alp Stätz – Heidsee – Lenzerheide Rückweg mit der RHB Spoina – Lenzerheide 1D Länge: 19.5 km Länge: 7.7 km 5B Länge: 51.7 km Höhendifferenz: -780 m / +780 m Höhendifferenz: -475 m / +57 m 2D Höhendifferenz: -3 250 m / +950 m Fahrzeit: 2 h 15 min Fahrzeit: 40 min Fahrzeit: 5 h Kondition: Kondition: 3B 4B Kondition: Technik: Technik: Technik: 1E Lässt Herzen höher schlagen. 3C 2E 2 BIKETIKET 2 RIDE SCHWARZ 635 OCHSENALP 601 LENZERHEIDE TAL TOUR WIR BERATEN SIE GERNE Route: Piz Scalottas – Lenzerheide – Rothorn – Route: Arosa – Maran – Rot Tritt – Ochsenalp – Route: Lenzerheide – Bova Pintga – Rofna – Lantsch/Lenz – Arosa Tourismus Innerarosa – Hörnli – Arosa Weisshorn – Langwieser Aussicht – Arosa Crap la Tretscha – Tschividains – Lenzerheide 1F Tschiertschen – Praden – Passugg – Chur – Länge: 29.4 km Länge: 17.3 km T +41 81 378 70 20 Brambrüesch – Churwalden – Alp Stätz – Lenzerheide Höhendifferenz: -280 m / +280 m Höhendifferenz: -480 / +480 m [email protected] Länge: 80.3 km Fahrzeit: 1 h 30 min Fahrzeit: 1 h 30 min 1G Das lokale Informationsbüro finden Sie im Sport- und Höhendifferenz: -5 732 m / +636 m Kondition: Kondition: Kongresszentrum in Arosa. -

ARM V2.1 Switzerland English
Summits on the Air – ARM v2.1 for Switzerland (HB) Summits on the Air Switzerland (HB) Association Reference Manual Document Reference S13.1 Issue number 2.1 Date of issue 01-Jun-2018 Participation start date 01-Aug-2005 Authorised SOTA MT Date 01-Jun-2018 Association Manager Jürg Regli, HB9BIN Summits-on-the-Air an original concept by G3WGV and developed with G3CWI Notice “Summits on the Air” SOTA and the SOTA logo are trademarks of the Programme. This document is copyright of the Programme. All other trademarks and copyrights referenced herein are acknowledged. Page 1 of 67 Document S13.1 Summits on the Air – ARM v2.1 for Switzerland (HB) Table of contents 1 CHANGE CONTROL ........................................................................................................................... 4 2 ASSOCIATION REFERENCE DATA ............................................................................................... 13 2.1 DIVISION OF REGIONS ..................................................................................................................... 14 2.2 GENERAL INFORMATION................................................................................................................. 14 2.3 MAP RESOURCES ............................................................................................................................ 14 2.4 DISCLAIMER .................................................................................................................................. 15 2.5 FINAL WORDS ............................................................................................................................... -

Arosa Winterwanderkarte Arosa Lenzerheide
Mon 1231m S Bergün St. Moritz Albula Savognin Julierpass Surava 904m Filisur 1032m Tiefencastel 851m Stierva 1375m O W Piz Linard 2768m Brienz/Brinzauls 1144m Mutten 1395m Alvaneu Bad 957m Vazerol 1125m Lenzerhorn 2906m N Davos Scasaluir 2200m Solas 1122m Punt da Solas 1004m Alvaneu Dorf 1181m Piz Mulain 2627m Alvaschein 1004m Landwasserviadukt 206 Schmitten GR 1301m 1411m A Lantsch/Lenz 1314m Muldain 1210m lbula Luftseilbahn 524 524 Thusis 597m Crap la Tretscha Parnegl Gondelbahn 206 Aclas Dafora 1693m 814m a l Sesselbahn u Zorten 1186m B Sils im Domleschg Anlagen ausschliesslich Nordic House Lain 1318m Chur 683m für Skifahrer und Snowboarder Pizza Naira 2870m Crap la Pala 2151m St. Cassian ai Winterwanderweg L l ig Piz Scalottas 2323m d 667m 201A Tourenvorschläge Winterwandern n Fürstenaubruck i Piz Scalottas a Furcletta 2573m R Heidi und Gigi Weg Alp Sanaspans 2044m Aroser Rothorn 2980m Kulinarischer Höhenweg Parpaner Rothorn 2865m Alp Fops 1886m 205 523 Schneeschuhtrail Rothorngipfel Scharans 766m Golf Restaurant Sporz 1585m 1790m Scalottas 205 524 A TourenvorschlägeGuggernell Schneeschuhlaufen 2810m Tgantieni Piz Danis 2497m C: Kulinarischer Höhenweg Schlittelweg 523 Acla Grischuna Schienen-Rodelbahn Rothorn 2 Tgantieni 1747m Erzhorn 2924m 205 Alp Nova 1980m Wild- und Waldschutzzone 202 Alp Nova Erzhornsattel 2744m Restaurant, Bar 202 205 Val Sporz 202 Pedra Grossa 203 Information Lenzerheide 1475m 202 Avant Clavo 522 Lavoz 2330m Parkplatz Scharmoin Scuntrada Totseeli 2396m Crest‘ ota Gredigs Fürggli 2615m 203 Alp Lavoz 1915m Parkhaus -

Wanderkarte Arosa-Lenzerheide
Gut zu wissen Routenvorschläge Angebote TRAIL TOLERANZ 35.15. DAVOS – AROSA, 741 BURG STRASSBERG 749 HÄNGEBRÜCKE VAL MELTGER 767 ALTEINSEE – SCHIESSHORN WEISSHORN SUNRISE FOXTRAIL Sommer— Das grosse Wegnetz des Kantons Graubünden WALSERWEG ETAPPE 15 Ausgangspunkt: Post Malix, 1125 m ü.M. Ausgangspunkt: Gemeindehaus Lantsch/Lenz, 1350 m ü.M. Ausgangspunkt: ARA Arosa, 1743 m ü.M. An vier ausgewählten Daten bringen wir Sie vor der Morgen- Foxtrail, die spannendste Schnitzeljagd der Schweiz, gibt dämmerung auf das Weisshorn in Arosa, wo Sie einen es ab diesem Sommer auch in den Lenzerheidner Bergen! Ausgangspunkt: Davos Platz, 1547 m ü.M. Länge: 7,2 km Länge: 8,4 km Länge: 11,9 km dient den verschiedensten Sportarten. So sind traumhaften Sonnenaufgang mit atemberaubender Sicht auf wander Aufstieg: 844 m Zwei Trails führen die Verfolger/-innen auf eine knifflige Länge: 14,6 km Auf-/Abstieg: 380 m Auf-/Abstieg: 425 m die umliegende Bergwelt geniessen. Anschliessend speziell auch Mountainbiker auf den Wander- Routensuche durch wunderschönes Panorama. Aufstieg: 1013 m Höchster Punkt: 1333 m ü.M. Höchster Punkt: 1634 m ü.M. Abstieg: 967 m werden Sie im 360° Panoramarestaurant Weisshorngipfel mit Auf dem etwa 3- bis 4-stündigen Bergtrail ab Churwalden wegen zugelassen. Lokale Einschränkungen sind Abstieg: 898 m Marschzeit: 2 – 2½ h Marschzeit: 2½ – 3 h Höchster Punkt: 2431 m ü.M. einem reichhaltigen Gipfel Z'Morga verwöhnt. Panorama karte 2017 über Heidbüel müssen die Teams das Wetter manipu- signalisiert. Gegenseitige Rücksichtnahme Marschzeit: 5 – 5½ h Gibt es einen besseren Start in einen perfekten Sonntag? Höchster Punkt: 2438 m ü.M. Kondition: Kondition: lieren und dem Alpsenn seinen Käsevorrat plündern, um an verhindert Konflikte und schafft ein ungetrübtes Marschzeit: 7½ – 8 h Besonderheit: Burg Strassberg aus dem Besonderheit: Hängebrücke Kondition: Übrigens: Auch in Lenzerheide können Sie einen die nötigen Hinweise zu kommen.