National Catholicism. This Was Considered by the Communists As an Oppositional Ideology and It Was Not Tolerated by the Regime After the Stalinization in 1948
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

On the Threshold of the Holocaust: Anti-Jewish Riots and Pogroms In
Geschichte - Erinnerung – Politik 11 11 Geschichte - Erinnerung – Politik 11 Tomasz Szarota Tomasz Szarota Tomasz Szarota Szarota Tomasz On the Threshold of the Holocaust In the early months of the German occu- volume describes various characters On the Threshold pation during WWII, many of Europe’s and their stories, revealing some striking major cities witnessed anti-Jewish riots, similarities and telling differences, while anti-Semitic incidents, and even pogroms raising tantalising questions. of the Holocaust carried out by the local population. Who took part in these excesses, and what was their attitude towards the Germans? The Author Anti-Jewish Riots and Pogroms Were they guided or spontaneous? What Tomasz Szarota is Professor at the Insti- part did the Germans play in these events tute of History of the Polish Academy in Occupied Europe and how did they manipulate them for of Sciences and serves on the Advisory their own benefit? Delving into the source Board of the Museum of the Second Warsaw – Paris – The Hague – material for Warsaw, Paris, The Hague, World War in Gda´nsk. His special interest Amsterdam, Antwerp, and Kaunas, this comprises WWII, Nazi-occupied Poland, Amsterdam – Antwerp – Kaunas study is the first to take a comparative the resistance movement, and life in look at these questions. Looking closely Warsaw and other European cities under at events many would like to forget, the the German occupation. On the the Threshold of Holocaust ISBN 978-3-631-64048-7 GEP 11_264048_Szarota_AK_A5HC PLE edition new.indd 1 31.08.15 10:52 Geschichte - Erinnerung – Politik 11 11 Geschichte - Erinnerung – Politik 11 Tomasz Szarota Tomasz Szarota Tomasz Szarota Szarota Tomasz On the Threshold of the Holocaust In the early months of the German occu- volume describes various characters On the Threshold pation during WWII, many of Europe’s and their stories, revealing some striking major cities witnessed anti-Jewish riots, similarities and telling differences, while anti-Semitic incidents, and even pogroms raising tantalising questions. -

KH2018 Ang2-II
SURVEYSOFRESEARCH—POLEMICS Kwartalnik Historyczny Vol. CXXV, 2018 Eng.-Language Edition no. 2, pp. 111–42 PL ISSN 0023-5903 PRZEMYSŁAW PAZIK Institute of History, University of Warsaw College of Europe, Natolin POLITICAL CATHOLICISM IN POLAND IN 1945–1948. * AN OVERVIEW OF POLITICAL ACTIVITY OF CATHOLICS Abstract: The article is a reconstruction of the most important strands in the histo- riography devoted to the political activity of the laity after 1945, especially the period between 1945 and 1948. The author first discusses pre-1989 literature and then the most recent studies devoted to political Catholicism in Poland. In the main part of the article he presents three strands in historiography: research into the Labour Party, re- search into groups associated with Catholic socio-political weeklies, and biographies and syntheses of the history of the Catholics and the Church. Keywords: political Catholicism, Catholic Church in the Polish People’s Republic, Christian Democracy. Introduction The aim of the article is to carry out an overview of the most important tendencies in the historiography devoted to social and political activities of lay Catholics in 1945–48. This, I hope, will make it possible to provide an important addition to the existing overviews of the literature on the rela- 1 tions between the Church and the state. The scope of the problems tackled in the article are determined by the use of the term ‘political Catholicism’ * The article is a result of research conducted thanks to a National Science Centre grant, no.2016/23/N/HS3/00380.I would like to cordially thank my research supervi- sor, Paweł Skibiński from the Institute of History, University of Warsaw, members of the editorial board of Kwartalnik Historyczny as well as the anonymous reviewers for their valuable remarks and suggestions. -

The Religious Education and Teaching Religion in the Light of the 1961 Personal Notes of Primate Stefan Wyszyński
Monika Wiśniewska BHE 40/2019 Ludwik and Alexander Birkenmajer Institute ISSN 2544-7899 for the History of Science DOI: 10.14746/bhw.2019.40.7 Polish Academy of Science, Warsaw ORCID: 0000-0002-8877-8807 The religious education and teaching religion in the light of the 1961 personal notes of Primate Stefan Wyszyński Abstract. The religious education and teaching religion in the light of the 1961 personal notes of Primate Stefan Wyszyński The aim of the article is to present the educational issues of the Polish People’s Republic (Polska Republika Ludowa – later referred to as PRL) in the light of the 1961 personal notes of Primate Stefan Wyszyński (referred to as Pro memoria). The source base of this examination, is the manu- script of Primate Wyszyński, stored in the Archdiocese Archive in Gniezno. The first section of the article is the outline of the state of research on the PRL education, as well as, methodological mat- ters. The second section is dedicated to a brief characteristic of education in the “people’s” Poland, regarding the spread of ideology until 1961. The third section is dedicated to the characteristics of the source material. The fourth section shows – in the light of the personal writings of Primate Wyszyński — issues such as: The 1961 Act on the Development of the Educational System, the ed- ucational and care institutions of the Roman-Catholic Church, monastic and parochial preschools, religious schooling, confessional secondary school education, catechesis, minor seminaries, major seminaries, higher education and academic ministry. Keywords: Polish People’s Republic education, religious education, Primate Stefan Wyszyński, seminaries The aim of the article is to present the educational issues of the Polish People’s Republic (Polska Republika Ludowa – later referred to as PRL) in the light of the 1961 personal notes of Primate Stefan Wyszyński (referred to as Pro memoria). -

Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968
HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 2/2020 Catholic Church Towards Sovietization of Culture and Polish Society in Communication of the Polish Embassy at the Vatican in the Years 1956–1968 MAREK BODZIANY* – TOMASZ LANDMANN** Katolická církev proti sovietizaci kultury a polské společnosti v komunikaci polského velvyslanectví ve Vatikánu v letech 1956–1968 Abstract: The article aims to present the culture-forming role of the Catholic Church, which emerges from selected communications of the Polish Embassy at the Vatican, in opposition to the sovietisation of Polish culture developed by the communist authorities of the People’s Republic of Poland in the years 1956–1968. Materials from the Archive of the Józef Piłsudski Institute in America and available literature constituted the basis for the analysis. The undertaken research considering the sources fills a significant gap in the knowledge about the Catholic Church’s oppo- sition to the process of sovietisation of Polish culture during the Cold War. It should be empha- sised that in the post-war period the Church was the institution that shaped Christian values and a kind of “bastion” of resistance to the authorities whose one of the goals was to sovietise Polish culture. It continued the discourse on the ground of the expression of the inability to reconcile the communist ideology with Christian values in European, including Polish, culture. It also acted as a correspondent for the affairs of oppressed nations subjected to the course of sovietisation. The undertaken research is an answer for lack of knowledge on the Catholic Church opposition towards the process of sovietising Polish culture during the Cold War. -

Framing Solidarity. Feminist Patriots Opposing the Far Right in Contemporary Poland
Open Cultural Studies 2019; 3: 469-484 Research Article Jennifer Ramme* Framing Solidarity. Feminist Patriots Opposing the Far Right in Contemporary Poland https://doi.org/10.1515/culture-2019-0040 Received October 30, 2018; accepted May 30, 2019 Abstract: Due to the attempts to restrict the abortion law in Poland in 2016, we could observe a new broad- based feminist movement emerge. This successful movement became known worldwide through the Black Protests and the massive Polish Women’s Strike that took place in October 2016. While this new movement is impressive in its scope and can be described as one of the most successful opposition movements to the ethno-nationalist right wing and fundamentalist Catholicism, it also deploys a patriotic rhetoric and makes use of national symbols and categories of belonging. Feminism and nationalism in Poland are usually described as in opposition, although that relationship is much more complex and changing. Over decades, a general shift towards right-wing nationalism in Poland has occurred, which, in various ways, has also affected feminist actors and (counter)discourses. It seems that patriotism is used to combat nationalism, which has proved to be a successful strategy. Taking the example of feminist mobilizations and movements in Poland, this paper discusses the (im)possible link between patriotism, nationalism and feminism in order to ask what it means for feminist politics and female solidarity when belonging is framed in different ways. Keywords: framing belonging; social movements; ethno-nationalism; embodied nationalism; public discourse A surprising response to extreme nationalism and religious fundamentalism in Poland appeared in the mass mobilization against a legislative initiative introducing a total ban on abortion in 2016, which culminated in a massive Women’s Strike in October the same year. -

What Is Published by the Catholic Press in Poland During the Period of Martial Law?
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe Volume 3 Issue 6 Article 3 9-1983 What is Published by the Catholic Press in Poland During the Period of Martial Law? Peter R. Prifti University of California at San Diego Follow this and additional works at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree Part of the Christianity Commons, and the Eastern European Studies Commons Recommended Citation Prifti, Peter R. (1983) "What is Published by the Catholic Press in Poland During the Period of Martial Law?," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 3 : Iss. 6 , Article 3. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol3/iss6/3 This Article, Exploration, or Report is brought to you for free and open access by Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Occasional Papers on Religion in Eastern Europe by an authorized editor of Digital Commons @ George Fox University. For more information, please contact [email protected]. WHAT IS PUBLISHED BY THE CATHOLIC PRESS IN POLAND DURING THE PERIOD OF MARTIAL LAW? On December 13 , 1981 , the day of the declaration of martial law , the Poli sh press market practically ceased to exist . Street newsstands were selling only one paper--the daily of the army Zo .Xnierz Wolnosci; there were no weeklies ; the monthlies ceased to appear . Editors had to apply to get a new license for publishing activity . The restrictions al so did not spare the religious press , both ecclesiastical and lay Christian publications . It was necessary to wait a long time for the re-institution of individual titles . -

MAKING SENSE of CZESLAW MILOSZ: a POET's FORMATIVE DIALOGUE with HIS TRANSNATIONAL AUDIENCES by Joanna Mazurska
MAKING SENSE OF CZESLAW MILOSZ: A POET’S FORMATIVE DIALOGUE WITH HIS TRANSNATIONAL AUDIENCES By Joanna Mazurska Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in History August, 2013 Nashville, Tennessee Approved: Professor Michael Bess Professor Marci Shore Professor Helmut W. Smith Professor Frank Wcislo Professor Meike Werner To my parents, Grazyna and Piotr Mazurscy II ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my gratitude to the members of my Dissertation Committee: Michael Bess, Marci Shore, Helmut Smith, Frank Wcislo, and Meike Werner. Each of them has contributed enormously to my project through providing professional guidance and encouragement. It is with immense gratitude that I acknowledge the support of my mentor Professor Michael Bess, who has been for me a constant source of intellectual inspiration, and whose generosity and sense of humor has brightened my academic path from the very first day in graduate school. My thesis would have remained a dream had it not been for the institutional and financial support of my academic home - the Vanderbilt Department of History. I am grateful for the support from the Vanderbilt Graduate School Summer Research Fund, the George J. Graham Jr. Fellowship at the Robert Penn Warren Center for the Humanities, the Max Kade Center Graduate Student Research Grant, the National Program for the Development of the Humanities Grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education, and the New York University Remarque Institute Visiting Fellowship. I wish to thank to my friends at the Vanderbilt Department of History who have kept me company on this journey with Milosz. -

London School of Econmics and Political Science Anna M. Pluta A
London School of Econmics and Political Science Legitimising Accession: Transformation Politics and Elite Consensus on EU Membership in Poland, 1989-2003. Anna M. Pluta A thesis submitted to the Department of International History of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, September, 2010. 1 UMI Number: U615B49 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U615B49 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 it'iniU S' Acknowledgements First of all, I would like to thank my supervisor, Dr .Piers Ludlow, for his kindness, challenging feedback, and the care he put into reviewing my work. I am also much indebted to Dr.Abby Inness for her very valuable comments. The thesis could not have been formulated without the input the interviewees and I would like to thank them for the time and the insights they offered. Fieldwork in Poland was made possible by funding from the Department of International History at the London School of Economics, for which I am very grateful. I would also like to thank Dr.Kirsten Schulze, without whose support and encouragement this study could not have been completed. -

PAX and Socialist Realism a Marriage of Convenience
Daria Mazur PAX and Socialist Realism: A Marriage of Convenience? The term ‘socpaxist realism’1 defines works by authors associated with the milieu of Bolesław Piasecki2 in the years 1949-1956 (the so-called movement of socially progressive Catholics) and with the Dziś i Jutro} weekly that it published. The specificity of these works stemmed from the attempts at reconciliation of a religious world-view with full acceptance of the Stalinist course taken by the authorities. Socpaxist authors keenly tapped into the concept of Catholic realism.4 The pos tulate of describing the reality in its material and spiritual aspects was, however, 1 Socpaxist realism: a term describing a phenomenon specific to Polish literary life at the time of Stalinism consisting in the combination of the doctrine of socialist realism with the Catholic world-view. It is external to the discourse of the era and pejoratively loaded. See: Daria Mazur, ‘Realizm katolicki’ [Catholic realism], in: Słownik realizmu socjalistycznego [Dictionary of socialist realism], Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik (eds.), Kraków: Universitas, 2004, p. 245-256; eadem, ‘Realizm socpaxowski - próba charakterystyki (refleksje nad “krytyką syzyfową”)’ [Socpaxist realism - an attempt at characterization (reflections on ‘Sisyphean criticism’)], in: Socrealizm. Fabuły - ko munikaty - ikony [Socialist realism. Storylines - communications - icons], Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota (eds.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2006, pp. 547-560; eadem, Realizm socpaxowski [Socpaxist realism], Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. Michał Głowiński was the one to apply the term ‘socpaxist’ in reference to Zygmunt Lichniak, a lead ing critic from Dziś i Jutro. See: idem, ‘Powieść na miarę naszych czasów (Obywatele Kazimierza Brandysa)’ [A novel for our times (‘Citizens’ by Kazimierz Brandys)], in: idem, Rytuał i demagogia. -
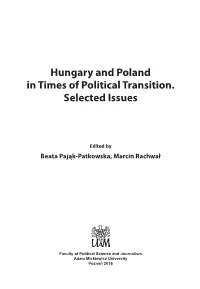
Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues
Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues Edited by Beata Pająk-Patkowska, Marcin Rachwał Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University Poznań 2016 This publication was developed as part of a project financed by the Hungarian-Polish Non-governmental Cooperation Programme. Pro- ject title: Poland and Hungary in the era of political transformation – directions for developing political system and civil society. Project implementation period: 01.07.2016–31.12.2016. Publikacja została sfinansowana ze środków Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej. Tytuł projektu: Polska i Węgry w okresie transformacji systemowej – kierunki rozwoju systemu po- litycznego i społeczeństwa obywatelskiego. Czas realizacji projektu: 01.07.2016–31.12.2016. Reviewers: prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, dr hab. Piotr Matczak Cover designed by: Filip Biały © Copyright by Faculty of Political Science and Journalism Press, Adam Mickiewicz University, 89 Umultowska Street, 61-614 Poznań, Poland, Tel.: 61 829 65 15 ISBN 978-83-62907-91-5 Skład komputerowy – „MRS” 60-408 Poznań, ul. P. Zołotowa 23, tel. 61 843 09 39 Druk i oprawa – Zakład Graficzny UAM – 61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1 Contents Beata PAJĄK-PATKOWSKA, Marcin RACHWAŁ Hungary and Poland in times of political transition – introduction . 5 Andrea SCHMIDT The course of transition into a democratic system in Hungary . 11 Zoltán VÖRÖS Directions for development of political systems – decrease in legitimacy . 25 Zoltán BRETTER The name of the game: The Regime of National Collaboration . 39 Andrea SCHMIDT Challenges of democracy, party reshaping and party preferences . 57 László KÁKAI The main characteristics of Hungarian non-profit sector after the economic crises . -

'The Soldiers' Field'
KAROLINA WICHOWSKA KAROLINA WICHOWSKA In this story the dark history of the Stalinist period intertwines with the knowledge of the state-of-the-art technology of genetic identi cation. The scientists’ profes- sionalism contrasts with the emotions of the victims’ families – hope, tension, and painful memories. We go from the excavated section of the Powązki cemetery to ‘ THE SOLDIERS’FIELD ‘THE SOLDIERS’ the high-tech genetic laboratories in Szczecin and Cracow. We access the memory of the communist prisons, brutal investigations, and fatherless childhood only to look into the future where the research methods developed by the Polish scientists shall become an internationally followed model. All this has one objective: to repay the debt to those who fought for a free and sovereign Poland. FIELD’ ’ ISBN 978-83-8098-022-8 Visit our website www.ipn.gov.pl and our on-line bookshop 9 788380 980228 www.ipn.poczytaj.pl IPN Laczka_okladka_wer angielska.indd 1,3 2016-07-05 09:43:49 Laczka_okladka_wer angielska.indd 4,6 2016-07-04 14:06:36 ‘THE SOLDIERS’ FIELD’ ‘THE SOLDIERS’ FIELD’ THE INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE THE COMMISSION FOR THE PROSECUTION OF CRIMES AGAINST THE POLISH NATION Karolina Wichowska ‘THE SOLDIERS’ FIELD’ THE EXCAVATION AND IDENTIFICATION OF COMMUNIST TERROR VICTIMS BURIED IN THE POWĄZKI CEMETERY IN WARSAW Translated by Anna Brzostowska and Jerzy Giebułtowski WARSAW 2016 Reviewer Arkadiusz Gołębiewski Graphic design Sylwia Szafrańska Cover Sylwia Szafrańska Technical editor Marcin Koc Index of names Magdalena Zarzycka Typesetting Wojciech Czaplicki Cover photo Piotr Życieński Print and binding Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ul. -

Period of Repression and Lawlessness and Anti Soviet Action Emigration Manifestations of Discontent (Sokol Festival) Funeral of E
Period of repression and lawlessness and Anti Soviet action Emigration manifestations of discontent (Sokol festival) Funeral of E. Beneš - also public protest – arrests Growing protest againts insufficient supply First open conflict with the protagonists of the ―third resistance‖ protection laws for Democratic People's Republic, … - police regime established repressive forces of state power - national security persecution and extrajudicial illegal coercion - a special military unit politically unreliable young man - not weapons, they had to work hard in mines, smelters 1948 – 54 - forced labor camps 23,000 State Security - goal to end the regime's opponents, help from Soviet advisors wave of terror similar to the Nazi regime Since October 1949 – after soviet advisors arrived Most processes were artificially constructed, state police provocation on guilt and punishment did not decide judicial authorities BUT political organs of CP!!! First victims: enemy of the regime - political processes - people were prosecuted for crimes they did not commit!!! - 1949 General Heliodor Pika was executed - June 1950 process with the National Socialist MEP Milada Horaková Convicted 639 Also againts dignitary, athletes, communists http://www.ustrcr.cz/en/milada- horakova-en Milada Horaková along with others were sentenced to death and despite the protests of prominent foreign figures e.g. Albert Einstein, Winston Churchill or Eleanor Roosevelt (contrived conspiracy and treason), judicial murder http://www.radio.cz/en/section/special/olg