Hermann Rorschach
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rorschach Personality Characteristics in Obesity, Eating Behaviour and Treatment Outcome
From the Obesity Unit, Department of Medicine, Huddinge University Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden RORSCHACH PERSONALITY CHARACTERISTICS IN OBESITY, EATING BEHAVIOUR AND TREATMENT OUTCOME Kristina Elfhag Stockholm 2003 All previously published papers were reproduced with permission from the publisher. Published and printed by Karolinska University Press Box 200, SE-171 77 Stockholm, Sweden © Kristina Elfhag, 2003 ISBN 91-7349-711-8 The first step is to measure whatever can be easily measured. That’s OK as far as it goes. The second step is to pretend that whatever cannot easily be measured isn’t very important. That’s dangerous. The third step is to pretend that whatever cannot easily be measured doesn’t exist. That’s suicide. Daniel Yankelovich ABSTRACT Obesity is a growing public health problem influenced by several factors. Psychology is essential in the study of obesity. Reasons for behaviour are complex and can be partly inaccessible and difficult to reveal in self-reported information. A performance- based psychological technique such as the Rorschach method enables a study of underlying personality aspects affecting behaviours and can provide data complementary to self-reports. This can be of particular relevance in deriving more understanding for obesity behaviours. The aim of this thesis was to study Rorschach personality characteristics in relation to obesity, eating behaviour and treatment outcome. Patients with more difficulties with emotions could be considered to constitute a subgroup that was characterized by eating disorders, periodic variations in food intake and reporting psychological reasons for having an obese body size. Another type of difficulties in obesity could be related to coping with everyday demands. -

The Rorschach Archives' Guide Location: Rorschach Archives
The Hermann Rorschach Archives and Collection Berne The Rorschach Archives' Guide Location: Rorschach Archives Reference Nr.: Rorsch Prepared by Rita Signer Edited April 2013 updated April 2020 Berne 2020 The Rorschach Archives' Guide (28/04/2020) 1 / 20 Table of content Introduction ....................................................................................................................... 3 General Information .......................................................................................................... 4 Use ............................................................................................................................... 4 Address ........................................................................................................................ 4 Inventory of the Archives .................................................................................................. 5 1 Fonds Adolf Friedemann ........................................................................................ 5 2 Fonds Arnold Weber .............................................................................................. 6 3 Fonds Elisabeth Rorschach ................................................................................... 6 4 Fonds Emil Lüthy ................................................................................................... 7 5 Fonds Emil Oberholzer .......................................................................................... 8 6 Fonds G.A. Roemer .............................................................................................. -

Hermann Rorschach: a Centenary Tribute
Article NIMHANS Journal Hermann Rorschach: A Centenary Tribute Volume: 02 Issue: 02 July 1984 Page: 77-92 G G Prabhu, - Department of Clinical Psychology, National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore 560 029, India Abstract The review evaluates selected issues and developments in the field of Rorschach Psychodiagnostics over the past 60 years. Among the issues discussed are the little known facts about the life and work of Hermann Rorschach, the early beginnings of the Rorschach technique, phase of its popularity, criticism levelled against it and the work done in India. Around 130 studies carried out in India have been briefly reviewed. The Rorschach technique has undoubtedly made an impact in the field of Clinical Psychology and Mental Health in this country, but during the birth centenary year of the originator of the technique, one is faced with the issue of its uncertain future and a possible eclipse. Key words - Hermann Rorschach, Rorschach techniques, Psychodiagnostics, Developing countries, Review The year 1984 heralds the birth centenary of Hermann Rorschach who was born in Zurich on November 8, 1884. He was the eldest among the 3 children and lost his mother when he was 12 years old and his father when he was 18. At school, he was a good student but not extraordinary and was nicknamed "Klex" which meant "painter" or "inkblot". He thought of following his father's footsteps and becoming an arts teacher and also toyed with the idea of studying natural sciences but he ultimately decided in favour of medicine. Between 1904 and 1909 he attended the Neuenburg, Berlin, Bern and the Zurich Universities and qualified in 1912 from Zurich. -

Herman-Rorschsch-Psychodiagnostics.Pdf
HERMANN RORSCHACH PSYCHODIAGNOSTICS A DIAGNOSTIC TEST BASED ON PERCEPTION INCLUDING RORSCHACITS PAPER THE APPLICATION OF THE FORM INTERPRETATION TEST (PUBLISHED POSTHUMOUSLY BY DR. EMIL OBERHOLZER) TRANSLATION AND ENGLISH EDITION BY PAUL LEMKAU, M. D* THE HENRY PHIPPS PSYCHIATRIC CLIMC, BALTIMORE AND BERNARD KRONENBERG, M. D. NEW YORK FIFTH EDITION, WITH A NEW BIBLIOGRAPHY VERLAG HANS H U B E R, BERNE, SWITZERLAND Distributors for the U.S.A. GRUNE & STRATTON INC. 381 Fourth Avenue New York, N.Y Allc ReAtc vorbehialteii Copyright by Verlag Hans Huber, Bern 1942 In der Scfaweiz gedruckt Imprim6 en Sukse Printed in Switzerland 1951 PL, ."> ^E TO THE The widespread and growing interest in the Rorsehach test among English- speaking workers has made apparent the need for a more easily available source of information concerning Rorschach's original and basic work than the German Editions supply. This English Translation is presented in the hope of filling that need. We are aware that this need has been met sporad- ically by various unauthorized translations, but these have been available to bet few of those interested in the test. None of these translations was at hand during the preparation of the translation presented here. The task of translating Rorschach's German is doubly difficult. One wishes to present his ideas adequately and at the same time preserve as much as possible of the personality of Rorschach as it is revealed in his choice of words, his sentence structure, and his delicate shadings of meanings* The first attempt yielded a too literal translation which did not present the ideas clearly enough. -

Inventory Fonds Hermann Rorschach Location: Rorschach Archives
The Hermann Rorschach Archives and Museum Berne Inventory Fonds Hermann Rorschach Location: Rorschach Archives Reference Code: Rorsch HR Prepared by Rita Signer Compliant with ISAD Inventory edited April 2013 Berne 2013 Inventory Fonds Hermann Rorschach ( 05/04/2013 ) 1 / 82 Table of content Introduction........................................................................................................................3 General Information...........................................................................................................4 Reference Code............................................................................................................4 Use................................................................................................................................4 Address..........................................................................................................................4 Contact..........................................................................................................................4 Links..............................................................................................................................4 Hierarchy............................................................................................................................5 Inventory..........................................................................................................................15 Index of reference numbers.............................................................................................78 -

21 Rorschach, Freudians, and Humanists What Do You See in This
#21 Rorschach, Freudians, and Humanists [Adapted from Crash Course Psychology with Hank Green, written by Kathleen Yale, edited by Blake de Pastino, with psychology consultant Dr. Ranjit Bhagwat] What do you see in this image? A scary face, a couple of squirrels fighting, or this one: a squashed frog or tumbling poodles, a bleeding bat? Hermann Rorschach wants to know. He wanted to know; he's dead now. He believed that your answers, what you saw in the ink, said something about your personality. Rorschach was a Swiss psychoanalyst who in his youth was fascinated by the childhood game of making pictures out of ink blots called Klecksography. As an adult, Rorschach was intrigued with Carl Jung's use of word association in attempts to access patients' unconscious minds. Jung would ask patients to say the first thing that came to mind when they saw words like 'dead' or 'window' or 'abuse', and Rorschach thought "why not do the same thing with amorphous blobs?". So he'd show a patient a series of ink blots and record what they saw to determine how people projected their personal associations onto random shapes. Assuming there were important differences between those who saw dancing bunnies versus those who saw severed screaming heads, he drew conclusions about a patient's personality. And yeah, this was controversial. Some clinicians still do think that the Rorschach test can be a helpful diagnostic tool when used correctly and cautiously. But others remain critical of the test, calling them unscientific and unreliable. It's even been called the 'Dracula' of psychological tests because no-one has been able to drive a stake through its heart yet. -

History and Development of the Rorschach Exne C01.Qxd 9/19/02 11:10 AM Page 2 Exne C01.Qxd 9/19/02 11:10 AM Page 3
exne_c01.qxd 9/19/02 11:10 AM Page 1 PART ONE History and Development of the Rorschach exne_c01.qxd 9/19/02 11:10 AM Page 2 exne_c01.qxd 9/19/02 11:10 AM Page 3 CHAPTER 1 Introduction The 10 figures that constitute the stimuli of the not difficult to learn if the student of the test has Rorschach test were first unveiled to the profes- each of three basic prerequisites. sional public in September 1921, with the release of Hermann Rorschach’s famed monograph, BASIC PREREQUISITES Psychodiagnostik (1941/1942). Since that time, the test has generated much interest, extensive A first prerequisite is a reasonably good under- use, and considerable research. For at least two standing of people and the notion of personality. decades, the 1940s and 1950s, its name was al- This does not mean that the Rorschach data are, most synonymous with clinical psychology. Dur- or should be, interpreted directly in the context of ing those years, the primary role of the clinician any particular theory of personality. That proba- focused on assessment or psychodiagnosis. Al- bly is a mistake. Rorschach-based conclusions ul- though the role of the clinician broadened and timately can be translated into any of a variety of diversified during the 1960s and 1970s, the theoretical models concerning personality but, Rorschach remained among the most commonly before doing so, the data should be interpreted used tests in the clinical setting, and that status in a manner that is consistent with findings on continues today. This is because considerable in- which their validity has been based. -
Blurring Boundaries: the Rorschach Idea in Twentieth-Century American Popular Culture
W&M ScholarWorks Dissertations, Theses, and Masters Projects Theses, Dissertations, & Master Projects 2008 Blurring Boundaries: The Rorschach Idea in Twentieth-Century American Popular Culture James Edward Rainey College of William & Mary - Arts & Sciences Follow this and additional works at: https://scholarworks.wm.edu/etd Part of the American Studies Commons Recommended Citation Rainey, James Edward, "Blurring Boundaries: The Rorschach Idea in Twentieth-Century American Popular Culture" (2008). Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1539626549. https://dx.doi.org/doi:10.21220/s2-bc04-0949 This Thesis is brought to you for free and open access by the Theses, Dissertations, & Master Projects at W&M ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Dissertations, Theses, and Masters Projects by an authorized administrator of W&M ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. BLURRING BOUNDARIES The Rorschach Idea in Twentieth-Century American Popular Culture James Edward Rainey, Jr. Norfolk, Virginia Bachelor of Arts, Princeton University, 1993 A Thesis presented to the Graduate Faculty of the College of William and Mary in Candidacy for the Degree of Master of Arts American Studies Program The College of William and Mary May 2008 APPROVAL PAGE This Thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts A- James Edward Rainey, Jr. VJ Approved by the Committee, March 2008 Conymttee Chair Professor Robert J. Scholmck, English and American Studies Associate Professor Chandos M. Brown, History and American Studies Professor Grey Gundaker, Anthropology and American Studies ABSTRACT PAGE The work at hand will examine the circumstances that effected the establishment of the Rorschach Test as the predominant personality assessment administered in the United States in the twentieth century. -
Rorschach's Idea of a “Movement” Response in the Light of Recent
Helge Malmgren: Movement Responses and Perception Copyright 2000 by Hogrefe & Huber Publishers Rorschach’s Idea of a “Movement” Response in the Light of Recent Philosophy and Psychology of Perception Helge Malmgren Department of Philosophy, Göteborg University, Sweden Introduction The proper definition of the kinesthetic or movement (M) category has been the subject of many controversies within the Rorschach community; see, for example, the discussion between Kramer and Exner (Kramer, 1991; Exner, 1991). The present paper elucidates the nature of movement responses by means of a theoretical analysis of some of the key concepts involved. This analysis in part will be of a philosophical character, but I will also bring in several recent results from the psychology and neurophysiology of perception which in my opinion are crucial to a correct understanding of the movement responses. The next two parts of the essay describe the basic controversy between those Rorschach theorists who – like Hermann Rorschach himself and Ewald Bohm – hold that kinesthetic identification is a necessary ingredient in any movement response, and those – like John Exner – who want to drop this condition from the definition. This controversy is shown to involve another fundamental issue, namely: In what sense is movement a determinant, and what should be meant by a determinant? The third section also discusses a main objection against keeping Rorschach’s original definition: its reliance on introspective criteria. The fourth part takes a historical perspective, describing the philosophical and psychological tradition called associationism, discussing certain ideas concerning kinesthetic sensibility brought forward within that tradition, and finally analyzing the nature and extent of Hermann Rorschach’s commitment to associationism, especially as manifested in his doctoral dissertation. -

Das Ärztepaar Rorschach Im Appenzellerland
Innovation aus dem PZA : das Ärztepaar Rorschach im Appenzellerland Autor(en): Blum, Iris Objekttyp: Article Zeitschrift: Appenzeller Kalender Band (Jahr): 287 (2008) PDF erstellt am: 01.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-377347 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch x no ^o Innovation aus dem PZA. Das Ärztepaar Rorschach im Appenzellerland Iris Blum Ein unscheinbares Haus im med. Olga Rorschach, Innere- (1917-2006), Tochter von Olga Sonnenberg in Teufen: Wer hier auf und Nervenkrankheiten» Rorschach und seine einstige dem kleinen Balkon im ersten angebracht war? Und dass im Garten Klassenkameradin, schrieb der Stock des Hauses am Sonnen- ein Junge und ein Mädchen ehemalige Sekundarlehrer 1991: bergweg 308 sitzt, dem bietet zeitweilig mit Patientinnen und «[...] Deine Mutter. -
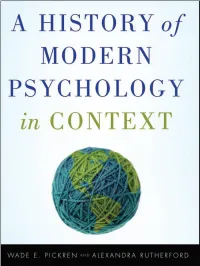
A History of Modern Psychology in Context / by Wade E
AHISTORYOF MODERN PSYCHOLOGY IN CONTEXT Wade E. Pickren and Alexandra Rutherford A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION This book is printed on acid-free paper. Copyright © 2010 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Published simultaneously in Canada. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under Section 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without either the prior written permission of the Publisher, or authorization through payment of the appropriate per-copy fee to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, (978) 750-8400, fax (978) 646-8600, or on the web at www.copyright.com. Requests to the Publisher for permission should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008. Limit of Liability/Disclaimer of Warranty: While the publisher and author have used their best efforts in preparing this book, they make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. No warranty may be created or extended by sales representatives or written sales materials. The advice and strategies contained herein may not be suitable for your situation. You should consult with a professional where appropriate. Neither the publisher nor author shall be liable for any loss of profit or any other commercial damages, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damages. -
A List of Dissertations on Or Related to Carl Jung Jonathon Erlen Ph.D. Has
A list of dissertations on or related to Carl Jung Jonathon Erlen Ph.D.* has provided the following list of dissertations extracted (in August 2016) from from ProQuest Dissertations & Theses Global database (copyright ProQuest LLC). They are not in any particular order. The language is English unless otherwise stated; an abstract is included if available. At institutions which have purchased the ProQuest databases, abstracts of most of the dissertations can be downloaded, and many entire texts can also be downloaded free of charge. A printed version of a dissertation can be purchased from ProQuest Company, 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, MI481 06-1346, USA (tel. 800-5210600). The religious implications of C. G. Jung Author: Proett, M. A. Identifier / keyword: Philosophy, religion and theology Psychology Jung, Carl G. Number of pages: 98 Degree and publication year: 1947 University/institution: University of Southern California Degree: A.M. Dissertation/thesis number: EP65166 ProQuest document ID: 1655006919 ____________________________________________________________ Religious implications of Jung’s psychology Author: Dawson, Eugene E. Identifier / keyword: Philosophy, religion and theology Number of pages: 239 Degree and publication year: 1949 University/institution: Boston University School of Theology, MA, USA Degree: Ph.D. Dissertation/thesis number: 0173754 ProQuest document ID: 301853132 * History of Medicine Librarian, Health Sciences Library System, and Assistant Professor of Behavioral and Community Health, University of Pittsburgh, USA ____________________________________________________________ Contributions of C.G. Jung’s psychology to a general theory of communication Author: Washburn, Donald Edward Identifier / keyword: Communication and the arts Number of pages: 460 Degree and publication year: 1962 University/institution: University of Denver, CO, USA Degree: Ph.D.