Women and World War II
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Romania and Cross-border Regional Development at the External EU Borders including a case study from the Romanian-Serbian border Verfasserin Susanne Hanger angestrebter akademischer Grad Magistra der Naturwissenschaften (Mag.a rer. nat.) Wien, im März 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 453 Studienrichtung lt. Studienblatt: Theoretische und Angewandte Geographie Betreuerin / Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Heintel Romania and Cross‐border Regional Development at the External EU Borders including a case study from the Romanian-Serbian border Acknowledgement The last few years taught me that I cannot achieve everything at once. Hence, this thesis had to come to an end, covering only fragments of what I wanted to say. However, a lesson I learned was that every once in a while it is necessary to finish what you are doing and start something new. I want to thank the people who supported me during all these years of learning: My parents, my brother and my closest friends; The people who built organisations with me, who believed in me and who showed me what great things can be achieved, if you are confident to do them; All the motivated students at the Department of Geography and Regional Research, who contribute to a great atmosphere of exchange, friendship and challenge and prove that Geography is really cool. Matthias Kopp who is responsible for the competent proof‐reading and moral support at all times, which I am truly thankful for. In terms of this thesis I also want to thank Martin Heintel, who inspired my interest in borders and regional policy and who was willing to supervise my thesis. -

Raoul Wallenberg, Hero and Victim – His Life and Feats. by Jill Blonsky
Raoul Wallenberg, hero and victim His life and feats By Jill Blonsky About the author Jill Blonsky resides in Chester, UK. As a long-standing member of the International Raoul Wallenberg Foundation (IRWF) she coordinates the activities of the ONG in the United Kingdom. Ms. Blonsky has a significant experience working with NGO's and charities and she holds a M.A. (Hons) degree in Russian studies with Distinction in English, Education and History subsidiaries. She also has studies in other disciplines, including Forensic Psychology and Egyptology. The International Raoul Wallenberg Foundation (IRWF) is a global-reach NGO based in New York, with offices also in Berlin, Buenos Aires and Jerusalem. The IRWF's main mission is to preserve and divulge the legacy of Raoul Wallenberg and his likes, the courageous women and men who reached-out to the victims of the Holocaust. The IRWF focuses on research and education, striving to instil the spirit of solidarity of the Rescuers in the hearts and minds of the young generations. At the same time, the IRWF organizes campaigns for Raoul Wallenberg, the victim, trying to shed light on his whereabouts. Amongst its most notable campaign, a petition to President Putin, signed by more than 20,000 people and the institution of a 500,000 Euro reward for reliable information about the fate of Raoul Wallenberg and his chauffer, Vilmos Langfelder, both of them abducted by the Soviets on January 17th, 1945. Contents: 1. The Lull before the Storm i. Attitude to Jews pre 1944 ii. The Nazis enter Hungary iii. The Allies Wake Up 2. -

Zvi Gitelman
ZVI GITELMAN Reconstructing Jewish Communities and Jewish Identities in Post- Communist East Central Europe The communist era left the Jews of East Central Europe with a varied legacy, but what they have had in common since 1990 is the ability to choose whether and how to identify as Jews and to reconstruct public Jewish life. They do not do so in isolation, but are influenced both by the societies and states in which they live and by world Jewry and Israel. Ultimately, the choices are theirs, but they are shaped by these external actors. The major issues to be resolved are the nature of Jewish identity and its meaning; how to relate to the post- communist states, their neighbors, world Jewry and the State of Israel; how to deal with the communist past and those who shaped public Jewish life in that period; the restitution of public and private Jewish properties; and the seemingly perennial issue of anti-Semitism. In the course of half a century (1939–1989) the great majority of Jews in East Central Europe were murdered, and the majority of those who survived were deprived of their Judaism and Jewishness. Unlike the Nazis, the communists did not try to destroy Jews, but their policies of official atheism and forced acculturation seriously eroded Judaism and Jewish identity, though the latter was kept alive in most East Central European societies by social and governmental anti-Semitism. Unlike the Soviet state, communist states in Eastern Europe did not identify Jews officially as such on their internal passports, but they kept records which allowed them to identify Jews. -

The Strzygowski School of Cluj. an Episode in Interwar Romanian Cultural Politics
The Strzygowski school of Cluj. An episode in interwar Romanian cultural politics Matthew Rampley Introduction: the legacy of Josef Strzygowski It has become increasingly evident that perhaps the most influential Viennese art historian of the interwar period was Josef Strzygowski. Although a decisive figure, whose appointment as Ordinarius in 1909 led factional rivalries and an institutional split, Strzygowski’s work achieved a far greater audience than his contemporaries. This was particularly the case in central Europe, where his work was adopted as a model in territories as disparate as Estonia and Yugoslavia. In part his influence was due to his sheer industriousness and the volume of his output, both in terms of research publications and students. Between 1909, when he took up his appointment at the Institute in Vienna, and 1932, when he retired, nearly 90 students graduated under his tutelage; this compares with 13 under Thausing and 51 under Riegl and Wickhoff combined. As one subsequent commentator has noted: ‘Looking back at Strzygowski’s career with the hindsight conferred by time, the most striking impression is that he was never still, perpetually buzzing around like a fly in a jam jar.’1 The range of subjects his students wrote on was bewilderingly diverse, and covered topics as diverse as Arnold Böcklin, murals in Turkestan, Iranian decorative art, domestic architecture in seventeenth-century Sweden, Polish Romanesque architecture and the sculpture of Gandhara.2 Many of Strzygowski’s students would go on to become prominent members of the art historical profession across central Europe, such as the Slovene Vojslav Molè (1886-1973), who would play an important role at the University of Cracow, Stella Kramrisch (1896-1993), Emmy Wellesz (1889-1987), Virgil Vătăşianu (1902-1993), a leading art historian in Romania, Otto Demus (1902-1990) and Fritz Novotny (1903-1983). -

Romanian-German Relations Before and During the Holocaust
ROMANIAN-GERMAN RELATIONS BEFORE AND DURING THE HOLOCAUST Introduction It was a paradox of the Second World War that Ion Antonescu, well known to be pro- Occidental, sided with Germany and led Romania in the war against the Allies. Yet, Romania’s alliance with Germany occurred against the background of the gradually eroding international order established at the end of World War I. Other contextual factors included the re-emergence of Germany as a great power after the rise of the National Socialist government and the growing involvement of the Soviet Union in European international relations. In East Central Europe, the years following the First World War were marked by a rise in nationalism characterized by strained relations between the new nation-states and their ethnic minorities.1 At the same time, France and England were increasingly reluctant to commit force to uphold the terms of the Versailles Treaty, and the Comintern began to view ethnic minorities as potential tools in the “anti-imperialist struggle.”2 In 1920, Romania had no disputes with Germany, while its eastern border was not recognized by the Soviet Union. Romanian-German Relations during the Interwar Period In the early twenties, relations between Romania and Germany were dominated by two issues: the reestablishment of bilateral trade and German reparations for war damages incurred during the World War I German occupation. The German side was mainly interested in trade, whereas the Romanian side wanted first to resolve the conflict over reparations. A settlement was reached only in 1928. The Berlin government acted very cautiously at that time. -

Arendt Hannah – Eichmann En Jerusalen
A partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer (teniente coronel de las SS) y uno de los mayores criminales de la historia, Hannah Arendt estudia en este ensayo las causas que propiciaron el holocausto, el papel equívoco que desempeñaron en tal genocidio los consejos judíos -cuestión que, en su época, fue motivo de una airada controversia-, así como la naturaleza y la función de la justicia, aspecto que la lleva a plantear la necesidad de instituir un tribunal internacional capaz de juzgar crímenes contra la humanidad. Poco a poco, la mirada lúcida y penetrante de Arendt va desentrañando la personalidad del acusado, analiza su contexto social y político y su rigor intachable a la hora de organizar la deportación y el exterminio de las comunidades judías. Al mismo tiempo, la filósofa alemana estudia la colaboración o la resistencia en la aplicación de la Solución Final por parte de algunas naciones ocupadas, expone problemas que aún hoy día no se han dilucidado -la relación entre la legalidad y la justicia- y cuya trascendencia sigue determinando la escena política de nuestros días.Treinta años después de su publicación, “Eichmann en Jerusalén” sigue siendo uno de los mejores estudios sobre el holocausto, un ensayo de lectura inaplazable para entender lo que sin duda fue la gran tragedia del siglo XX. Hannah Arendt Eichmann, en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal Hannah Arendt (1906-1975) Filósofa alemana de origen judío, se doctoró en filosofía en la Universidad de Heidelberg. Emigrada a Estados Unidos, dio clases en las universidades de California, Chicago, Columbia y Princeton. -

Raoul Wallenberg: Report of the Swedish-Russian Working Group
Raoul Wallenberg Report of the Swedish-Russian Working Group STOCKHOLM 2000 Additional copies of this report can be ordered from: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Fax: 08-690 9191 Tel: 08-690 9190 Internet: www.fritzes.se E-mail: [email protected] Ministry for Foreign Affairs Department for Central and Eastern Europe SE-103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 76 _______________ Editorial group: Ingrid Palmklint, Daniel Larsson Cover design: Ingrid Palmklint Cover photo: Raoul Wallenberg in Budapest, November 1944, Raoul Wallenbergföreningen Printed by: Elanders Gotab AB, Stockholm, 2000 ISBN: ISBN: 91-7496-230-2 2 Contents Preface ..........................................7 I Introduction ...................................9 II Planning and implementation ..................12 Examining the records.............................. 16 Interviews......................................... 22 III Political background - The USSR 1944-1957 ...24 IV Soviet Security Organs 1945-1947 .............28 V Raoul Wallenberg in Budapest .................32 Background to the assignment....................... 32 Operations begin................................... 34 Protective power assignment........................ 37 Did Raoul Wallenberg visit Stockholm in late autumn 1944?.............................................. 38 VI American papers on Raoul Wallenberg - was he an undercover agent for OSS? .........40 Conclusions........................................ 44 VII Circumstances surrounding Raoul Wallenberg’s detention and arrest in Budapest -

Nazi ‘Experts’ on the ‘Jewish Question’ and the Romanian-German Relations, 1940–1944
fascism 4 (2015) 48-100 brill.com/fasc Ideological Transfers and Bureaucratic Entanglements: Nazi ‘Experts’ on the ‘Jewish Question’ and the Romanian-German Relations, 1940–1944 Constantin Iordachi Associate Professor, Central European University, Department of History Budapest, Hungary [email protected] Ottmar Traşcă Research Fellow, Institute of History ‘George Baritiu’ Cluj-Napoca Romanian Academy of Science [email protected] Abstract This article focuses on the transfer of the Nazi legal and ideological model to East Central Europe and its subsequent adoption, modification and fusion with local legal-political practices. To illustrate this process, we explore the evolution of the anti-Semitic policy of the Antonescu regime in Romania (1940–1944) from an under- researched perspective: the activity of the Nazi ‘advisors on the Jewish Question’ dis- patched to Bucharest. Based on a wide range of published and unpublished archival sources, we attempt to provide answers to the following questions: To what extent did the Third Reich shape Romania’s anti-Semitic polices during the Second World War? What was the role played by the Nazi advisors in this process? In answering these ques- tions, special attention is devoted to the activity of the Hauptsturmführer ss Gustav Richter, who served as Berater für Juden und Arisierungsfragen [advisor to the Jewish and Aryanization questions] in the German Legation in Bucharest from 1st of April 1941 until 23 August 1944. We argue that, by evaluating the work of the Nazi experts in Bucharest, we can better grasp the immediate as well as the longer-term objectives * The authors would like to thank Sven Reichardt, K.K. -

The Supreme Commander of the Army the Department of the Civil Government of Transnistria Ordinance No
Annex The Supreme Commander of the Army the Department of the Civil Government of Transnistria Ordinance no. 23 We, ION ANTONESCU, Marshal of Romania, Commander-in-Chief of the Army: Through Professor G. ALEXIANU, Civil Governor; With regard to the fact that there is a large jewish population on the territory of Transnistria which has been evacuated from various battle-zones, in order to protect the rear of the front; With regard to the need to organize communal living for this evacuated population; Seeing that this population must find a means of existence on its own account and through labour; By virtue of the full powers accorded by Decree no. 1 of 19 August 1941, issued at Tighina; We command: Article 1 All jews who have come from the battle-front in Transnistria, as well as jews from Transnistria, who for the same reasons were moved into various centres, or those who remain to be moved, are subject to the rules of life established by this present ordinance. Article 2 The Inspectorate of Gendarmes in Transnistria determines the localities where the jews can be housed. The Jews will be housed with regard to the size of their family in the dwellings abandoned by the Russian or jewish refugees. Each family of jews who receive a dwelling will be obliged to tidy it up forthwith and to keep it clean. If there are not enough of these dwellings, the Jews will also be housed in private homes, which will be allocated to them, for which they will pay the determined rent. -

Nazi Germany and the Jews, 1933-1945
NAZI GERMANY AND THE JEWS, 1933–1945 ABRIDGED EDITION SAUL FRIEDLÄNDER Abridged by Orna Kenan To Una CONTENTS Foreword v Acknowledgments xiii Maps xv PART ONE : PERSECUTION (January 1933–August 1939) 1. Into the Third Reich: January 1933– December 1933 3 2. The Spirit of the Laws: January 1934– February 1936 32 3. Ideology and Card Index: March 1936– March 1938 61 4. Radicalization: March 1938–November 1938 87 5. A Broken Remnant: November 1938– September 1939 111 PART TWO : TERROR (September 1939–December 1941) 6. Poland Under German Rule: September 1939– April 1940 143 7. A New European Order: May 1940– December 1940 171 iv CONTENTS 8. A Tightening Noose: December 1940–June 1941 200 9. The Eastern Onslaught: June 1941– September 1941 229 10. The “Final Solution”: September 1941– December 1941 259 PART THREE : SHOAH (January 1942–May 1945) 11. Total Extermination: January 1942–June 1942 287 12. Total Extermination: July 1942–March 1943 316 13. Total Extermination: March 1943–October 1943 345 14. Total Extermination: Fall 1943–Spring 1944 374 15. The End: March 1944–May 1945 395 Notes 423 Selected Bibliography 449 Index 457 About the Author About the Abridger Other Books by Saul Friedlander Credits Cover Copyright About the Publisher FOREWORD his abridged edition of Saul Friedländer’s two volume his- Ttory of Nazi Germany and the Jews is not meant to replace the original. Ideally it should encourage its readers to turn to the full-fledged version with its wealth of details and interpre- tive nuances, which of necessity could not be rendered here. -
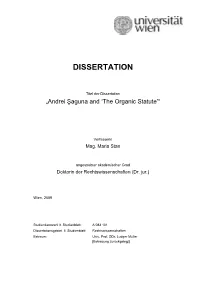
Dissertation
DISSERTATION Titel der Dissertation „Andrei Şaguna and ‘The Organic Statute’“ Verfasserin Mag. Maria Stan angestrebter akademischer Grad Doktorin der Rechtswissenschaften (Dr. jur.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 083 101 Dissertationsgebiet lt. Studienblatt: Rechtswissenschaften Betreuer: Univ. Prof. DDr. Ludger Müller [Betreuung zurückgelegt] TABLE OF CONTENTS PREFACE………………………………………………………………………………5 0. INTRODUCTION…………………………………………………………………..7 0.1 Overview of the research on the topic………………………………………………7 0.2 The period under research………………………………………………………….12 0.3 The sources………………………………………………………………………...12 0.4 Content and method ……………………………………………………………….14 I. HISTORICAL BACKGROUND………………………………………………….17 I.1 A historical outline of Transylvania until the end of the seventeenth century..17 I.1.1 From the Dacian State up to the Reform…………………………………………17 I.1.2 The Reform and its consequences in Transylvania………………………………24 I.2 Transylvania - a province of the Habsburg Empire……………………………28 I.2.1 Centralism and standardization versus historical privileged……………………..29 I.2.2 The church Union and its socio-political and religious consequences..………….34 I.2.3 The Orthodox Church after 1700; Canonical-jurisdictional matters……………..40 I.2.4 The ecclesiastical and social-political frame in the first half of the nineteenth century...............................................................49 II. THE FIRST YEARS OF ANDREI ŞAGUNA’S LIFE AND HIS ACTIVITY AS A VICAR-ADMINISTRATOR OF THE EPARCHY OF SIBIU …...………..57 II.1 Family roots……………………………………………………………………....57 -

Executive Summary
FINAL REPORT of the International Commission on the Holocaust in Romania Presented to Romanian President Ion Iliescu November 11, 2004 Bucharest, Romania NOTE: The English text of this Report is currently in preparation for publication. © International Commission on the Holocaust in Romania. All rights reserved. EXECUTIVE SUMMARY HISTORICAL FINDINGS AND RECOMMENDATIONS HISTORICAL FINDINGS Statement of Fact and Responsibility The Holocaust was the state-sponsored systematic persecution and annihilation of European Jewry by Nazi Germany, its allies, and collaborators between 1933 and 1945. Not only Jews were victimized during this period. Persecution and mass arrests were perpetrated against ethnic groups such as Sinti and Roma, people with disabilities, political opponents, homosexuals, and others. A significant percentage of the Romanian Jewish community was destroyed during World War II. Systematic killing and deportation were perpetrated against the Jews of Bessarabia, Bukovina, and Dorohoi County. Transnistria, the part of occupied Ukraine under Romanian administration, served Romania as a giant killing field for Jews. The Commission concludes, together with the large majority of bona fide researchers in this field, that the Romanian authorities were the main perpetrators of this Holocaust, in both its planning and implementation. This encompasses the systematic deportation and extermination of nearly all the Jews of Bessarabia and Bukovina as well some Jews from other parts of Romania to Transnistria, the mass killings of Romanian and local Jews in Transnistria, the massive execution of Jews during the Iasi pogrom; the systematic discrimination and degradation applied to Romanian Jews during the Antonescu administration—including the expropriation of assets, dismissal from jobs, the forced evacuation from rural areas and concentration in district capitals and camps, and the massive utilization of Jews as forced laborers under the same administration.