Die Àrachniden Tirols Nach Ihrer Horizontalen Und Verticalen Verbreitung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Absam · Gnadenwald · Thaur · Mils Der Verein
Zusammenkommen ist der Beginn, Zusammenhalten ist der Fortschritt, Zusammenarbeiten ist Erfolg. Henry Ford Ein Wegweiser für 365 Tage mobile Hauskrankenpflege. Inhaltsverzeichnis Gesundheits- und Sozialsprengel Hall i. T. · Absam · Gnadenwald · Thaur · Mils Der Verein .............................................................................................................................................................................................................................................4 Geschäftsstelle des Sozialsprengels / Kontakt .............................................................................................................................5 Hauskrankenpflege ....................................................................................................................................................................................................................6 Medizinische Hauskrankenpflege ..........................................................................................................................................................................7 Der Gesundheits- und Sozialsprengel ist ein Verein, gegründet 1981 von den Gemeinden Hall, Absam und Gnadenwald. Moderne Wundversorgung .............................................................................................................................................................................................8 1985 bzw. 1989 traten die Gemeinden Thaur und Mils als weitere Mitglieder dem Verein bei. Die Leistungen des Sprengels -
Von Hall Nach Wattens
VON HALL NACH WATTENS ... KULTURELLE REISE DURCH DIE REGION TOURISMUSVERBAND REGION HALL-WATTENS [email protected], www.hall-wattens.at HERZLICH WILLKOMMEN! ir wünschen Ihnen Rund um Hall bietet die Zeit ... Region Sehenswürdigkeiten, W... zum Herum- Erholsames und Sportliches sitzen, Hineinhören und vor einer unvergesslichen Hinausschauen. Zwischen Naturkulisse. Das wildroman- mittelalterlichen Fassaden der tische Halltal oder die Stadt Hall und den modernen aussichtsreiche Thaurer Installationen in den Swarov- Alm – die Gnadenwalder ski Kristallwelten wird Ihnen Höhenstraße oder das eine große Zahl an Augen- Wanderparadies Watten tal blicken vergönnt sein. – überall finden sich Orte Die Altstadt von Hall gehört zum Erholen, Schauen und zu den größten erhaltenen Entdecken – und nirgendwo historischen Anlagen – doch wird der nächste Bach mit nicht als Museum. Belebt Trinkwasserqualität weit sein! und voller moderner Lebens- freude finden Sie modernes Wir freuen uns, dass Sie zu Einkaufserlebnis und stilvolle uns kommen und wünsch en Gastlichkeit zwischen ge- Ihnen einen erholsamen und schichtsträchtigen Mauern. erlebnisreichen Aufenthalt. HALL IN TIROL Das Klappern von Rädern auf den Pflaster- steinen, das Knarren alter Türen, das Läuten der Kirchturmglocken, Unterhaltung quer über enge Gassen, von Fenster zu Fenster. eräusche, die das Leben eine Salzkufe konnte somit auch schon 1303 begleiteten, das geeignete Symbol für das Gals Herzog Otto an Hall Stadtwappen von Hall sein. Auf (hal = Salz) das Stadtrecht verlieh rotem Grund wurde es später und damit eindrucksvoll die Be- von Kaiser Maximilian I. durch deutung dieses Ortes bestätigte, in zwei gekrönte goldene Löwen dem aus Salz pures Gold wurde. aufgewertet. Die Herren und Fürsten dieser Über den Inn wurde das Salz Zeit saßen noch auf dem Schloss verschifft und Hall wurde zu einer in „Taurane“. -
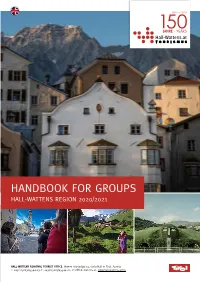
Handbook for Groups Hall-Wattens Region 2020/2021
HANDBOOK FOR GROUPS HALL-WATTENS REGION 2020/2021 HALL-WATTENS REGIONAL TOURIST OFFICE, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria T: +43(0)5223/45544-23, F: +43(0)5223/45544-20, [email protected], www.hall-wattens.at/en PANORAMA OF THE REGION HALL-WATTENS 2.677 m 2.246 m Brenner 30 km www.glungezerbahn.at www.kugelwald.at Voldertal Tulfes Hall in Tirol 574 m Volders Wattental Wattenberg 2.334 m 2.726 m Zürich 300 km Thaur Absam ➜ Mils Gnadenwald Baumkirchen Wattens Fritzens Wien 470 km München 160 km WELCOME TO THE HALL-WATTENS REGION! umerous treasures await guests culture, tradition and modernity, pro- Your point of contact here: such as famous Swarovski vides exciting contrasts and an optimal for group enquiries and N Crystal Worlds, the ancient town setting for a one-of-a-kind stay. bookings, program tips, of Hall with the biggest historical quar- We would be more than happy to cus- information and ter in western Austria, wild and untamed tom-tailor holiday programs appropria- all other questions: Halltal valley in the Karwendel moun- te to your individual travel needs, as well Department for groups: tains, the pilgrimage basilica in Absam, as to assist you in learning more, selec- Your contact Anne Welling Hall Mint, and so much more. In additi- ting and reserving the various program Hall-Wattens Regional Tourist Office on, the Hall-Wattens region profits from elements. We look forward to hearing A-6060 Hall in Tirol an ideal location in the heart of Tyrol. from you. -

Unbewegliche Und Archäologische Denkmale Unter Denkmalschutz 01.07.2021 (Rechtlich Nicht Verbindlich) Gemeinde KG Katalogtitel Adresse GSTK-Nr
Tirol unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz 01.07.2021 (rechtlich nicht verbindlich) Gemeinde KG Katalogtitel Adresse GSTK-Nr. Denkmalschutzstatus Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Aigner-Badl Abfaltersbach 13, 9913 Abfaltersbach 855 Denkmalschutz per Bescheid Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Hafnerei Steger Abfaltersbach 14, 9913 Abfaltersbach 55/1, .134, .23/1 Denkmalschutz per Bescheid Abfaltersbach 23, 9913 Abfaltersbach Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Aigner-Kasten (bei) 851 Denkmalschutz per Bescheid Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Widum Abfaltersbach 24, 9913 Abfaltersbach 8/1 Denkmalschutz per Verordnung Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Ehem. Widum Abfaltersbach 46, 9913 Abfaltersbach .94 Denkmalschutz per Bescheid Bahnhof Abfaltersbach, Denkmalschutz per Bescheid Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Aufnahmsgebäude Abfaltersbach 71, 9913 Abfaltersbach .56/3 (Unterschutzstellung §3) Denkmalschutz per Bescheid Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Gütermagazin beim Bahnhof Abfaltern Abfaltersbach 9913 Abfaltersbach 178/1 (Unterschutzstellung §3) Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Lourdeskapelle Abfaltersbach 9913 Abfaltersbach .126 Denkmalschutz per Bescheid Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Römische Villa Gesellhaus 9913 Abfaltersbach 215, 191 Denkmalschutz per Bescheid Kath. Filialkirche, Mariae Heimsuchung Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach in Abfaltersbach 843 Denkmalschutz per Verordnung Kath. Pfarrkirche hl. Andreas in Abfaltersbach 85201 Abfaltersbach Abfaltern .96, 446 Denkmalschutz per Verordnung Abfaltersbach -

INNSBRUCK NEUTRAL ZONE Distanz Km Timing Höhe Platz NACH NOTIZEN Straße Dist
Stage 5 / 5 a Tappa / Etappe 5 Friday 20 April / Venerdi 20 Aprile / Freitag 20 April RATTENBERG - INNSBRUCK NEUTRAL ZONE Distanz km Timing Höhe Platz NACH NOTIZEN STRAßE Dist. Zur. Ver. 24 km/h 26 km/h 28 km/h TRATTO DI TRASFERIMENTO RATTENBERG - INIZIO TRASFERIMENTO Da Sparkassen-Platz Siedlung 0,0 1,3 10 : 40 10 : 40 10 : 40 Tenere la destra Siedlung 0,5 0,5 0,8 10 : 41 10 : 41 10 : 41 Incrocio A sinistra Dir. Kufstein B 171 Tiroler Strasse 0,1 0,6 0,7 10 : 41 10 : 41 10 : 41 Partenza - km ZERO B 171 Tiroler Strasse 0,7 1,3 0,0 10 : 43 10 : 43 10 : 42 RATTENBERG - INNSBRUCK km 164,2 Distanz km Timing Höhe Platz NACH NOTIZEN STRAßE Dist. Zur. Ver. 37 km/h 39 km/h 41 km/h 521 RATTENBERG KM "0" B 171 - Tiroler Straße 0,0 164,2 10 : 45 10 : 45 10 : 45 Kundl Sinistra Dir. Breitenbach am Inn L 48 - Biochemiestraße 6,7 6,7 157,5 10 : 55 10 : 55 10 : 54 Kundl Diritto L 48 - Doktor Hans Backmann St. 0,6 7,3 156,9 10 : 56 10 : 56 10 : 55 Kundl Rotatoria - sx Dir. Breitenbach am Inn L 48 - Breitenbach Landesstraße 0,6 7,9 156,3 10 : 57 10 : 57 10 : 56 510 Breitenbach am Inn Rotatoria - dx Dir. Mariastein, Angerberg L 211 - Dorf 0,7 8,6 155,6 10 : 58 10 : 58 10 : 57 Breitenbach am Inn Destra Dir. Mariastein, Angerberg L 211 0,6 9,2 155,0 10 : 59 10 : 59 10 : 58 Strass L 211 0,3 9,5 154,7 11 : 00 10 : 59 10 : 58 Kleinsoll L 211 1,4 10,9 153,3 11 : 02 11 : 01 11 : 00 Glatzham L 211 2,0 12,9 151,3 11 : 05 11 : 04 11 : 03 660 Angerberg L 213 2,2 15,1 149,1 11 : 09 11 : 08 11 : 07 502 Angath L 213 - Angerberger Straße 3,0 18,1 146,1 11 : 14 11 : 12 11 : 11 Ponte fiume Inn L 213 - Europastraße 0,5 18,6 145,6 11 : 15 11 : 13 11 : 12 Incrocio Sinistra Dir. -

Mit Tourenprogramm! Haller Alpenvereinsabend 132
Mitgliederzeitschrift Alpenverein Hall in Tirol 32 Foto: Gerald Aichner Gerald Foto: Mit Tourenprogramm! Haller Alpenvereinsabend 132. Hauptversammlung Fr 11. März 19:00 h Hall, Kolpinghaus Nr. 32 • März 2016 alpenverein.at/hall-in-tirol • glungezer.at • lizumerhuette.at Alpenverein Hall in Tirol ❱ „Das Bereisen der Alpen erleichtern“ Liebe Mitglieder im Alpenverein Hall! „Um die Kenntnisse von den Alpen zu erweitern, die Liebe zu ihnen zu fördern und ihre Berei- sung zu erleichtern“, ist der Österreichische Al- penverein im Jahr 1862 ÖAV-Statuten 1862 gegründet worden. Diese Ziele sind zeitlos aktuell geblieben. der Hauptversammlung am 11. März als Trai- Um sich heuer wieder mehr darauf zu besinnen, ler für zwei Vorträge präsentiert. haben wir mit unserem Alpinteam erstmals schon sehr frühzeitig unser Programm bis Jahresende „Transalp mit Packpferd: Vier Hufe für eine entwickelt, das wir Ihnen im Mittelteil vorstellen. Auszeit“ - Der erste Multivisonsvortrag doku- Und Sie gleichzeitig jetzt schon zur Teilnahme ein- mentiert „Die Alpen“ am Beispiel einer Fernwan- laden wollen, sich das eine oder andere vorzu- derung „über die Drei Zinnen“. Dietmar Obert merken, gegebenenfalls auch schon anzumelden. führt uns bei dieser Alpenüberquerung zu Fuß Nachdem „die wahren Abenteuer im Kopf statt- und mit Packpferd von Freiburg im Schwarzwald finden“ (Aphorismus von Unbekannt bzw. Song- (Süddeutschland) durch die Schweizer Alpen text von André Heller), wollen wir Ihnen in einer nach Italien. Der Multivisionsvortrag findet am Trilogie Trans Alp3 „Lust auf die Alpen“ und auf 8. April im Kurhaus Hall statt. unser Tourenprogramm vermitteln. „2000 km Freiheit - Zu Fuß von Wien über Trans Alp3 die Alpen nach Nizza“ lautet das Thema des 2. -

Group Packages 2021/2022
GROUP PACKAGES 2021/2022 HALL-WATTENS REGIONAL TOURIST OFFICE, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria T: +43(0)5223/45544-23, F: +43(0)5223/45544-20, [email protected], www.hall-wattens.at/en CRYSTAL-HIGHLIGHTS IN THE HEART OF TYROL DEAR GROUP PARTNERS! We are delighted to present you our programme suggestions. hese programmes have been spe- bus parking in the center of Hall in Ti- More Information: cially designed for groups, com- rol, only a 2-minute walk from the Old Department for groups: T bining highlights from our Hall- Town, which all groups are welcome to Your contact Wattens Region, in the very heart of the use free of charge. Each programme can Mrs. Anne Welling Tyrol. Enjoying a location that is, both be “tweaked” however you prefer, and Hall-Wattens Tourist Board from a transportation and a geographi- can of course also be booked in other A-6060 Hall in Tirol cal perspective, quite ideal, the region accommodation categories. On request, T: +43(0)5223/45544-0 allows for many different programme we would also be more than happy to F: +43(0)5223/45544-20 combinations, as well as being perfect- offer you packages that are completely [email protected] ly suited for the occasional overnight custom-tailored. We look forward to re- www.hall-wattens.at/en stop-off. In addition, there is an area for ceiving your enquiry! Gnadenwald München Salzburg CZ FRITZENS BAUMKIRCHEN CRYSTAL-HIGHLIGHTS IN ABSAM PASSAU THAUR WATTENS A22 A7 D A8 ST.PÖLTEN SK HALL IN Oberösterreich A1 WIEN INNSBRUCK MÜNCHEN LINZ A21 RUM TIROL -

Jungzüchterschau Innsbruck-Land 17.11.2018 KAT
20 JAHRE JUNGZÜCHTER BEZIRK Innsbruck Land Jungzüchterschau Innsbruck-Land 17.11.2018 KAT. NAME GEB.-DAT VATER MUTTERSVATER VORNAME NACHNAME ORT JAHRGANG GRUPPE 1 HF Kalbinnen VORFÜHRUNG TYPSIEGER 20 Derby 15.09.2017 Atshott RC Gold Chip Eberl Andreas Kolsassberg 2004 2 21 Annamabell 29.11.2016 Doorsopen Xacobeo Eberl Mathias Kolsassberg 2002 1 1 22 GH Widcherry 14.12.2017 Abricot RC Destry RC Garzaner Simon Fritzens 2000 3 2 23 Wolke 25.06.2017 Estien Red Savard Red Schwaninger Veronika Wattens 1999 5 24 Felize 24.11.2017 Damion Exol Haller David Mutters 1998 4 25 Bess 06.10.2017 Byway Atwood Riedl Christoph Mutters 1998 6 GRUPPE 2 TX Kalbinnen zgl. Typgesamtentscheidung VORFÜHRUNG TYPSIEGER 58 Kasandra 09.11.2016 Silvio Berni Moser Sarah Ellbögen 1999 3 2 59 Sophie 29.08.2016 Amadeus Antonius Mair Benjamin Trins 1999 2 1 60 Wilburg 30.03.2016 Salsa John Kiechl Michael Ellbögen 1991 4 61 Lara 05.12.2016 Amadeus Berni Hölzl Manuel Innsbruck 1990 1 GRUPPE 3 HF Kalbinnen VORFÜHRUNG TYPSIEGER 26 Roccala 11.12.2017 Silver Sid Hörtnagl Johannes Fulpmes 1998 4 27 Edelweiß 24.12.2016 Amort Red Alexander Mair Magdalena Mils 1996 2 2 28 Klara 22.04.2016 Pinkman Velvet Seeber Magdalena Lans 1996 3 29 Regency 28.11.2017 Fitz Mascalese Mair Christoph Telfes i. S. 1996 1 1 30 Wally 10.04.2016 Aron Red Marius Sailer Martin Vomp 1995 6 31 Rosalie 08.06.2017 Alonzo Knowledge Schwaninger Clemens Wattens 1994 5 GRUPPE 4 PS Kalbinnen Typgesamtentscheidung VORFÜHRUNG TYPSIEGER 66 Estefania PSS 27.08.2016 Fercan Pss Oliver PSR Rofner Lucas Vill 1998 4 1 67 Torellia PSS 21.06.2016 Elvis PPS Ossi PSS Hölzl Benjamin Ellbögen 1992 5 68 Eleonore PSS 04.05.2016 Olaf PSS Orion PSS Haider Florian Ellbögen 1992 2 2 69 Wyonna PSS 22.07.2016 Ozo PSR Orion PSS Gredler Florian Ellbögen 1991 3 70 Rosalie PSR 14.03.2016 Bumsti PSS Elvis PSS Mair Alois Ellbögen 1990 1 Hannes Leitner 19.11.2018 20 JAHRE JUNGZÜCHTER BEZIRK Innsbruck Land KAT. -

In and Around Innsbruck Is Vast Von Innsbruck Aufs Miemingertotal Plateau Length Und of Tour: Retour 80 Km Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, Tel
THE KARWENDEL TOUR: 3 TOUR FACTS EMERGENCY REPAIRS LOCAL TOUR ADVICE AROUND THE NATURE PARK Start and finish: Innsbruck Up the mountain, through the valley, along some lakes: the tour through Elevation gain: 550 m It only takes a few minutes by road bike to get out of the city. For a Is your bike broken? Don’t worry, these eleven specialists provide help: the Karwendel mountain range is a perfect example of variety of cycling Alpin Bike, Planötzenhofstraße 16, tel. +43 664 / 13 43 230 convenient and traffic-free escape, choose one of the many broad cycle Highest point: 869 m experiences in the Alps. The trip starts with a flat entry in Innsbruck and tracks. The choice of tours available in and around Innsbruck is vast Von Innsbruck aufs MiemingerTotal Plateau length und of tour: retour 80 km Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, tel. +43 512 / 36 12 75 R O A D continues with a tough mountain climb from Telfs to Leutasch. From and diverse, offering unique views of the city, the countryside, and the Bikes and More, Herzog-Siegmund-Ufer 7, tel. +43 512 / 34 60 10 there, several climbs and descents along the Isar river will lead you Level of difficulty: beginner alpine scenery. It provides everyone, from hobby cyclists to professional BKD, Burgenlandstraße 29, tel. +43 512 / 34 32 26 through the Karwendel mountains to the Achensee Lake. Your return to Elevation profile: athletes, with an opportunity to take on challenges appropriate to their Innsbruck will take you through the Inntal Valley. 900 Die Börse, Leopoldstraße 4, tel. -

Pilgrimage in Absam in Tyrol
Pilgrimage in Absam in Tyrol The image of the Virgin Mary at Absam Let us read what Johann Puecher, Rosina's brother, wrote about what happened in 1797 in their father's house. At the age of 76, he wrote the following in the presence of two witnesses: "On 17th January 1797 my sister, a grown girl (18 years of age) by the name of Rosina was sitting at the table by the window on the ground-floor room sewing. She then - between 3 and 4 o'clock - suddenly looked up and saw what had never been seen before, drawn on a window pane, an image of Mary, the Mother of God. She called to her mother, who was also present, but in another part of the room. Mother hurried over and was initially not a little frightened, when she saw the image of the Holy Virgin, as she thought an accident could have befallen father or myself in the salt-mine where we worked. She said to sister Rosanna that we should pray; and that is what happened. After saying their prayers, the mother wiped the picture with a cloth, because she thought it was steamed up, but look, scarcely had she wiped it off, but it was back just as it was before. The apparition of the image took place on a Tuesday, and on the Thursday me and my father came home perfectly well from the mountain. We looked with joy and amazement at what we had occurred. On 17th January 1797 I was in my 16th year and have retained in my memory everything that happened on that day." (The original copy of this record is in private ownership. -

Neue Pilzfunde Aus Tirol. Ein Beitrag Zu Kenntnis Der Pilzflora Tirols
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Sydowia Jahr/Year: 1950 Band/Volume: 4 Autor(en)/Author(s): Moser Meinhard Michael Artikel/Article: Neue Pilzfunde aus Tirol. Ein Beitrag zu Kenntnis der Pilzflora Tirols. 84-123 ©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Neue Pilzfunde aus Tirol. Ein Beitrag zu Kenntnis der Pilzflora Tirols. '> • " '*•-• '••-• Von Meinhard Moser (Innsbruck). •• • •••••••• ' ;•. Im Zuge verschiedener mykologischer Untersuchungen der letz- ten Jahre ergab sich auch eine eingehende Beschäftigung mit der Pilzflora Tirols. Ich konnte dabei zahllose neue Standorte feststellen, aber auch eine sehr grosse Anzahl von Arten finden, die bisher für Tirol, zum Teil darüber hinaus für das ganze Ostalpengebiet etc. noch nicht nachgewiesen waren. Es scheint mir daher nicht un- angebracht, eine Zusammenstellung dieser Arten zu bringen, zumal dadurch auch ein kleiner Beitrag zur Kenntnis des Verbreitungs- areals verschiedener seltenerer Arten geleistet wird. Ich nehme alle Arten auf, die bisher für Nordtirol noch nicht bekannt sind, und alle Arten, die in der Flora von Tirol von Dalla Torre-Sarnt- h e i n, also aus dem Gebiet von Nord-, Süd-, Osttirol und Vorarlberg nicht erwähnt sind, bzw. auch in später erschienenen Beiträgen nicht angeführt werden; sie sind in der folgenden Aufzählung durch ein dem Namen vorgesetzten * bezeichnet. Der grösste Teil des Materials wurde in den Sommern 1943, 1948 und 1949 gesammelt. 1948 führte ich wöchentlich durchschnittlich zwei Sammelexkursionen durch, wobei weite Gebiete Nordtirols be- sucht wurden. Ich möchte an dieser Stelle auch allen danken, die mich dabei unterstützt haben, besonders Frau Dr. -

In and Around Innsbruck
THE KARWENDEL TOUR: 3 TOUR FACTS EMERGENCY REPAIRS LOCAL TOUR ADVICE AROUND THE NATURE PARK Start and fi nish: Innsbruck Up the mountain, through the valley, along some lakes: the tour through the Elevation gain: 550 m It only takes a few minutes by road bike to get out of the city. For a convenient Is your bike broken? Don’t worry, these eleven specialists provide help: Karwendel mountain range is a perfect example of variety of cycling experi- Alpin Bike, Planötzenhofstraße 16, tel. +43 664 / 13 43 230 and traffi c-free escape, choose one of the many broad cycle tracks. The choice Highest point: 869 m ences in the Alps. The trip starts with a fl at entry in Innsbruck and contin- Bike Point Radsport, Gumppstraße 20, tel. +43 512 / 36 12 75 of tours available in and around Innsbruck is vast and diverse, offering unique Von Innsbruck aufs MiemingerTotal Plateau length undof tour: retour 80 km R O A D ues with a tough mountain climb from Telfs to Leutasch. From there, several views of the city, the countryside, and the alpine scenery. It provides everyone, Bikes and More, Herzog-Siegmund-Ufer 7, tel. +43 512 / 34 60 10 climbs and descents along the Isar river will lead you through the Karwendel Level of diffi culty: beginner from hobby cyclists to professional athletes, with an opportunity to take on BKD, Burgenlandstraße 29, tel. +43 512 / 34 32 26 mountains to the Achen Lake. Your return to Innsbruck will take you through Elevation profile: challenges appropriate to their individual levels.