Oberpullendorf Von Josef Loibersbeck, Eisenstadt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Und Abwasserverband – Lockenhaus Und Umgebung –
WASSER- UND ABWASSERVERBAND – LOCKENHAUS UND UMGEBUNG – WASSER- UND ABWASSERVERBAND – LOCKENHAUS UND UMGEBUNG – WASSER- UND ABWASSERVERBAND LOCKENHAUS UND UMGEBUNG Vorwort Landeshauptmann Hans Peter Doskozil er 1959 aus der Pla- Gemeinden unter Nutzung der re- nung einer Ringwas- gionalen Ressourcen sein. Nur ein serleitung hervor- gesundes Wachstum kann das Bur- gegangene Wasser- genland voranbringen. Der Wasser- Dund Abwasserverband und Abwasserverband trägt ent- Lockenhaus und Umgebung hat sich scheidend zur hohen Lebensqualität in den vergangenen Jahrzehnten der Menschen bei und hat auch für als verlässlicher Partner in der eine erfolgreiche wirtschaftliche Wasserversorgung und der Aufberei- und touristische Entwicklung der tung von Abwasser etabliert. Mit Region eine wichtige Funktion. der Errichtung seiner vollbiologi- schen Zentralkläranlage in Klos- Ich danke dem Wasser- und Abwas- termarienberg 1976 nahm der Ver- serverband Lockenhaus für seine band bereits damals eine Vorrei- Leistung für die Region, gratuliere terrolle in Sachen Nachhaltigkeit herzlich zum 60-jährigen Bestands- ein – und dient in Zeiten, in denen jubiläum und wünsche alles Gute wir uns ernsthafte Gedanken um für die Zukunft! Klimaschutz machen müssen, als leuchtendes Beispiel. Der Wasser- und Abwasserverband Lockenhaus und Umgebung hat we- sentlich dazu beigetragen, das wirt- schaftliche Wachstum der Region mit einer intakten Natur in Einklang zu bringen. Das ist der Weg, den auch das Burgenland gehen will: Das Ziel muss eine nachhaltige Hans Peter Doskozil Entwicklung des Landes und der Landeshauptmann des Burgenlandes 4 WASSER- UND ABWASSERVERBAND LOCKENHAUS UND UMGEBUNG Vorwort Landesrat Heinrich Dorner auberes Wasser – wie gestellt, dass das Trinkwasser für wir es im Burgenland die Menschen in der Region den haben - ist in vielen strengen Qualitätsrichtlinien ent- Teilen Europas und der spricht und leistbar ist. -

2Nd Report by the Republic of Austria
Strasbourg, 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 [English only] SECOND REPORT SUBMITTED BY AUSTRIA PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Received on 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 TABLE OF CONTENTS PART I...................................................................................................................................5 I.1. General Remarks..............................................................................................................5 I.2. Comments on the Questions and the Resolution of the Council of Europe ........................7 PART II ...............................................................................................................................17 II.1. The Situation of the National Minorities in Austria .......................................................17 II.1.1. The History of the National Minorities .......................................................................18 The Croat minority in Burgenland ........................................................................................18 The Slovene minority ...........................................................................................................19 The Hungarian minority .......................................................................................................21 The Czech minority..............................................................................................................21 The Slovak minority.............................................................................................................22 -

Vineyard Interfaces in the Heart of Europe Northbound Journey
VINEYARD INTERFACES IN THE HEART OF EUROPE NORTHBOUND JOURNEY NAME: #austrianwine | #winesummit | 23–26 May 2019 Download Catalogue, Tasting Lists & Photos: www.austrianwine.com/wine-summit Social Media & Press AUSTRIAN WINE SOCIAL MEDIA CHANNELS Follow us, if you love Austrian Wine as much as we do ♥ Share your favourite moments with #austrianwine and #winesummit Instagram @austrianwine | @austrianwineuk | @austrianwineusa Facebook @oesterreichwein | @austrianwine YouTube www.youtube.com/oesterreichwein EVENT PRESS KITS with specially selected information about the winegrowing country Austria. www.austrianwine.com/press-kit Preface WELCOME TO AUSTRIA! © AWMB/Anna Stöcher We are so very glad to welcome you to this lersee, Mittelburgenland and Eisenberg year’s Austrian Wine Summit, Vineyard – all adjacent to Hungary – to Vulkanland Interfaces in the Heart of Europe! Although Steiermark, bordering on Slovenia. Accre- each Wine Summit is unique, this one feels dited specialists will elucidate the historical very special to me, as it fulfils a longtime development of each border region, while dream of mine: to pay a dedicated visit to wines from our Czech, Slovakian, Hunga- some of Austria’s best vineyards – speci- rian and Slovenian friends will accompany fically, those that lie at the borders of our you throughout your visit. country; these borders that never were bor- ders until after 1918. New lines of demar- Finally, you will assemble in Vienna with cation were drawn then, which abruptly di- your colleagues from the other Wine Sum- vided excellent terroirs, leaving the parts in mit groups for a day’s conference dedica- separate countries and leading to a century ted to the history of Austrian wine. -

The Impact the Collapse of the Habsburg Monarchy by Michaela and Prof
The impact the collapse of the Habsburg Monarchy By Michaela and Prof. Dr. Karl Vocelka (Article from: “Wine in Austria: The History”) The end of the First World War in 1918 produced profound consequences for Central Europe, affecting every sphere of activity within the region, ranging from high-level political decisions to the everyday lives of the inhabitants. The outcome of the ‘great seminal catastrophe of this (20th) century’ (George F. Kennan) had long-term consequences, which endure to the present day. The Second World War of 1939–1945, the Cold War that persisted in Europe until 1989, as well as the creation and expansion of the European Union are all inseparable from developments that occurred during and immediately after the Great War. A significant influence was also exerted – in an international context – on viticulture in Austria, which provides us with our current subject. This was brought about by a new world order of nation states, including the establishment of the Republic of German-Austria on 12 November 1918, on territory formerly ruled by the Habsburg Monarchy. Although the dissolution of the multinational Habsburg Empire had begun before the end of the war, a final line was not drawn until two peace agreements were concluded in the Parisian suburbs in 1919. The borders of the new Republic of Austria were set out in the Treaty of Saint- Germain-en-Laye on 10 September 1919.1 The country’s border with Hungary was established by the subsequent Treaty of Trianon in 1920.2 The victorious powers forbade the planned union with Germany and prohibited use of the name German-Austria. -

Bevölkerungsbeteiligung
Bevölkerungsbeteiligung Vorstand Obmann: BM Mag. Norbert DARABOS Obmann Stv.: LAbg. Bgm. Wilhelm HEIßENBERGER Schriftführer: Bgm. Ing. Paul PINIEL, Weppersdorf Kassier: Paul MAYERHOFER, Neckenmarkt Weitere Vorstandsmitglieder: LAbg. Bgm. Werner BRENNER Gemeinde Lockenhaus Elisabeth DORN, Oberpullendorf Frauen, Soziales Josef FUCHS, Hochstraß Landwirtschaft Dir. Gerhard GLÖCKL, Neutal Bildung Bgm. Franz HOSCHOPF Gemeinde Weingraben Ing. Anton IBY, Horitschon Landwirtschaft, Wein Herbert ROSENITSCH, Glashütten, Wirtschaft Bgm. Stefan ROZSENICH Gemeinde Großwarasdorf Dir. Mag. Helene SCHÜTZ-FATALIN, Bubend. Jugend Franz STIFTER, Steinberg-Dörfl Tourismus Strategieteam LAbg. Bgm. Werner BRENNER, Vorstand Elisabeth DORN, Vorstand Dir. Gerhard GLÖCKL, Vorstand LAbg. Bgm. Wilhelm HEIßENBERGER, Vorstand Ing. Anton IBY, Vorstand Paul MAYERHOFER, Vorstand Franz STIFTER, Vorstand WHR Mag. Georg SCHACHINGER, RMB Heidi DRUCKER, GFin und LAG Managerin Mitglieder Gemeinde Deutschkreutz Gemeinde Neutal Gemeinde Draßmarkt Gemeinde Niktisch Gemeinde Frankenau -Unterpullendorf Gemeinde Oberloisdorf Gemeinde Großwarasdorf Gemeinde Oberpullendorf Gemeinde Horitschon Gemeinde Pilgersdorf Gemeinde Kaisersdorf Gemeinde Piringsdorf Gemeinde Kobersdorf Gemeinde Rainding Gemeinde Lackenbach Gemeinde Ritzing Gemeinde Lackend orf Gemeinde Steinberg-Dörfl Gemeinde Lockenhaus Gemeinde Stoob Gemeinde Lutzmannsburg Gemeinde Unterfrauenhaid Gemeinde Mannersdorf a. d. Rabnitz Gemeinde Unterrabnitz-Schwendgraben Gemeinde Markt St. Martin Gemeinde Weingraben Gemeinde Neckenmarkt -

7941 Oberpullendorf - Klostermarienberg - Langental Betreiber: Blaguss Reisen Gmbh Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien Tel: 050655-1333
Wien - Mattersburg - Forchtenstein - 7941 Oberpullendorf - Klostermarienberg - Langental Betreiber: Blaguss Reisen GmbH Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Wien Tel: 050655-1333. Alle Angaben ohne Gewähr Montag - Freitag (Werktag) Kursnummer 4 8 12 14 52 54 60 60 56 62 68 70 74 74 114 76 78 80 82 Verkehrshinweis 32 31ha 31ho 32 32CG 32 31 32 31 1 Wien Hauptbahnhof (L1) 9.10 12.15 12.15 12.15 12.45 13.15 13.25 13.45 14.45 15.00 15.40 16.00 16.15 2 - Matzleinsdorfer Platz 9.15 12.20 12.20 12.20 12.50 13.20 13.32 13.50 14.50 15.05 15.45 16.05 16.20 3 - Spinnerin am Kreuz 9.18 12.23 12.23 12.23 12.53 13.23 13.34 13.53 14.53 15.08 15.48 16.08 16.23 4 - Triester Str./Computerstr. 9.20 12.25 12.25 12.25 12.55 13.25 13.35 13.55 14.55 15.10 15.50 16.10 16.25 16 Wiener Neustadt IZ/Fa. Triumph 9.50 12.56 12.56 12.56 13.55 15.55 15.55 20 - Ungargasse/Corvinusring 10.05 11.10 12.10 13.10 13.10 13.10 14.10 16.05 16.05 16.30 24 Neudörfl Abzw. Pöttsching 10.09 11.14 12.14 13.14 13.14 13.14 14.14 14.15 16.09 16.09 16.34 16.49 29 Bad Sauerbrunn Abzw.Pöttsching 10.15 11.20 13.20 13.20 13.20 14.20 14.21 16.15 16.15 16.40 16.55 31 - Römersee 10.17 11.22 13.22 13.22 13.22 14.22 14.23 16.17 16.17 16.42 16.57 32 Wiesen-Sigleß Bahnhof 10.20 13.25 13.25 13.25 14.25 14.25 16.20 16.20 16.45 17.00 36 Pöttsching Rathaus/Hauptstraße 12.21 38 Sigleß Ortsmitte 11.28 40 Krensdorf Gemeindeamt 11.32 12.27 41 Kleinfrauenhaid Friedhof 11.35 12.30 43 Hirm Hauptplatz/Kirche 11.38 12.33 44 Antau Kleine Zeile 11.43 12.38 46 Stöttera Feuerwehr 11.46 12.41 48 Zemendorf Wr.-Neustädter-Str. -

Marktkalender 2021
JÄNNER Mo 29.03. Mattersburg Sa 22.05. Andau AUGUST Di 30.03. Jennersdorf, Lutzmannsburg Mo 24.05. Neudorf bei Landsee Mo 04.01. Neusiedl/See, Güssing So 01.08. St. Michael, Wiesmath Mi 31.03. Neckenmarkt Di 25.05. Oberloisdorf Mo 25.01. Großhöflein Mo 02.08. Neusiedl/See, Güssing So 30.05. Jennersdorf Sa 07.08. Illmitz APRIL Mo 31.05. Mattersburg FEBER So 08.08. Purbach Do 01.04. Rechnitz, Weppersdorf Di 10.08. Neckenmarkt Mo 01.02. Neusiedl/See, Güssing Sa 03.04. Podersdorf/See JUNI Do 12.08. Oberpullendorf Do 04.02. Rust Di 06.04. Neusiedl/See, Hornstein Di 01.06. Kirchschlag i.d.B.W. Sa 14.08. Gols, Unterfrauenhaid Di 09.02. Lutzmannsburg Sa 10.04. Wallern So 06.06. Rohrbrunn So 15.08. Gaas, Loretto Mo 22.02. Pöttsching Mo 12.04. Güssing, Zurndorf Mo 07.06. Neusiedl/See, Güssing Mo 16.08. Halbturn Sa 17.04. Unterfrauenhaid Di 08.06. Lutzmannsburg Di 17.08. Markt St. Martin Mo 19.04. Mönchhof Sa 21.08. Apetlon MÄRZ Sa 24.04. Jois Sa 12.06. Raiding, Rechnitz Mo 14.06. Zurndorf So 22.08. Königsdorf Mo 01.03. Neusiedl/See, Güssing So 25.04. Donnerskirchen, Minihof-Liebau Mo 23.08. Pöttsching Sa 06.03. Apetlon, Eisenstadt Di 27.04. Neudörfl Di 15.06. Kittsee Do 17.06. Weppersdorf Di 24.08. Oberloisdorf So 07.03. St. Michael Do 26.08. Kobersdorf Mo 08.03. Pamhagen MAI Fr 18.06. Hornstein Sa 19.06. Nikitsch, Wallern Sa 28.08. Andau, Kukmirn Do 11.03. -

The Burgenland Bunch a Cjreat Success
ORGAN DES VEREINES ZUR PFLEGE DER HEIMATVERBUNDENHEIT DER BURGENLÄNDER IN ALLER WELT Folge 7/8, Juli 1August 2001 Nr.372 46. Jahrgang The Burgenland Bunch A Cjreat Success Email and the Internet keep the memory of the "Auswanderung" Hap Anderson (Minnesota) established a Burgenland Bunch alive. website and helped by others, he maintains it. It averages 400 The Province of Burgenland has a long history but little is written contacts a month and there is more English language Burgen in English. There are many American descendants of land material available from that site than anywhere else. Burgenländers who emigrated to the United States, but very few It attracted our first Austrian members. Albert Schuch was one of know the language or villages of their ancestors. Villages now the first and soon became Burgenland editor due to his expertise have German names and church and civil records have moved and frequent articles. Later Klaus Gerger also joined the statt. as parish and district and offices changed. Dther learned correspondents in the United States found our site and we now have 15 dedicated editors. We've linked to other websites and have contacts with some ethnic clubs. Recently we began to share English articles with the BG and also translate some of their web site articles into English. We have over 700 members and are still growing. Anyone interested in the Burgen land can reach us via the Internet. Dur organization has created new interest in the Burgenland and some of our members are now visiting the "Heimat" for the first time, learning about their heritage or seeking and finding "lost" relatives. -

Gemeindeverzeichnis Des Burgenlandes 2019 IMPRESSUM
Gemeindeverzeichnis des Burgenlandes 2019 IMPRESSUM © Statistik Burgenland A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 T: +43 2682 600 2825 E: [email protected] www.burgenland.at Medieninhaber, Herausgeber und Verleger Statistik Burgenland Amt der Burgenländischen Landesregierung Landesamtsdirektion – Stabsstelle Präsidium A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 Redaktion und für den Inhalt verantwortlich Mag. Manfred Dreiszker T: +43 2682 600 2825 E: [email protected] Maria Stöger T: +43 2682 600 2830 E: [email protected] Gestaltungskonzept Atelier Unterkirchner Jankoschek, Wien Eisenstadt 2019 Urheberrecht. Die enthaltenen Daten, Tabellen, Grafi ken, Bilder etc. sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind Statistik Burgenland vorbehalten. Nachdruck kostenlos, aber nur mit Quellenangabe möglich. Haftungsausschluss. Statistik Burgenland sowie alle Mitwir- kenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Statistik Burgenland und die Ge- nannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtig- keit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle, unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Statistik Burgenland und alle Mitwirkenden legen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit, wird gelegentlich nur die feminine oder die maskuline Form gewählt. Dies impliziert keineswegs eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. Quelle: Statistik Austria, Registerzählung 31.10.2011, Statistik des Bevölkerungsstandes (POPREG) 1.1.2019 Bei der Postleitzahl ist jene des Gemeindeamtes veröff entlicht, bei Gemeinden mit mehreren PLZ fi nden Sie alle weiteren PLZ im Ortsverzeichnis. Postleitzahlen aktualisiert bis 1.7.2019. -
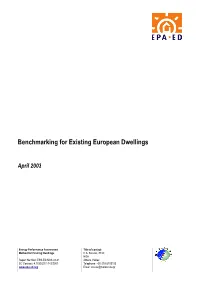
Benchmarking for Existing European Dwellings
Benchmarking for Existing European Dwellings April 2003 Energy P erformance A ssessment T itle of contact: M ethod for Existing Dwellings C .A. B a la ra s , Ph .D. NOA Report Number: EPA-ED NOA 03-01 Ath en s , H ella s EC C on tra c t: 4.1030/Z /01-142/2001 T eleph on e: + 30-210-8109152 www.epa-ed .org Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r Benchmarking for Existing European Dwellings A uthor/s Date: www.epa-ed .org C .A. B a la ra s , Ph .D. April 16, 2003 NOA P roject co-ord inator Ath en s , H ella s R eport N umb er: EB M -c on s ult, Arn h em, T eleph on e: + 30-210-8109152 EPA-ED NOA 03-01 T h e Neth erla n d s Ema il: c os ta s @ meteo.n oa .g r EC C ontract M r. B a rt Poel E. Da s c a la k i, Ph .D. 4.1030/Z /01-142/2001 b poel@ eb m-consult.nl NOA Ath en s , H ella s T eleph on e: + 30-210-8109143 Ema il: ed a s k @ meteo.n oa .g r S . G eis s ler Ö Ö I V ien n a , Aus tria T eleph on e: + 43-15-236105 Ema il: g eis s ler@ ec olog y .a t K .B . W ittc h en DB U R H oers h olm, Den ma rk T eleph on e: + 45-45742395 Ema il: k bw @ by -og -by g .d k G . -
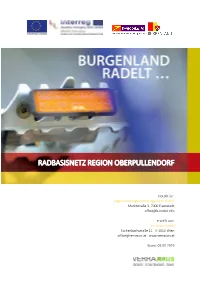
Radbasisnetz Region Oberpullendorf
RADBASISNETZ REGION OBERPULLENDORF erstellt für: Regionalmanagement Burgenland GmbH Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt [email protected] erstellt von: Verracon GmbH Eschenbachstraße 11 · A-1010 Wien [email protected] · www.verracon.at Stand: 05.09.2019 Inhaltsverzeichnis 2 INHALT 1 MEHR ALS GUTE GRÜNDE FÜRS RADFAHREN ................................................................................. 3 2 WORUM GEHT’S BEIM RADBASISNETZ ........................................................................................... 6 2.1 Die Radbasisnetze im Burgenland .......................................................................................... 6 2.2 Alltagsradverkehr vs. Freizeitradverkehr ............................................................................... 8 2.3 Woraus kann ein Radverkehrsnetz bestehen? ..................................................................... 10 3 DER WEG ZUM RADBASISNETZ ..................................................................................................... 12 3.1 Ein gemeinsamer Prozess .................................................................................................... 12 3.2 Ziele und Wunschlinien ........................................................................................................ 13 3.2.1 Ziele der Pendlerinnen und Pendler ......................................................................... 13 3.2.2 Wichtige regionale Ziele ........................................................................................... 13 3.2.3 Wunschliniennetz -

Iron Curtain Trail
IRON CURTAIN TRAIL DIESES PROJEKT WIRD VOM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG, VON Österreich – Ungarn. Entlang des „Eisernen Vorhangs“. BUND UND LAND BURGENLAND KOFINANZIERT. BGLD_cover_ROADBOOK_210x110.indd 1 12.06.2015 14:07:49 The Burgenland “Iron Curtain Trail” Discovering a piece of history For almost half a century, the Iron Curtain sepa- land, Hans Sipötz, on 27 June 1989 at Klingenbach, rated the continent - from Barents Sea to Black the Iron Curtain became a part of history. Sea. Today, you can “discover” this past division A history that you will discover in the company of of Europe with your bicycle along the 14 long- this roadbook. The Burgenland “Iron Curtain Trail” distance routes of the EuroVelo 13 (a total of is one of six top Pannonical bicycle routes. In the 10,400 km). roadbook “Cycling along Lake Neusiedl”, you A 290 km-long section of this “Iron Curtain Trail” can find the famous Lake Neusiedl Cycle Path leads along the border between Burgenland and (Neusiedler See-Radweg), the Puddle Cycle Path Hungary, where the Iron Curtain used to stand from (Lackenradweg), the Cherry Blossom Cycle Path 1948 to 1989. Many tragedies took place here, (Kirschblütenradweg) and the new Festival Cycle with people trying to flee the Eastern Block losing Path (Festival-Radweg). The Paradise Route in their lives. And tears of joy were shed, too. Such Southern Burgenland is enchanting with its as during the “Pan-European picnic” on 19 August incredible diversity. In total, 2,500 kilometres of 1989, when 600 GDR citizens fled to the West. splendidly structured and well-marked cycle As Austrian Foreign Minister Alois Mock and his paths await you in the land of the sun.