Befiehl Du Deine Wege
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

74Th Baldwin-Wallace College Bach Festival
The 74th Annual BALDWIN-WALLACE Bach Festival Annotated Program April 21-22, 2006 Save the date! 2007 75th B-W BACH FESTIVAL Friday, Saturday, and Sunday April 20–22, 2007 Including a combined concert with the Bethlehem Bach Choir, celebrating its 100th Festival, in Severance Hall. The Mass in B Minor will be featured. Check our Web site for details www.bw.edu/bachfest Featured Soloists presented with support from the E. Nakamichi Foundation and The Adrianne and Robert Andrews Bach Festival Fund in honor of Amelia & Elias Fadil BALDWIN-WALLACE COLLEGE SEVENTY-FOURTH ANNUAL BACH FESTIVAL THE OLDEST COLLEGIATE BACH FESTIVAL IN THE NATION ANNOTATED PROGRAM APRIL 21–22, 2006 DEDICATION THE SEVENTY-FOURTH ANNUAL BACH FESTIVAL IS RESPECTFULLY DEDICATED TO RUTH PICKERING (1918–2005), WHO SO LOVED MUSIC, THE BALDWIN-WALLACE COLLEGE BACH FESTIVAL AND CONSERVATORY CONCERTS, THAT SHE AND HER LATE HUSBAND, DON, HAD THEIR NAMES ENGRAVED ON BRASS PLAQUES AND AFFIXED TO THEIR FAVORITE SEATS, DD 24 AND DD 25, IN THE BALCONY OF GAMBLE HALL, KULAS MUSICAL ARTS BUILDING. SHE WILL BE REMEMBERED WITH MUCH LOVE BY MANY FROM THIS COMMUNITY, IN WHICH SHE WAS SO ACTIVE. Third Sunday Chapel Series at Baldwin-Wallace College Lindsay-Crossman A concert series under the direction of Warren Scharf, Margaret Scharf, and Nicole Keller 2006-2007 Concert Schedule Third Sundays at 7:45 p.m. Our Sixth Season October 15, 2006 March 18, 2007 November 19, 2006 April 15, 2007 December 17, 2006 The public is warmly invited to attend these free concerts. The Chapel is handicapped accessible. -

Presenting a Comprehensive Picture of Bach's Creative Genius Is One Of
Presenting a comprehensive picture of Bach’s creative genius is one of the chief objectives of the Baldwin Wallace Bach Festival. The list that follows records works performed on Festival programs since its inception in 1933. VOCAL WORKS LARGE CHORAL WORKS BWV 232, Messe in h-moll. 1935, 1936, 1940, 1946, 1947, 1951,1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019. BWV 245, Johannespassion. 1937, 1941, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. BWV 248, Weihnachts-Oratorium. 1938, 1942, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1986, 1991, 1995, 1999, 2003, 2009, 2013. BWV 244, Matthäuspassion. 1939, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012. BWV 243, Magnificat in D-Dur. 1933, 1934, 1937, 1939, 1943, 1945, 1946, 1950, 1957, 1962, 1968, 1976, 1984,1996, 2006, 2014. BWV 249, Oster-Oratorium. 1962, 1990. MOTETS BWV 225, Singet dem Herrn ein neues Lied. 1940, 1950, 1957, 1963, 1971, 1976, 1982, 1991, 1996, 1999, 2006, 2017, 2019. BWV 226, Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. 1937, 1949, 1956, 1962, 1968, 1977, 1985, 1992, 1997, 2003, 2007, 2019. BWV 227, Jesu, meine Freude. 1934, 1939, 1943, 1951, 1955, 1960, 1966, 1969, 1975, 1981, 1988, 1995, 2001, 2005, 2019. BWV 228, Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. 1936, 1947, 1952, 1958, 1964, 1972, 1979, 1995, 2002, 2016, 2019. BWV 229, Komm, Jesu, komm. 1941, 1949, 1954, 1961, 1967, 1973, 1992, 1993, 1999, 2004, 2010, 2019. -

Befiehl Du Deine Wege» (RG 680) Kernlieder 257
Andreas Marti: «Befiehl du deine Wege» (RG 680) KERNLIEDER 257 Andreas Marti «Befiehl du deine Wege» (RG 680) Ein Lied der Kernliederliste Paul Gerhardts wohl berühmtestes Vertrauenslied ist nicht nur aus Sicht des Ein Teil der Reformierten Gesangbuchs ein «Kernlied», sondern es gehört zum Kernbestand des Literatur. deutschen Kirchenliedes überhaupt, mit Ausstrahlungen bis in die Literatur, ist wie nur wenige andere Kirchenlieder Teil der Literatur, der allgemeinen Kultur. Zunächst fällt es durch seine Gestaltung auf: Bekanntlich ergeben die Strophenanfänge (im Gesangbuch kursiv gedruckt) nacheinander gelesen den Vers 5 von Psalm 37: «Befiehl dem Herrn dein‘ Weg und hoff auf ihn; er wird’s wohl machen» – ein sogenanntes Akrostichon, wörtlich etwa: eine Zeile aus den Anfängen. Das ganze Lied mit seinen zwölf Strophen ist eine Entfaltung dieses Satzes, Entfaltung des ausgehend von seinen Hauptbegriffen «Weg(e)» und «(wohl) machen». «Weg» selber Psalmverses. steht in den Strophen 1 (dreimal), 4, 5, 6 und 12: In denselben Bedeutungsbereich gehören auch Wörter wie «gehen» oder «führen» in den Strophen 1, 3, 4, 5, 7 und 8. Die zweite Wortgruppe um «machen» herum findet sich ebenfalls durchs ganze Lied hindurch und bezieht sich meist auf Gottes Handeln. Einige Beispiele: Gott «gibt … Bahn» (1,6), «sein Werk» (2,3), «das treibst du» (3,6), «dein Tun» (4,3), «ihn, ihn lass tun und walten» (8,1), «Mach End’» (12,1). Dabei überschneiden sich beide Gruppen in Verben wie «führen» oder «treiben». Nur eben hingewiesen sei auf die für die Barockdichtung typischen poetischen Barocke poe- Figuren, wie etwas die häufigen Doppel- beziehungsweise Zwillingsformeln («Mit tische Gestaltung. Sorgen und mit Grämen», 2,5; «in Angst und Nöten», 9,7 und andere Stellen). -

Bach-Werke-Verzeichnis
Bach-Werke-Verzeichnis Selected BWV (Nr & Title) Print: 25 January, 1997 VIERSTIMMIGE CHORÄLE 276 Christ ist erstanden 303 Ein feste Burg ist unser Gott 277 Christ lag in Todesbanden 304 Eins ist not, ach Herr, dies eine 278 Christ lag in Todesbanden 305 Erbarm dich mein, o Herre Gott 279 Christ lag in Todesbanden 306 Erstanden ist der heilige Christ 250 Choral 280 Christ, unser Herr, zum Jordan kam 307 Es ist gewißlich an der Zeit 251 Choral 281 Christus, der ist mein Leben 308 Es spricht der Unweisen Mund wohl 252 Choral 282 Christus, der ist mein Leben 309 Es stehn vor Gottes Throne 253 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ 283 Christus, der uns selig macht 310 Es wird schier der letzte Tag herkommen 254 Ach Gott, erhör mein Seufzen und Wehklagen 284 Christus ist erstanden 311 Es woll' uns Gott genädig sein 255 Ach Gott und Herr, wie groß und schwer 285 Da der Herr Christ zu Tische saß 312 Es woll' uns Gott genädig sein 256 Ach lieben Christen, seid getrost 286 Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich 313 Für Freuden laßt uns springen 257 Wär Gott nich mit uns diese Zeit 287 Dank sei Gott in der Höhe 314 Gelobet seist du, Jesu Christ 258 Wo Gott, der Herr, nicht bei uns hält 288 Das alte Jahr vergangen ist 315 Gib dich zufrieden und sei stille 259 Ach, was soll ich Sünder machen 289 Das alte Jahr vergangen ist 316 Gott, der du selber bist das Licht 260 Allein Gott in der Höh sei Ehr 290 Das walt Gott Vater und Gott Sohn 317 Gott der Vater wohn uns bei 261 Allein zu dir, Herr Jesu Christ 291 Das walt mein Gott, Vater, Sohn und heiliger -

Dances of Sorrow J.S
DANCES OF SORROW J.S. Bach, Partita No 2 in D Minor BWV 1004 for solo violin in an arrangement for solo violin and four voices Violin: KLARA HELLGREN Soprano: MARIE ALEXIS Alto: ANNA ZANDER Tenor: FREDRIK MATTSSON Bass: JOAKIM SCHUSTER NILCD169_KlaraH_Booklet_8-sid.indd 1 2016-10-31 09:26 Dances of sorrow Partita No 2 i d moll BWV 1004 för soloviolin och fyra röster / Partita No 2 in D Minor BWV 1004 for solo violin in an arrangement for solo violin and four voices 1. Christ lag in Todesbanden 2. Auf meinen lieben Gott 3. Den Tod... 4. Allemanda 5. Den Tod niemand zwingen kunnt 6. Wo soll ich fliehen hin 7. Corrente 8. Christ lag in Todesbanden 9. Dein Will gescheh’ 10. Befiehl Du Deine Wege 11. Den Tod… 12. Sarabanda 13. Jesu meine Freude 14. Auf meinen lieben Gott 15. Jesu Deine Passion 16. Giga 17. In meines Herzens Grunde 18. Nun lob’, mein Seel’, den Herren 19. Den Tod… 20. Ciaccona in an arrangement for solo violin and four voices inspired by the analysis of Helga Thoene. Violin: Klara Hellgren Ensemble Memento: Sopran/Soprano: Marie Alexis, Alt/Alto: Anna Zander, Tenor: Fredrik Mattsson, Bas/Bass: Joakim Schuster NILCD169_KlaraH_Booklet_8-sid.indd 2 2016-10-31 09:26 Dans eller runa över en älskad livskamrat? 1720 skrev Bach Partita i d-moll för soloviolin. Det var också året då hans första hustru, Maria Barbara Bach, mycket oväntat gick bort. Den tyska musikforskaren Helga Thoene tolkar verket som ett sorgearbete, ett monumentalt mästerverk fullt av dolda budskap i form av numerologi, symbolik och citat ur egna koraler. -

J.S. Bach Chorales
J.S. Bach Chorales a new critical and complete edition arranged by BWV catalogue number with text and historical contextual information included for each chorale with numerous indices includedCOPY in the appendix PERUSAL Edited by Luke Dahn www.bach-chorales.com www.bach-chorales.comLUXSITPRESS COPY PERUSAL www.bach-chorales.com i General Table of Contents Preface ii Individual Chorales iii Layout Overview / Abbreviations ix The Chorales BWVs 1-197a Chorales from the Cantatas 1 BWVs 226-248 Chorales from the Motets, Passions, and Christmas Oratorio 81 BWVs 250-1126 Individual Chorales 97 Indices A. Index of Chorale Melody Titles 179 B. Index of Chorale Tune Composers and Origins 181 C. Index of Melodies (by scale-degree number) 184 D. Index of Melodies (by Zahn number) 191 E. Index of Chorale Text Titles 193 F. Index of Chorale Text Authors and Origins 196 G. Index of Chorales by Liturgical Occasion 200 H. Index of Chorales by Date COPY 202 I. Cross Indices I1. BWV-to-Dietel / Dietel-to-BWV 206 I2. BWV-to-Riemenschneider 207 I3. Riemenschneider-to-BWV 208 I4. Dietel-to-Riemenschneider / Riemenschneider-to-Dietel 209 I5. Riemenschneider-to-BWV 210 J. Chorales not in Breitkopf-Riemenschneider 211 K. Breitkopf-Riemenschneider Chorales Appearing in Different Keys 213 L. Chorale duplicates in Breitkopf-Riemenschneider 214 M. Realizations of Schemelli Gesangbuch Chorales 215 N. Chorale Instrumentation and Texture Index 216 PERUSAL www.bach-chorales.com ii PREFACE This new edition of the Bach four-part chorales is intentionally created and organized to serve all those who engage with the Bach chorales, from music theorists and theory students interested in studying the Bach chorale style or in using the chorales in the classroom, to musicologists and Bach scholars interested in the most up-to-date research on the chorales, to choral directors and organists interested in performing the chorales, to amateur Bach-lovers alike. -
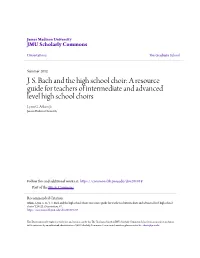
JS Bach and the High School Choir
James Madison University JMU Scholarly Commons Dissertations The Graduate School Summer 2012 J. S. Bach and the high school choir: A resource guide for teachers of intermediate and advanced level high school choirs Lynn G. Atkins Jr. James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/diss201019 Part of the Music Commons Recommended Citation Atkins, Lynn G. Jr., "J. S. Bach and the high school choir: A resource guide for teachers of intermediate and advanced level high school choirs" (2012). Dissertations. 87. https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/87 This Dissertation is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. J. S. Bach and the High School Choir: A Resource Guide for Teachers of Intermediate and Advanced Level High School Choirs Lynn Gary Atkins, Jr. A thesis submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Musical Arts School of Music August 2012 Dedication To Grace C. and Joseph Atkins, who picked up the torch and helped to mold me into the musician I am today. To Rochelle Ellis, Faith Esham, Lillian Livingston, James Jordan, J. A. Kawarsky, Ken MacLean, Marj Mottola, Rodney Somerville, Carrie Stevens, Al Wright, and Kris Zook, who gave me the knowledge to access my wildest dreams. To Rita M. Bland and Lynn G. Atkins, Sr., thank you for your gift of life…I pray I make you proud. -

Anh. II) J 62 1 288 Das Alte Jahr Vergangen Ist IV/10: 44 525 Six Sonatas Sonata 1 in Eb Major IV/7: 2 15: 3 J 1 10 526 Six Sonatas Sonata 2 in C Minor IV/7: 14 Etc
Johann Sebastian Bach Orgelwerke BWV# Sub Collection Title NBA BGA BC Will2 131 a Fugue in G minor IV/11: 3 38: 217 (Anh. II) J 62 1 288 Das alte Jahr vergangen ist IV/10: 44 525 Six Sonatas Sonata 1 in Eb major IV/7: 2 15: 3 J 1 10 526 Six Sonatas Sonata 2 in C minor IV/7: 14 etc. J 2 14 527 Six Sonatas Sonata 3 in D minor IV/7: 28 etc. J 3 19 527/1 Six Sonatas Sonata 3 in D minor IV/7: 141 528 Six Sonatas Sonata 4 in E minor IV/7: 44 etc. J 4 23 528/2 Six Sonatas Sonata 4 in E minor IV/7: 145 529 Six Sonatas Sonata 5 in C major IV/7: 56 etc. J 5 29 530 Six Sonatas Sonata 6 in G major IV/7: 76 etc. J 6 33 531 Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in C major IV/5: 3 15: 81 J 9 37 J 13, 54, 532 Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in D major IV/5: 58 15: 88 70 40 see 532 2a Preludes and Fugues (Praeludia) Fugue in D major IV/6: 95 above 44 533 Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in E minor IV/5: 90 15: 100 J 18, 72 45 see 533 a Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in E minor IV/6: 106 above 47 534 Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in F minor IV/5: 130 15: 104 J 20 48 535 Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in G minor IV/5: 157 15: 112 J 23 51 535 a Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in G minor IV/6: 109 54 536 Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in A major IV/5: 180 15: 120 J 24 56 536 a Preludes and Fugues (Praeludia) Praeludium in A major IV/6: 114 59 537 Preludes and Fugues (Praeludia) Fantasia and Fugue in C minor IV/5: 47 15: 129 J 40 60 538 Preludes and Fugues (Praeludia) Toccata -
Monthly .. ····"
· .... Concou()ia The~logicol Monthly .. ····" NOVEMBER · 1954 ARCHIVES The German Hymn In English Translation By WALTER G. TILLMANNS ED. NOTE: The writer of rhis article is professor in rhe Department of Modern Languages at Wartburg College, Waverly, Iowa. In rhis study he had rhe assistance of rhe following members of a class in Early New High German Literature: Frank Benz, Henry Borgardt, Emmett Busch, Paul Hanselmann, Marvin Hartmann, Fred Hueners, John Kuper, Reuben Schaidt, Kenneth Truckenbrod, and Wilbert Winkler. HE German hymn is one of the most precious treasures of the T Lutheran Church. Ever since 1523, when Martin Luther and his co-workers began to write "German Psalms" for the con gregation, the hymn and spiritual song has taken il:S place in the congregational life; next to the preaching of the Word and the teaching of the Catechism, there is nothing so dear to the Lutheran as the rich heritage of the "singing church." With the exception of German hymns written before the Refor mation and a few hundred by Reformed and Roman Catholic authors since then, almost all of the 100,000 or more German hymns and spiritual songs were written by Lutherans. Most of these hymns are forgotten today, but about five per cent, or roughly 5,000, have survived the centuries and are still sung today, although many of them are not known generally. Of this number about ten per cent, or a little more than 500, have been translated into the English language. A study was made of eleven Lutheran and six non-Lutheran American hymnals * in order to ascertain the number of German to the total number of hymns, the most widely used German hymns, . -

Luthers Lieder
Sonntag, 8. Oktober 2017, 17 Uhr K O NZER TSAAL DER M USI KHO CHSCHUL E STUTTG A R T Luthers Lieder Werke von J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, G. P. Telemann, J. C. Altnickol Kammerchor Stuttgart a cappella Frieder Bernius Programm Georg Philipp Telemann Ein feste Burg ist unser Gott (1681 – 1767) Choralmotette für vier gemischte Stimmen Johann Christoph Altnickol Befiehl du deine Wege (1720 – 1759) Choralmotette für Soli und vier gemischte Stimmen Felix Mendelssohn Bartholdy Motetten op. 23 (1809 – 1847) Aus tiefer Not schrei ich zu dir für Soli, vier gemischte Stimmen und Orgel Ave Maria für Soli, acht gemischte Stimmen und Orgel Mitten wir im Leben sind für acht gemischte Stimmen a cappella PAUSE Johann Sebastian Bach Jesu meine Freude (1685 – 1750) Choralmotette für Soli, fünfstimmigen Chor und Orgel Kammerchor Stuttgart Manuela Eichenlaub – Orgel Frieder Bernius Dauer: ca. eineinhalb Stunden 3 Luthers Lieder Triebkraft der Reformation In einem A-cappella-Konzert wenige Wochen vor eigenen Melodien einbrachte – Luther hatte an der dem 500. Jubiläumstag der Reformation dürfen Erfurter Universität nicht nur Theologie, sondern Luthers Lieder nicht fehlen. Das bedeutet, dass wir auch Gesang und Kontrapunkt studiert – , ist da in heute nur Choralmotetten hören, die auf Lieder pro- seinem unmittelbaren Umkreis neben anderen musi- testantischer Dichter vertont worden sind, allerdings kalischen Schöpfern vornehmlich Johann Walther höchst unterschiedlich in Form und Ausdruck. Viele (1496-1570) zu nennen, der die Lieder sogleich in Komponisten und Textdichter der Generationen nach einen vierstimmigen Satz fasste. Ansonsten fußt das Luther sind von seinen Chorälen inspiriert worden. Kirchenlied der Reformationszeit in seiner musikali- Ja, man kann sogar sagen: die Geschichte der voka- schen Form vielfach auf den vorgegebenen Formen len Komposition wäre ohne Luthers protestantische des Gregorianischen Chorals und des altdeutschen Choräle anders verlaufen. -

Alphabetical Index 101
Alphabetical Index 101 Title Opus No Sec Title Opus No Sec 10 Chorale Settings 61 2 Agnus Dei 45 10 Christmas Chorales 61 1 Agnus Dei 46 12 Hymn Introductions & Settings 71 Agnus Dei (English) 6 5 12 Kindergeschichten 3 5 Ah, Holy Jesus 82 12 Little Ditties for Piano 73 All Blessing, Honor, Thanks and 12 Mission Hymns 37 a Praise 34 1 12 Winzlinge für Klavier 73 All Glory Be to God on High 31 1 2 Freie Stücke (für Advent) 92 All Glory, Laud and Honor 6 3 30 Takte zum 30-jährigen All Glory, Laud and Honor 96 Hochzeitstag w/out 14 c All Morgen ist ganz frisch und neu 1 3 32 Klavier-Choralsätze 79 b All Morgen ist ganz frisch und neu 2 3 4 Choralvorspiele w/out 14 h All Morgen ist ganz frisch und neu 75 a 8 46. Psalm w/out 4 All My Heart This Night Rejoices 37 b 4 5 Festival Preludes on Easter Hymns 78 All My Heart This Night Rejoices 37 b 7 6 Variations for Piano on a Theme All Praise to Thee, My God, This by Beethoven 69 Night 96 A Cantata for Baptism 58 All the Earth Today Rejoices 37 b 5 Baptism, A Cantata for 58 All' Ehr' und Lob 22 1 A Chorale Fantasy for Easter 6 4 All' Ehr' und Lob 29 1 c A Letter of Anne Frank 76 All' Ehr' und Lob 30 1 A Little Lenten Cantata on All' Ehr' und Lob 56 2 "Herzliebster Jesu" 82 Alle Menschen müssen sterben 75 a 6 A Mighty Fortress 30 4 Alle Menschen müßen sterben 2 3 A Palm Sunday Processional 6 3 Alle Vogel 92 A Prayer After Meals 13 Alle Welt springe und lobsinge 8 5 b A Prayer at graduation w/out 11 e Allein auf Gottes Wort 9 17 A Prayer Before Meals 13 Allein Gott in der Höh 1 3 Abend w/out 12 b -

Kirchliches Amtsblatt Der Evangellsch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs Jahrgang 1954 Ausgegeben Schwerin, Freitag, Den 12
._ Nr. 3 Kirchliches Amtsblatt der Evangellsch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs Jahrgang 1954 Ausgegeben Schwerin, Freitag, den 12. Februar 1954 Inhalt: I. Bekanntmachungen und Mitteilungen 14) Lehr· und Lernplan für den Konfirmandenunterricht 1. Bekanntmachungen und Mitteilungen. 14) G. Nr. / 721 / 40 II 24 d daß weder der Ausschuß einen diesbezüglichen Vor Lehr- und Lernplan für den Konfirmandenunterricht schlag zu machen sich in der Lage sah, noch der Ober kirchenrat in diesem Zeitpunkt sich entschließen Für den Konfirmandenunterricht in unserer Landes konnte, die Dauer des Konfirmandenunterrichts einheit kirche sind bis zur Stunde die am 24. Juni 1926 erlas lich neu festzulegen. Bisher wurde der Regel nach zwei senen Richtlinien für den Konfirmandenunterricht - jähriger Unterricht erteilt. Dabei muß allerdings darauf Kirchliches Amtsblatt 1926 Nr. 13, S. 116 - in Geltung hingewiesen werden, daß erst der zum mindesten Alle späteren saehbetreffenden Verordnungen haben außerordentlich fragwürdige Zustand des Religions eine Ergänzung bezüglich des Aufbaues und Inhalts des unterrichtes während der Zeit des nationalsozialistischen Unterrichts nicht gebracht. Nun sind aber seit dem Er Regimes zuerst einzelne Amtsbrüder und schließlich laß der genannten Richtlinien Verhältnisse eingetreten, dann die gesamte Landeskirche dazu führte, den Kon die es fraglich erscheinen lassen, ob es heute noch ver firmandenunterricht auf zwei Jahre auszudehnen. Vor antwortet werden kann, den Konfirmandenunterricht her wurde er einjährig erteilt. Es leben unter uns noch nut auf jenen Richtlinien aufzubauen. Einmal hat die zahlreiche Pastoren und Gemeindeglieder, die al.s Vor bereits vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführte zwei bereitung auf ihre Konfirmation einen halbjährigen jährige Dauer des Unterrichts für die Ausweitung und Unterricl1t erhielten. Es wird ebensowenig übersehen Ordnung des Stoffes neue Möglichkeiten geschaffen.