Erinnerung 1..729
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

List of Participants
JUNE 26–30, Prague • Andrzej Kremer, Delegation of Poland, Poland List of Participants • Andrzej Relidzynski, Delegation of Poland, Poland • Angeles Gutiérrez, Delegation of Spain, Spain • Aba Dunner, Conference of European Rabbis, • Angelika Enderlein, Bundesamt für zentrale United Kingdom Dienste und offene Vermögensfragen, Germany • Abraham Biderman, Delegation of USA, USA • Anghel Daniel, Delegation of Romania, Romania • Adam Brown, Kaldi Foundation, USA • Ann Lewis, Delegation of USA, USA • Adrianus Van den Berg, Delegation of • Anna Janištinová, Czech Republic the Netherlands, The Netherlands • Anna Lehmann, Commission for Looted Art in • Agnes Peresztegi, Commission for Art Recovery, Europe, Germany Hungary • Anna Rubin, Delegation of USA, USA • Aharon Mor, Delegation of Israel, Israel • Anne Georgeon-Liskenne, Direction des • Achilleas Antoniades, Delegation of Cyprus, Cyprus Archives du ministère des Affaires étrangères et • Aino Lepik von Wirén, Delegation of Estonia, européennes, France Estonia • Anne Rees, Delegation of United Kingdom, United • Alain Goldschläger, Delegation of Canada, Canada Kingdom • Alberto Senderey, American Jewish Joint • Anne Webber, Commission for Looted Art in Europe, Distribution Committee, Argentina United Kingdom • Aleksandar Heina, Delegation of Croatia, Croatia • Anne-Marie Revcolevschi, Delegation of France, • Aleksandar Necak, Federation of Jewish France Communities in Serbia, Serbia • Arda Scholte, Delegation of the Netherlands, The • Aleksandar Pejovic, Delegation of Monetenegro, Netherlands -

Me Israel Aestra JULU 3-QUGUSU 8 1979 Me Israel Assam Founoed Bu A.Z
me Israel Aestra JULU 3-QUGUSU 8 1979 me Israel Assam FOunoeD bu a.z. ppopes JULU 3-aUGUSB 8 1979 Member of the European Association of Music Festivals Executive Committee: Asher Ben-Natan, Chairman Honorary Presidium: ZEVULUN HAMMER - Minister of Education and Culture Menahem Avidom GIDEON PATT - Minister of Industry, Trade and Tourism Gary Bertini TEDDY KOLLEK - Mayor of Jerusalem Jacob Bistritzky Gideon Paz SHLOMO LAHAT - Mayor of Tel Aviv-Yafo Leah Porath Ya'acov Mishori Jacob Steinberger J. Bistritzky Director, the Israel Festival. Director, The Arthur Rubinstein International Piano Master Competition. Thirty years of professional activity in Artistic Advisor — Prof. Gary Bertini the field of culture and arts, as Director of the Department of International The Public Committee and Council: Cultural Relations in the Ministry of Gershon Achituv Culture and Arts, Warsaw; Director of the Menahem Avidom Polish Cultural Institute, Budapest: Yitzhak Avni Director of the Frédéric Chopin Institute, Warsaw. Mr. Bistritzky's work has Mordechai Bar On encompassed all aspects of the Asher Ben-Natan Finance Committee: development of culture, the arts and mass Gary Bertini Menahem Avidom, Chairman media: promotion, organization and Jacob Bistritzky Yigal Shaham management of international festivals and Abe Cohen Micha Tal competitions. Organizer of Chopin Sacha Daphna competitions in Warsaw and International Meir de-Shalit Chopin year 1960 under auspices of Walter Eytan Festival Staff: U.N.E.S.C.O. Shmuel Federmann Assistant Director: Ilana Parnes Yehuda Fickler Director of Finance: Isaac Levinbuk Daniel Gelmond Secretariat: Rivka Bar-Nahor, Paula Gluck Dr. Reuven Hecht Public Relations: Irit Mitelpunkt Dr. Paul J. -

MS 315 A1076 Papers of Clemens Nathan Scrapbooks Containing
1 MS 315 A1076 Papers of Clemens Nathan Scrapbooks containing newspaper cuttings, correspondence and photographs from Clemens Nathan’s work with the Anglo-Jewish Association (AJA) 1/1 Includes an obituary for Anatole Goldberg and information on 1961-2, 1971-82 the Jewish youth and Soviet Jews 1/2 Includes advertisements for public meetings, information on 1972-85 the Middle East, Soviet Jews, Nathan’s election as president of the Anglo-Jewish Association and a visit from Yehuda Avner, ambassador of the state of Israel 1/3 Including papers regarding public lectures on human rights 1983-5 issues and the Nazi war criminal Adolf Eichmann, the Middle East, human rights and an obituary for Leslie Prince 1/4 Including papers regarding the Anglo-Jewish Association 1985-7 (AJA) president’s visit to Israel, AJA dinner with speaker Timothy Renton MP, Minister of State for the Foreign and Commonwealth Office; Kurt Waldheim, president of Austria; accounts for 1983-4 and an obituary for Viscount Bearsted Papers regarding Nathan’s work with the Consultative Council of Jewish Organisations (CCJO) particularly human rights issues and printed email correspondence with George R.Wilkes of Gonville and Cauis Colleges, Cambridge during a period when Nathan was too ill to attend events and regarding the United Nations sub- commission on human right at Geneva. [The CCJO is a NGO (Non-Governmental Organisation) with consultative status II at UNESCO (the United National Education, Scientific and Cultural Organisation)] 2/1 Papers, including: Jan -Aug 1998 arrangements -
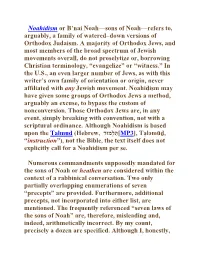
Noahidism Or B'nai Noah—Sons of Noah—Refers To, Arguably, a Family
Noahidism or B’nai Noah—sons of Noah—refers to, arguably, a family of watered–down versions of Orthodox Judaism. A majority of Orthodox Jews, and most members of the broad spectrum of Jewish movements overall, do not proselytize or, borrowing Christian terminology, “evangelize” or “witness.” In the U.S., an even larger number of Jews, as with this writer’s own family of orientation or origin, never affiliated with any Jewish movement. Noahidism may have given some groups of Orthodox Jews a method, arguably an excuse, to bypass the custom of nonconversion. Those Orthodox Jews are, in any event, simply breaking with convention, not with a scriptural ordinance. Although Noahidism is based ,MP3], Tạləmūḏ]תַּלְמּוד ,upon the Talmud (Hebrew “instruction”), not the Bible, the text itself does not explicitly call for a Noahidism per se. Numerous commandments supposedly mandated for the sons of Noah or heathen are considered within the context of a rabbinical conversation. Two only partially overlapping enumerations of seven “precepts” are provided. Furthermore, additional precepts, not incorporated into either list, are mentioned. The frequently referenced “seven laws of the sons of Noah” are, therefore, misleading and, indeed, arithmetically incorrect. By my count, precisely a dozen are specified. Although I, honestly, fail to understand why individuals would self–identify with a faith which labels them as “heathen,” that is their business, not mine. The translations will follow a series of quotations pertinent to this monotheistic and ,MP3], tạləmūḏiy]תַּלְמּודִ י ,talmudic (Hebrew “instructive”) new religious movement (NRM). Indeed, the first passage quoted below was excerpted from the translated source text for Noahidism: Our Rabbis taught: [Any man that curseth his God, shall bear his sin. -

EXTENSIONS of REMARKS April 13, 1989 EXTENSIONS of REMARKS Yielding to Extraordinary Economic Pres Angola
6628 EXTENSIONS OF REMARKS April 13, 1989 EXTENSIONS OF REMARKS Yielding to extraordinary economic pres Angola. Already cut off from South African TESTIMONY OF HOWARD sures from the U.S. government, South aid, which had helped stave off well funded PHILLIPS Africa agreed to a formula wherein the anti invasion-scale Soviet-led assaults during communist black majority Transitional 1986 and 1987, UNITA has been deprived by HON. DAN BURTON Government of National Unity, which had the Crocker accords of important logistical been administering Namibia since 1985, supply routes through Namibia, which ad OF INDIANA would give way to a process by which a new joins liberated southeastern Angola. IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES government would be installed under United If, in addition, a SWAPO regime were to Thursday, April 13, 1989 Nations auspices. use Namibia's Caprivi Strip as a base for South Africa also agreed to withdraw its anti-UNITA Communist forces, UNITA's Mr. BURTON of Indiana. Mr. Speaker, I estimated 40,000 military personnel from ability to safeguard those now resident in would like to enter a statement by Mr. Howard Namibia, with all but 1,500 gone by June 24, the liberated areas would be in grave ques Phillips of the Conservative Caucus into the to dismantle the 35,000-member, predomi tion. RECORD. In view of recent events in Namibia, nantly black, South West African Territori America has strategic interests in south al Force, and to permit the introduction of ern Africa. The mineral resources concen I think it is very important for all of us who are 6,150 U.N. -

The Inventory of the Faith R. Whittlesey Collection #1173
The Inventory of the Faith R. Whittlesey Collection #1173 Howard Gotlieb Archival Research Center Whittlesey, Faith #1173 4/3/1989 Preliminary Listing I. Subject Files. Box 1 A. “Before You Leave.” [F. 1] B. “China Trip.” [F. 2-3] II. Financial Materials. A. General; includes checks and bank statements . [F. 4] III. Correspondence. A. General,1984-1985; notables include: [F. 5] 1. Reagan, Ronald. TLS, 10/18/83. IV. Printed Materials. A. General; includes magazines, newspaper clippings. [F. 6-7] V. Notebooks. A. 2 items, n.d. [F. 8] VI. Photographs. A. 181 color, 48 black and white prints. [F. 9, E. 1-3] VII. Personal Memorabilia. A. General; includes hats; hot pads; driver’s license; plate decoration. [F. 10] VIII. Audio Materials. A. 2 cassettes tapes. [F. 11] Whittlesey, Faith #1173 4/3/89- 5/21/03 Preliminary Listing I. Manuscripts. Box 2 A. General re: speeches,1985. [F. 1-4] II. Correspondence. A. General, ALS, TLS, TL, ANS, telegrams, greeting cards, 1984-1986; notables include: 1. Reagan, Ronald. Carbon copy to Jon Waldarf, 11/5/86. [F. 5] 2. Murdoch, Rupert. TLS to FW, 12/24/85. 3. O’Conner, Sandra Day. TLS to FW, 6/4/85. B. “Swiss,” file. C. General, 1984-1987. [F. 6-8] III. Professional Materials. A. Files 1. “Information.” [F. 9] 2. “Ambassador Whittlesey 1602.” [F. 10] 3. “Thursday, Dec. 12.” 4. “The Ambassador’s Schedule.” 5. “Pres. Visit Nov. 1985 Take to Geneva.” 6. “Untitled re: Brefig Book.” 7. “1984-1986.” [F. 11-14] IV. Printed Materials. A. General, 1985-1986. -

Karl Plagge Ein Gerechter Unter Den Völkern
Karl Plagge Ein Gerechter unter den Völkern – Begleitheft zur Ausstellung – Herausgegeben von der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. Ausstellungsinformationen / Impressum Ausstellungsinformationen: KARL PLAGGE, ein „Gerechter unter den Völkern“ Ausstellung herausgegeben vom Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Ein Projekt der Darmstädter Geschichtswerkstatt e.V. Unterstützt von: Vilna Gaon Jewish State Museum (Vilnius), Studienkreis Deutscher Wider- stand 1933–1945 (Frankfurt a.M.), Hilfsfonds Jüdische Sozialstation e.V. (Freiburg i.Br.). Finanziell gefördert durch die Stadtsparkasse Darmstadt und weitere Spenden. Verantwortlich für den Inhalt der Ausstellung: Hannelore Skroblies und Christoph Jetter. Gestaltung der Ausstellung: archetmedia Darmstadt GbR (www.archetmedia.de). Druck der Ausstellungstafeln: roboplot Darmstadt (www.roboplot.de). Informationen: www.darmstaedter-geschichtswerkstatt.de Kontakt: [email protected] Die Ausstellung besteht aus: 6 Ausstellungstafeln 2 x 1 m, doppelseitig bedruckt, mit der Auf- stellungstechnik aufbewahrt in einer transportablen Kiste; benötigter Raum: mindestens 5 x 10 m. Die Ausleihe für Darmstädter Schulen und Bildungseinrichtungen bei Selbstabholung ist kostenlos, Ausleihe für andere Einrichtungen gegen Kaution. Vormerkung und Ausleihe über: Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt (Telefon: 06151-132562 – E-Mail: [email protected]). Impressum: Begleitheft zur Ausstellung „KARL PLAGGE, ein Gerechter unter den Völkern.“ Herausgegeben von der Darmstädter Geschichtswerkstatt -

Hintergründe Zur «Tagblatt»- Umstrukturierung Seite 6
Nov./Dez. 14/2014 Preis Fr. 8.50 Ausgabe für die Ostschweiz und das Fürstentum Liechtenstein www.leaderonline.ch DAS UNTERNEHMERMAGAZIN AUTOZENTRUM WEST www.maserati-west.ch Piccardstrasse 1 • 9015 St. Gallen • Tel. 071 311 66 66 St.Gallen vs. Luzern Hintergründe zur «Tagblatt»- Umstrukturierung Seite 6 Polarmond AG Weltneuheit aus der Ostschweiz Seite 44 Special LEADERIN – Im Porträt: Elf weibliche Topshots der Ostschweiz – Claudia Graf, Andrea Rütsche: Frauen an der Spitze – Erfolgreiche Netzwerke: für und unter Frauen ab Seite 66 logistik2000.ch werber , r walde PREIS-LEISTUNGS- SIEGER Top -Performance retrofreie Fonds mehrfach aus gezeichnet Dafür arbeiten wir. Bei uns profitieren Sie von einer hervorragenden Performance, die wir seit Jahren mit besten Ratings und Auszeichnungen immer wieder unter Beweis stellen. Sei es mit dem Lipper Fund Award, dem FUCHS Performance Projekt oder den Dachfonds Awards des österreichischen GELD-Magazins. Alle unsere Fonds sind retrofrei und gehören damit zu den günstigsten aktiv gemanagten Fonds in Europa. Aber die wichtigste Auszeichnung bleibt für uns Ihr glückliches Lachen. Mehr unter: www.llb.li/auszeichnungen FUCHS Performance Projekt II Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE Platz 3 von 31 Teilnehmern nach zwei Jahren (Stand: 30.6.2014) Editorial 3 Die Ostschweiz ist noch mehr gefordert Es liegt ein schmaler Grat zwischen der Forderung nach einem freien Markt und dem Schutz von regionalen Interessen. Grundsätzlich müssen Unternehmen frei in ihren Entscheiden sein, wenn es darum geht, die Marktposition zu verteidigen. Eine Sonderrolle nehmen allerdings die Medien ein: Sie sind zwar einerseits ganz «normale» Unternehmen, anderer- seits beeinflussen sie die Wahrnehmung der Öffentlichkeit direkt. Das gilt umso mehr in Regionen, in denen ein faktisches Medienmonopol besteht. -

BUS 200 Group Project, Semester 2, 20057 March 2011 Business Organisation and Management
BUS 200 group project, semester 2, 20057 March 2011 business organisation and management (Photos: Entrance hall UBS headquarters in Basel, Aeschenvorstradt ; Counter hall UBS headquarters in Zurich, Bahnhofstrasse; UBS headquarters in Zurich, Bahnhofstrasse 45; UBS in Zurich, Paradeplatz) a glimpse of UBS Authors: Philipp Bircher 40808459 Meike Brünk 40594432 Valery Crottaz 40638626 Andreas Eiman 40811840 Anssi Ihaniemi 40794067 Executive summary As one of the leading wealth management companies in the world, a premier global invest- ment and asset management bank, UBS’ situation represents a good example of the chal- lenges an organization in the financial sector faces today. Beginning with a short outline of its historical roots, we try to shed light on UBS’ organizational culture. In this context it is cru- cial to understand that the values and norms within a company serve as guiding principles on a firm’s way to success. Thus, we analyse the values the organization promotes and discuss the implications this might have on its business. Many principles that are reflected in UBS’ organizational culture today have their roots in the bank’s constituting parts. Furthermore, the views on leadership and its emphasis on entrepreneurial thinking can only be fully understood if one takes into account the bank’s very diverse background which is a result of its history, its global business operations and its, in terms of culture and age, very heterogeneous work- force. Based on these facts and thoughts, we address the question of UBS’ strengths, weaknesses, opportunities and threats and summarize the organization’s situation in a SWOT Analysis. In terms of strengths, it turns out that the organization comes up with an efficient human re- source management, which focuses on satisfied employees, who are recognized by UBS as a key factor in the company’s success. -

Weld Nailed for Coverup of Bush-Contra Drug Ties
Click here for Full Issue of EIR Volume 23, Number 43, October 25, 1996 �[(rnNational Weld nailed for coverup of Bush-Contra drug ties by Anton Chaitkin Sen. John Kerry CD-Mass.) has called for an independent in GovernorWeld, then in the Criminal Division-come to my vestigation into whether, as part of the "Contra" intrigues, office, and I gave him all of the information. I gave it to governmentagencies were involved in bringing drugs to mi the Justice Department, that the CIA knew, the DEA [Drug nority communities. Kerry said on Oct. 14 that the Justice Enforcement Administration] knew, high government offi Department ignored the evidence to that effect that he had cials in the State Department, and, in the White House knew, delivered in the late 1980s. About Republican Gov. William that CIA personnel were involved in trafficking drugs.. .. F. Weld, who is now running against Kerry for the U.S. Sen- . They did nothing, and, unfortunately, that report has lingered ate, Kerry said, "I personally delivered all of that information for years.'; to the Justice Department in Washington in 1986 during the time Bill Weld was at the Justice Department, and the Justice The Weld-Bush family web Department, frankly, did zippo." EIR reported last week that William Weld, as head of the The day after Kerry's challenge, Weld panicked when the Justice Department's Criminal Division, acted as the point very first question of a televised Kerry-Weld debate was put for obstruction of justice against Senator Kerry's and others' to the governor: "In a recent article published in the San Jose investigations of the Iran-Contra operations during .1986-87. -

Right-To-Know9 County Fetes Fourth; Crash Kills Area Girl
Keansburg seeks new fire truck after fatal blaze, B1 GREATER RED BANK EATONTOWN Righetti fires no-hitter Pending legislation LONG BRANCH Bosox bow to first Yankee no-hitter Lead-screening examinations since Larsen's perfect game. for pre-schoolers proposed. Today's Forecast: Thundershowwrs by tonight Page B3 Page B1 Complf wfcthf on A2 The Daily Register VOL.106 NO. 2 YOUR HOMETOWN NEWSPAPER . SINCE 1878 TUESDAY, JULY 5, 1983 . 25 CENTS Industries say no to 'right-to-know9 By JO ASTRID OLADING industry throughout the state. But representatives of local in- president and general counsel for ple this way is actually better than The bill, which is considered the Tbe complex bill, designed to in- dustries, most of which did not par- Charles of the Ritz, Ltd., which has simply labeling," he said. "Our ex- most comprehensive of its kind in Tbe controversial "right to form employees working with haz- ticipate in the lobbying against the a manufacturing plant in Holmdel. perience is that workers don't both- the country, would require- firms to know" bill awaiting Gov. Thomas . ardous substances through a system bill, feel the legislation will com- He said current practices in the er with labels." In his seven years supply inlorm'ation to the state H. Kean't signature It greeted with of labeling, passed the state As- plicate enforcement of adequate Holmdel plant include extensive in- with Charles ol the Ritz, he added, Health Department and the Depart- skepticism by several Moninouth sembly, 62-12, last week after It safety standards already in effect in struction, readily accessible master the firm's track record in industrial ment of Environmental Proteawn County industries, whose spoke* months of hearings, legislative bat- their workplaces. -

Aufbruch Zu Neuen Ufern? Ski Valais
AZ 3900 Brig Freitag, 16. April 2004 Unabhängige Tageszeitung 164. Jahrgang Nr. 88 Fr. 2.— Auflage: 27459 Ex. Redaktion: Tel. 027 / 922 99 88 Abonnentendienst: Tel. 027 / 948 30 50 Mengis Annoncen: Tel. 027 / 948 30 40 US-Kehrtwende in Nahostpolitik Aufbruch zu neuen Ufern? KOMMENTAR R a m a l l a h. – (AP) Das Bekenntnis der US-Regie- Schnelle Walliser rung zum Erhalt mehrerer jü- Ski Valais: Ein schweizerisch neues Nachwuchskonzept um Pirmin Zurbriggen discher Siedlungen im West- Es gibt scharfe Zungen, die jordanland stösst in der arabi- (wb) Nicht bloss auf Grund der behaupten, der Walliser sei schen Welt und bei der EU lamentablen Leistungen der ein Jammereisen. Vielleicht auf Protest. Der palästinensi- Schweizer Skirennfahrer in die- gehört auch Bundesrat sche Präsident Jassir Arafat sem Winter wird im Wallis seit Merz dazu. Dann gibt es forderte einen Abzug Israels Monaten an einem «revolu- noch die bösen Mäuler, die aus allen 1967 besetzten Ge- tionären» Nachwuchskonzept sprechen sogar von einem bieten. Ein Sprecher der EU- gearbeitet. Das Projekt ist in der Schmarotzer. Ob sie Recht Kommission erklärte, eine Schweiz neu und ehrgeizig, haben oder nicht, interes- Veränderung der Grenzen deshalb wird zurzeit in den siert mich nicht. Denn es von vor 1967 wäre nur ak- Walliser Skiklubs Überzeu- gibt auch die anderen. Die zeptabel, wenn sich Israelis gungsarbeit geleistet. Die Kreativen. Die Mutigen. und Palästinenser gemeinsam Grundzüge der neuen Nach- Die Aktiven. Pirmin Zur- darauf verständigten. Seite 2 wuchsausbildung, die vorab Ju- briggen war in seiner gendliche im OS-Alter betrifft: Sportkarriere vor allem ein Armee stellt Im ganzen Wallis sollen 13 Schneller.