Arbeits- Und Binnenmigration Im Deutschen Kaiserreich
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introduction Making, Experiencing and Managing Difference in a Changing Germany
Introduction Making, Experiencing and Managing Difference in a Changing Germany Jan-Jonathan Bock and Sharon Macdonald In late August and early September 2015, thousands of asylum seekers from the Middle East were stranded in Hungary’s capital, Budapest. Many complained about heavy-handed mistreatment by the authorities, who also set up new ‘detention centres’ at the country’s southeastern border (Haraszti 2015; Kallius et al. 2016). When thousands of migrants left Budapest to march on a motorway towards Austria – and Germany – the German Chancellor, Angela Merkel, and her Austrian counterpart, Werner Faymann, took a far-reaching decision. Bypassing the ordinary rules of the EU’s shared asylum system, both leaders agreed to permit asylum seekers entry into their countries to process applications for pro- tection and combat human trafficking. Only two weeks previously, the discovery of seventy-one dead bodies in a locked van on the A4 motorway in Austria – the victims of trafficking – had illustrated the fatal conse- quences of Europe’s insufficient protection schemes for those fleeing con- flict elsewhere (den Heijer et al. 2016). The pressure on European leaders to act further increased after the highly publicized death of a young boy, Alan Kurdi, who drowned on his way to Europe. Images of his lifeless body, washed up on a Turkish beach, shocked the world.1 According to the EU’s Dublin Regulation, asylum seekers ought to apply for protection in the first EU country they reach. In most cases, these are Greece or Italy – two countries that, in the mid 2010s, struggled with unemployment and austerity, and from which asylum seekers sought to continue northwards (Lucht 2012; Redattore Sociale 2015; Trauner 2016). -

Immigration, Ueberfremdung, and Cultural Chauvinism in German Far-Right Partisan Discourse
Imagined Identity: Immigration, Ueberfremdung, and Cultural Chauvinism in German Far-Right Partisan Discourse Paul A. Harris, Ph.D. Augusta State University Abstract In recent years, issues of an imagined ethno-cultural identity and revived nationalism have received renewed attention in German partisan public discourse. Initially, this came as a shock to both Germans and non- Germans. Both inside and outside of Germany the rise of right-wing partisan rhetoric has evoked fearful memories of the Nazi past. Yet, given the political parties responsible for bringing this nationalist, xenophobic and anti-semitic discourse to the forefront, most notably the Die Republikaner (REP) , Deutsche Volksunion (DVU), and Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)such reactions should hardly be surprising. The radical right’s adherence to racist ideology is both openly xenophobic and anti-Semitic and centers around the threat of elimination of the German kulturnation. This article addresses this right-extremist rhetoric in light of Germany’s liberal post-War immigration policies. I first undertake a historical examination of German immigration policy which has contributed to Germany’s multi-cultural milieu. I then examine German far right partisan discourse and its attack on Germany’s expansive immigration policies. My ultimate goal is to expose the illusory and fallacious character of the far right’s racist arguments in light of Germany’s post-War status as a true immigration country. Since the end of World War II Germany has witnessed changes in the demographic makeup of immigrants entering its borders. Whereas in the immediate post-War years co-ethnics from throughout Central and Eastern Europe dominated the immigrant landscape, since the 1960s a multi-ethnic and multi-cultural mix of peoples from throughout Eastern German Policy Studies/Politikfeldanalyse, 1(3), 2001, pp. -

Stadtgeschichte(N) Gelsenkirchen
Stadtgeschichte(n) Gelsenkirchen Eine Einrichtung in Trägerschaft der Einleitung Abriss der Stadtgeschichte Im Jahre 1875 wurden der Stadt Gelsenkirchen die Stadtrechte ver- liehen. Das heißt, eigentlich nur einem Teil der Stadt, die heute diesen Namen trägt – und zwar der »Landgemeinde Gelsenkirchen«, seit 1868 Verwaltungssitz und Hauptort des Amtes Gelsenkirchen: »Auf den Bericht vom 22. November d. Js. will Ich der im Kreise Bochum gelegenen Gemeinde Gelsenkirchen die Städte-Ordnung für die Provinz Westfalen vom 19. März 1856 hiermit verleihen und zugleich genehmigen, dass die genannte Gemeinde fortan auf dem Provinzial-Landtag von Westfalen im Stande der Städte vertreten werde«, verfügte am 29. November 1875 Wilhelm I., König von Preu- ßen. Die neue Stadt Gelsenkirchen, zu jenem Zeitpunkt wenig mehr als 11.000 Einwohner zählend, war geschaffen! Trotz einer mittelalterlichen Vorgeschichte – erstmalig wurde Gel- senkirchen um 1150 urkundlich erwähnt – ist die heutige Stadt tat- sächlich und in erster Linie ein Produkt des Industriezeitalters. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Gebiet des heutigen Gelsenkirchen ein dünn besiedelter Landstrich mit etwa 6.000 Ein- wohnern. Abgesehen von einigen Handwerkern in den Kirchdörfern Gelsenkirchen und Buer ernährten sich die Menschen mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft. An die Vorgeschichte der Indus- triestadt erinnern heute nur noch einige Baudenkmäler wie Schloss Horst, Schloss Berge, die Burg Lüttinghof sowie einige Überreste bäuerlichen Lebens. Als gegen Mitte des 19. Jahrhunderts im hiesigen Gebiet Kohle entdeckt, die Gegend durch die Köln-Mindener Eisenbahn verkehrs- mäßig erschlossen wurde und schließlich auch allmählich die tech- 2 nischen Probleme der Kohlegewinnung gemeistert werden konnten, begann die Industrialisierung Gelsenkirchens. -
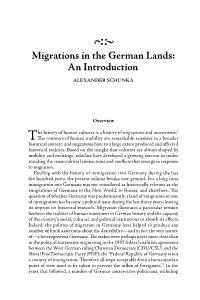
Migrations in the German Lands: an Introduction ALEXANDER SCHUNKA
12 Migrations in the German Lands: An Introduction ALEXANDER SCHUNKA Overview he history of human cultures is a history of migrations and movements.1 TThe contours of human mobility are remarkably sensitive to a broader historical context, and migrations have to a large extent produced and affected historical realities. Based on the insight that cultures are always shaped by mobility and exchange, scholars have developed a growing interest in under- standing the cross-cultural connections and conflicts that emerge in response to migration. Dealing with the history of immigration into Germany during the last five hundred years, the present volume breaks new ground. For a long time, immigration into Germany was not considered as historically relevant as the emigrations of Germans to the New World, to Russia, and elsewhere. The question of whether Germany was predominantly a land of emigration or one of immigration has become a political issue during the last thirty years, leaving its imprint on historical research. Migration illustrates a particular tension between the realities of human movement in German history and the capacity of the country’s social, cultural, and political institutions to absorb its effects. Indeed, the politics of migration in Germany have helped to produce any number of frank assertions about the desirability—and in fact the very nature of—a heterogeneous Germany. The stakes were perhaps never more clear than in the political statements originating in the 1982 federal coalition agreement between the West German ruling Christian Democrats (CDU/CSU) and the liberal Free Democratic Party (FDP): the “Federal Republic of Germany is not a country of immigration. -

Seite 1 Von 6 Publikationsliste David Skrabania
Publikationsliste David Skrabania Monografien und Aufsätze Notaufnahmelager Marienfelde. Aufnahme und Integration von Aussiedlern in Berlin. 1. April 1953 bis 1. Juli 2010 (Blaue Reihe. Schriftenreihe für Wissenschaft und Praxis, Bd. 4), Berlin 2011 (128 Seiten) Przemiany tożsamościowe górnośląskich przesiedleńców w Berlinie 1964-1990 [Bewusstseinsveränderungen oberschlesischer Aussiedler in Berlin], in: Czasypismo, Nr. 3 (2013), Instytut Pamięci Narodowej [Institut für nationales Gedenken], Katowice 2013, S. 171- 176. Keine Polen? Bewusstseinsprozesse unter Ruhrpolen 1880-1914, in: Studia Śląskie [Schlesische Studien], Bd. 72, Opole 2013, S. 117-140. Górny Śląsk z oddali. Perspektywa Górnoślązaków w Okręgu Ruhry [Oberschlesien aus der Ferne. Die Perspektive der Oberschlesier im Ruhrrevier], in: Linek, Bernard / Rosenbaum, Sebastian / Struve, Kai (Hgg.): Koniec starego świata – początek nowego. Społeczeństwo Górnego Śląska wobec pierwszej wojny światowej 1914-1918, Źródła i materiały [Das Ende der alten Welt - der Beginn der neuen Welt. Die Gesellschaft Oberschlesiens im Angesicht des Ersten Weltkrieges 1914-1918. Quellen und Materialien], S. 124-130. Górnośląscy przesiedleńcy w Berlinie, 1964-1990: sukcesy i problemy integracyjne. Próba zbliżenia z perspektywy mikrohistorycznej [Oberschlesische Aussiedler in Berlin, 1964-1990: Integrationserfolge und -probleme. Versuch einer mikrohistorischen Annäherung], in: Rosenbaum, Sebastian (Hg.): Górny Śląsk i Górnoślązacy. Wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku [Oberschlesien -

Download Full Text
International Journal of Social Science and Economic Research ISSN: 2455-8834 Volume:03, Issue:03 "March 2018" THE RUHR-POLES: A STUDY IN GERMAN MIGRATION R. Nivedita PhD Research Scholar, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India ABSTRACT The first major wave of migration of the Poles was witnessed towards the Ruhr valley and was predominantly an essential component of the industrial manufacturing of coal, steel and mining. The immigration of the Poles westwards had a deep-seated consequence on Eastern Europe, Germany, Western Prussia and the portioned portion of Poland which eventually became a part of the Western Prussian conurbations. A majority of the ethnic Polish migrants came from the portions occupied by Russia, Posen and Silesia. One of the chief causes for large scale migration towards the German Empire was Germany was the second largest importer of labour after the United States to fulfil its demand for labour. The expansion of the Ruhr Valley as the largest industrial town of Europe, experienced spatial expansion of the province accompanied with the settlement of Ruhr-Poles. Thence began the process of assimilation and accommodation alongside preserving national identity. The following research attempts to understand the socio- economic dimension of Poles living in the Ruhr in particular and the German Empire at large coupled with the bureaucratic measures undertaken by Prussia during process of Germanisation and at the start of the Great War. Keywords: Ruhr-Poles, Migration, Immigration, Ethnic-minority, Germanisation, Citizenship 1. INTRODUCTION The Industrial Revolution transformed Germany into a major economic power in Europe until the outbreak of the First World War. -

Timeline / 1860 to 1930 / GERMANY
Timeline / 1860 to 1930 / GERMANY Date Country Theme 1860 - 1910 Germany Fine And Applied Arts Realism (a backlash to both Classicism and Romanticism) is exemplified by French artist Gustave Courbet’s Die Steinklopfer (1849), although long before then Albrecht Dürer had painted his highly realistic Junger Feldhase (1502). 1862 Germany Political Context Otto von Bismarck becomes prime minister of Prussia. 1864 Germany Political Context As a consequence of the Prussian–Danish war, Denmark retracts its demand for Schleswig and Holstein. 1864 Germany Great Inventions Of The 19th Century The chemist Julius Lothar Meyer (1830–95) develops the first periodic table of chemical elements. 1866 - 1905 Germany Economy And Trade Henri Nestlé founds the company Nestlé, which becomes the world’s largest corporation for comestible goods. 1866 - 1871 Germany Economy And Trade Formation of the North German Confederation in 1866/7 sees a federation of the 22 independent states of northern Germany, with nearly 30 million inhabitants. It was the first modern German nation-state and the basis for the later German Empire (1871–1918). 1866 Germany Great Inventions Of The 19th Century Werner von Siemens invents the dynamo. 1867 - 1885 Germany Fine And Applied Arts King Ludwig II of Bavaria sets in motion the building of his second palace, Linderhof (1869–85), the smallest of the large palaces he had built, and the only one he lived to see completed. The king’s penchant for the so called Moorish style can be seen in several elements, such as the Moorish Kiosk (1867) and the Moroccan House (1878). The King’s House on the Schachen (1869–72), built with a Turkish Hall by Georg von Dollmann, further attests to Ludwig’s admiration for the “Oriental” style. -

Massenmedien Und Die Integration Ethnischer Minderheiten in Deutschland
Rainer Geißler, Horst Pöttker (Hrsg.) Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland 2009-01-12 10-29-12 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02c3199654622912|(S. 1 ) T00_01 schmutztitel - 1027.p 199654622920 Die Reihe »Medienumbrüche« wird herausgegeben von Peter Gendolla. 2009-01-12 10-29-12 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02c3199654622912|(S. 2 ) T00_02 seite 2 - 1027.p 199654622944 Rainer Geissler, Horst Pöttker (Hrsg.) Massenmedien und die Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland Band 2: Forschungsbefunde Medienumbrüche | Band 30 2009-01-12 10-29-12 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02c3199654622912|(S. 3 ) T00_03 titel - 1027.p 199654623032 Diese Arbeit ist im Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg 615 der Universität Siegen entstanden und wurde auf seine Veranlassung unter Verwendung der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel gedruckt. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2009 transcript Verlag, Bielefeld This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. Umschlaggestaltung: Susanne Pütz, Siegen; Kordula Röckenhaus, Bielefeld Satz: Sarah Hubrich Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 978-3-8376-1027-7 Gedruckt auf alterungsbeständigem -

Migration and (Im)Mobility
Anna Xymena Wieczorek Migration and (Im)Mobility Culture and Social Practice Für meine Eltern Georg und Marianna Wieczorek Anna Xymena Wieczorek (Dr. phil.), born in 1985, obtained her PhD in socio- logy within the International Research Training Group “Diversity: Mediating Difference in Transcultural Spaces” at the University of Trier. Her research pro- ject included several stays abroad at the collaborating Université de Montréal as well as in Toronto and Berlin for field activities. Her research interests are migration, mobility and transnational studies as well as cultural, diversity and gender studies. Anna Xymena Wieczorek Migration and (Im)Mobility Biographical Experiences of Polish Migrants in Germany and Canada Diese Studie ist eine aktualisierte Fassung der Arbeit: »Patterns of (Im)Mobility: Revisiting Migration through Biographical Experiences in Germany and Canada«, die im Jahr 2016 am Fachbereich IV der Universität Trier als Dissertationsschrift angenommen wurde. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-3-8394-4251-7. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche National- bibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http:// dnb.d-nb.de This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeri- vatives 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non-commercial pur- poses, provided credit is given to the author. -
Timeline / 1870 to After 1930 / GERMANY
Timeline / 1870 to After 1930 / GERMANY Date Country Theme 1870 - 1913 Germany Economy And Trade The rail network transforms German industry, and merchant shipping multiplies. Since 1870 Germany Migrations The so-called Ruhrpolen migrate to the Ruhr, where many work in coal mining. 1870 Germany Economy And Trade The Deutsche Bank is founded by Georg von Siemens. From 1871 - 1914 Germany Economy And Trade Germany’s industrial production is now six times what it had been. 1871 Germany Political Context The German Empire, a union of sovereign states and free cities, is established under Prussian leadership. 1871 Germany Cities And Urban Spaces Berlin becomes the imperial capital. 1871 - 1914 Germany Cities And Urban Spaces The process of urbanisation begins: in 1907 Berlin had more than 2 million citizens of which around 40% are locals, 20% German immigrants and 40% foreign immigrants. 1871 - 1910 Germany Cities And Urban Spaces The second Industrial Revolution sees massive immigration; the population rises from 41 to 65 million, and from only eight cities with no more than 100,000 inhabitants, more than 48 cities are formed. From 1871 Germany Economy And Trade The capital market is enlivened by France’s payment of 5 million French francs, paid to Germany as compensation following the war between the two countries (1870–1). 1872 - 1879 Germany Reforms And Social Changes As a consequence of the Kulturkampf the influence of the Catholic Church is limited in Germany. 1873 - 1880 Germany Economy And Trade Date Country Theme The economic crash known as the Gründerkrise sees companies and banks shut down and a rise in unemployment and social dissatisfaction. -
The Transformation of Nationalism in Central and Eastern Europe Ideas and Structures
e d The i Tr te an d Ideas and Stru sf b ctu o y r r es m K a a r t l i o C n o r d o e f l l N & a K t o i n o r n a d a J l i a s e j e m p c z o n i r n i k u C E e n n r t e r t a s l a a E n d The Faculty of Journalism and Political Science University of Warsaw The Transformation of Nationalism in Central and Eastern Europe Ideas and Structures University of Warsaw Faculty of Journalism and Political Science The Transformation of Nationalism in Central and Eastern Europe Ideas and Structures edited by Karl Cordell & Konrad Jajecznik Warsaw 2015 Für Tante Dore Karl Cordell Publishing series: Etnopolityka, vol. 2. Scientific Editor of the series: Professor dr. habil. Andrzej Wierzbicki, University of Warsaw Reviewed by Professor Levente Salat (Babeş-Bolyai University) Cover project Tomasz Kasperczyk © Copyright by University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science Warsaw 2015 ISBN: 978-83-63183-81-3 Publishing sheets: 12,5 Edition of the book supported by the University of Warsaw Foundation Publisher: University of Warsaw Faculty of Journalism and Political Science Krakowskie Przedmieście 3 00–927 Warsaw, Poland Phone: 48 22 55 20 293 e-mail: [email protected] www.wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl Typeset and printing by University of Warsaw (Zakład Graficzny UW. Zam. 1114/2014) Contents Acknowledgments ……………………………………………………………………… 9 Introduction …………………………………………………………………………… 11 Karl Cordell Germany and Poland: Strangers on a Train or Participants of a Common Destiny? ……………………………………………………………………………… 17 Konrad Jajecznik -

The Migration of Poles to Germany in the Context of the Most Common Polish Surnames
PRZEGLĄD ZACHODNI 2010, No 2 MARIusZ KOwALsKI, PRZEMysłAw ŚLEsZyńsKI warsaw THE MIGRATION OF POLES TO GERMANY IN THE CONTEXT OF THE MOST COMMON POLISH SURNAMES The Most Common Polish Surnames in Germany INTRODuCTION One of the methods used in studies on the origin of populations is the analysis of the distribution of the surnames that are characteristic for a given nationality. with- out going into too much detail as far as the literature on the subject, what should be noted are the fundamental advantages and disadvantages of the method: 1) It yields rather general information on the directions of migration with respect to certain countries and nationality groups; 2) It is not possible to determine the actual number of migrants, or the scale of their influx in a given period, unless comparable data for different periods are available; 3) The presence of a particular surname in a given area is conditioned not only by external migrations, but also by internal ones (secondary migration). with the abovementioned shortcomings in mind, we present an analysis of the 20 most frequent Polish surnames in Germany around the year 2000. Among others, the study uses data provided by the Internet website Verwandt (www.verwandt.de). HIsTORICAL BACKGROuND The history of the presence of Polish surnames in Germany is undoubtedly long, and dates back to when modern surnames were beginning to form in Poland. This fact stems from the close contact between the two countries, which entailed a con- stant migration exchange. The earliest Polish surnames began to appear as early as in the late Middle Ages, and emerged with increased frequency during the periods of the Renaissance and Reformation.