Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

From the Ashes of Sobibor: a Story of Survival Pdf, Epub, Ebook
FROM THE ASHES OF SOBIBOR: A STORY OF SURVIVAL PDF, EPUB, EBOOK Thomas Toivi Blatt | 242 pages | 25 Jun 1997 | Northwestern University Press | 9780810113022 | English | Evanston, United States From the Ashes of Sobibor: A Story of Survival PDF Book October 16, Here again, Blatt's luck continues. From Solon His Follie. All but My Life. I had to drag myself through the rest of the reading in this class, but this book I read with gusto! It's not only a story of another extermination camp, but also presents the life after the author's escape from this place of terror. I had learned about Auschwitz and Dachau but I knew little about Sobibor until this class and this book and it has changed me in ways I can't even describe. His family has perished, and he's learning while on This book was given to me by my daughter, who had taken a course on the Holocaust in college, which she liked a great deal. Add to Wishlist. Learn more about citation styles Citation styles Encyclopedia. From the Ashes of Sobibor is the story of a courageous boy who vowed that he would live to witness for those who died, for those whose lives had been reduced to the ashes of Sobibor. Blatt was captured, jailed, and then hospitalized, nearly dying of typhus before finally returning home. Teddie rated it really liked it Feb 04, Publication Date. Truthfully, I want everyone to read this book. Books by Thomas Toivi Blatt. Survival and Recovery. Enlarge cover. From the Deep Woods to Civilization. -

The Atid Project: Teaching the Holocaust! Through Digital
THE ATID PROJECT: TEACHING THE HOLOCAUST! THROUGH DIGITAL STORYTELLING! ! by! ! Eli Kowaz ! BA (Hons), McGill University, 2013! ! ! A Major Research Paper! Presented to Ryerson University! ! in partial fulfillment of the! requirements for the degree of! Master of Digital Media! in the! Yeates School of Graduate Studies! ! Toronto, Ontario, Canada, 2015! © Eli Kowaz! ! ! ! ! ! ! AUTHOR'S!DECLARATION! ! I hereby declare that I am the sole author of this MRP. This is a true copy of the MRP, including any required final revisions.! I authorize Ryerson University to lend this MRP to other institutions or individuals for the purpose of scholarly research.! I further authorize Ryerson University to reproduce this MRP by photocopying or by other means, in total or in part, at the request of other institutions or individuals for the purpose of scholarly research.! I understand that my MRP may be made electronically available to the public.! ! ! Signed,! ! ! Eli!Kowaz! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ii! ABSTRACT! This paper aims to develop a Holocaust education protocol template with the goals of maximizing student engagement, enhancing the student experience, boosting retention of information, and facilitating the individual's identification with the historical events of the Holocaust. The protocol proposed is of general application and is suitable for other current and historic events. At the same time, the Holocaust is a powerful and appropriate event for illustrating the impact of digital media on education, and in particular, it highlights head on the issue of historical distance from actual events and the ways in which digital technology and media can reduce the risk of losing key sources of testimonial experience that are so often central to the student’s appreciation and understanding of such events. -

Basic Christian 2009 - C Christian Information, Links, Resources and Free Downloads
Sunday, June 14, 2009 16:07 GMT Basic Christian 2009 - C Christian Information, Links, Resources and Free Downloads Copyright © 2004-2008 David Anson Brown http://www.basicchristian.org/ Basic Christian 2009 - Current Active Online PDF - News-Info Feed - Updated Automatically (PDF) Generates a current PDF file of the 2009 Extended Basic Christian info-news feed. http://rss2pdf.com?url=http://www.BasicChristian.org/BasicChristian_Extended.rss Basic Christian 2009 - Extended Version - News-Info Feed (RSS) The a current Extended Basic Christian info-news feed. http://www.BasicChristian.org/BasicChristian_Extended.rss RSS 2 PDF - Create a PDF file complete with links of this current Basic Christian News/Info Feed after the PDF file is created it can then be saved to your computer {There is a red PDF Create Button at the top right corner of the website www.basicChristian.us} Free Online RSS to PDF Generator. http://rss2pdf.com?url=http://www.BasicChristian.org/BasicChristian.rss Updated: 06-12-2009 Basic Christian 2009 (1291 Pages) - The BasicChristian.org Website Articles (PDF) Basic Christian Full Content PDF Version. The BasicChristian.org most complete resource. http://www.basicchristian.info/downloads/BasicChristian.pdf !!! Updated: 2009 Version !!! FREE Download - Basic Christian Complete - eBook Version (.CHM) Possibly the best Basic Christian resource! Download it and give it a try!Includes the Red Letter Edition Holy Bible KJV 1611 Version. To download Right-Click then Select Save Target _As... http://www.basicchristian.info/downloads/BasicChristian.CHM Sunday, June 14, 2009 16:07 GMT / Created by RSS2PDF.com Page 1 of 125 Christian Faith Downloads - A Christian resource center with links to many FREE Mp3 downloads (Mp3's) Christian Faith Downloads - 1st Corinthians 2:5 That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. -

Lublin Ghetto
Coordinates: 51°15′11″N 22°34′18″E Lublin Ghetto The Lublin Ghetto was a World War II ghetto created by Lublin Ghetto Nazi Germany in the city of Lublin on the territory of General Government in occupied Poland.[1] The ghetto inmates were mostly Polish Jews, although a number of Roma were also brought in.[2] Set up in March 1941, the Lublin Ghetto was one of the first Nazi-era ghettos slated for liquidation during the most deadly phase of the Holocaust in occupied Poland.[3] Between mid-March and mid-April 1942 over 30,000 Jews were delivered to their deaths in cattle trucks at the Bełżec extermination camp and additional 4,000 at Majdanek.[1][4] Two German soldiers in the Lublin Ghetto, May 1941 Contents Also known as German: Ghetto Lublin or Lublin Reservat History Liquidation of the Ghetto Location Lublin, German-occupied Poland See also Incident type Imprisonment, forced labor, References starvation, exile External links Organizations Nazi SS Camp deportations to Belzec extermination camp and Majdanek History Victims 34,000 Polish Jews Already in 1939–40, before the ghetto was officially pronounced, the SS and Police Leader Odilo Globocnik (the SS district commander who also ran the Jewish reservation), began to relocate the Lublin Jews further away from his staff headquarters at Spokojna Street,[5] and into a new city zone set up for this purpose. Meanwhile, the first 10,000 Jews had been expelled from Lublin to the rural surroundings of the city beginning in early March.[6] The Ghetto, referred to as the Jewish quarter (or Wohngebiet der Juden), was formally opened a year later on 24 March 1941. -

The Annex to the Workshop “Letters to Henio”
The Annex to the workshop “Letters to Henio” Translated by Jarosław Kobyłko (2015) Annex 2.1 – printout 1 Set I: photographs 1-8, Set II: photographs 9-16. 1. „Kurier Lubelski”. Lubelska gazeta codzienna / Lublin's daily newspaper 'Kurier Lubelski' 2. Ulica Szeroka / Szeroka street 3. Nowy cmentarz żydowski / The new Jewish cementary 4. Ruiny dzielnicy żydowskiej / The ruins of the Jewish quarter 5. Uroczystość otwarcia Jesziwas Chachmej Lublin / Yeshivat Chachmei Lublin. Opening ceremony 6. Plac zamkowy / Castel Square 7. „Lubliner Tugblat”. Lubelska gazeta codzienna / Lublin's daily newspaper 'Lubliner Tugblat' 8. Ulica Szeroka / Szeroka street 9. Elementarz hebrajski / Hebrew Primer 10. Ruiny synagogi Maharszala / The ruins of Maharshal Synagogue 11. Elementarz polski / Polish Primer 12. Ulica Nowa 23 / Nowa street 23 13. Brama Grodzka / Grodzka Gate 14. Widok ze wzgórza zamkowego / View from the Castle Hill 15. Parochet 16. Getto lubelskie / Lublin’s ghetto Descriptions of photographs 1-16 Set I, photographs 1-8: 1. Lublin daily newspaper “Kurier Lubelski” “Kurier Lubelski” was a newspaper published daily in 1932, overtly referring to the tradition of “Kurier” from the years 1906-1913. It was a news periodical with inclinations towards literature. Among the members of the editorial team were poets Józef Czechowicz and Józef Łobodowski. The last issue of “Kurier Lubelski” was published on 30 November 1932. 2. Szeroka Street The no longer existent Szeroka Street, also referred to as Żydowska (Jewish) Street. Once the main street of the Jewish Quarter. The photograph shows the buildings between Kowalska Street and the intersection with Jateczna Street, which also ceased to exist. -

In Preparazione Della Giornata Della Shoah Suggerimenti Per Gli Educatori
n. 2 — Ricordare la seconda guerra mondiale In preparazione della Giornata della Shoah Suggerimenti per gli educatori L’articolo (del 25 gennaio 2006) è ripreso dal sito dell’OSCE — Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. http://www.osce.org/it/odihr/17833?download=true poloni aeurop ae 2011 IN PREPARAZIONE DELLA GIORNATA DELLA SHOAH Suggerimenti per gli educatori Gennaio 2006 Introduzione Queste linee guida circa la preparazione della Giornata della Memoria della Shoah, sono state pensate per gli educatori di studenti delle scuole superiori dei Paesi membri dell' OSCE (Organismo per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) e propongono suggerimenti su come pianificare attività di commemorazione connesse con la Giornata della Memoria della Shoah. L’OSCE è la più grande organizzazione pan-Europea per la sicurezza regionale, con i suoi 55 Stati membri, dall'America del Nord, all'Europa, all’Asia Centrale, fino al Caucaso. L’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell’OSCE (ODHIR), è una delle varie istituzioni che si occupano di promuovere e supportare iniziative in materia di diritti umani, di libertà fondamentali, democrazia e regolamenti legislativi. A causa delle attuali manifestazioni di anti- Semitismo e del suo progressivo risorgere negli ultimi anni in alcune aree dei paesi membri, l’OSCE ha riaffermato la responsabilità degli Stati nel promuovere la tolleranza e la non- discriminazione e nel combattere l’anti-Semitismo rinforzando le attività in materia di Olocausto. Dal 2003, nel corso di varie conferenze sui temi dell’anti-Semitismo, della lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, sono state progettate nuove dettagliate iniziative nelle aree interessate. -

Memory of the Babi Yar Massacres on Wikipedia Makhortykh, M
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Framing the holocaust online Memory of the Babi Yar Massacres on Wikipedia Makhortykh, M. Publication date 2017 Document Version Final published version Published in Digital Icons Link to publication Citation for published version (APA): Makhortykh, M. (2017). Framing the holocaust online: Memory of the Babi Yar Massacres on Wikipedia. Digital Icons, 18, 67–94. https://www.digitalicons.org/issue18/framing-the- holocaust-online-memory-of-the-babi-yar-massacres/ General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:24 Sep 2021 Framing the Holocaust Online: Memory of the Babi Yar Massacres on Wikipedia MYKOLA MAKHORTYKH University of Amsterdam Abstract: The article explores how a notorious case of Second World War atrocities in Ukraine – the Babi Yar massacres of 1941-1943 – is represented and interpreted on Wikipedia. -

The Survivor's Hunt for Nazi Fugitives in Brazil: The
THE SURVIVOR’S HUNT FOR NAZI FUGITIVES IN BRAZIL: THE CASES OF FRANZ STANGL AND GUSTAV WAGNER IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL JUSTICE by Kyle Leland McLain A thesis submitted to the faculty of The University of North Carolina at Charlotte in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in History Charlotte 2016 Approved by: ______________________________ Dr. Heather Perry ______________________________ Dr. Jürgen Buchenau ______________________________ Dr. John Cox ii ©2016 Kyle Leland McLain ALL RIGHTS RESERVED iii ABSTRACT KYLE LELAND MCLAIN. The survivor’s hunt for Nazi fugitives in Brazil: the cases of Franz Stangl and Gustav Wagner in the context of international justice (Under the direction of DR. HEATHER PERRY) On April 23, 1978, Brazilian authorities arrested Gustav Wagner, a former Nazi internationally wanted for his crimes committed during the Holocaust. Despite a confirming witness and petitions from West Germany, Israel, Poland and Austria, the Brazilian Supreme Court blocked Wagner’s extradition and released him in 1979. Earlier in 1967, Brazil extradited Wagner’s former commanding officer, Franz Stangl, who stood trial in West Germany, was convicted and sentenced to life imprisonment. These two particular cases present a paradox in the international hunt to bring Nazi war criminals to justice. They both had almost identical experiences during the war and their escape, yet opposite outcomes once arrested. Trials against war criminals, particularly in West Germany, yielded some successes, but many resulted in acquittals or light sentences. Some Jewish survivors sought extrajudicial means to see that Holocaust perpetrators received their due justice. Some resorted to violence, such as vigilante justice carried out by “Jewish vengeance squads.” In other cases, private survivor and Jewish organizations collaborated to acquire information, lobby diplomatic representatives and draw public attention to the fact that many Nazi war criminals were still at large. -

May 16,A.M.– From11:30 Services on May 15, Where He Will Talk from the Shabbat for Congregation Israel Beth at Guest Ber Eventsof During the Weekend
Washtenaw Jewish News Presort Standard In this issue… c/o Jewish Federation of Greater Ann Arbor U.S. Postage PAID 2939 Birch Hollow Drive Ann Arbor, MI Ann Arbor, MI 48108 Shavuot— Spring Facebook Permit No. 85 celebrating break in offers Torah Argentina Holocaust teaching tool Page 7 Page 10 Page 18 May 2010 Iyar Sivan 5770 Volume XXXIV: Number 8 FREE WASHTENAW / HIAS president to speak in Ann Arbor Shabbat celebrations for the elderly Michael Appel, special to the WJN Aura Ahuvia, special to the WJN n May 15 and 16, Gideon Aronoff, n conjunction with Jewish Family Services, their face,” said Leora Druckman, a member president and CEO of the Hebrew the Ann Arbor Reconstructionist Havurah of the Reconstructionist Havurah who helped O Immigrant Aid Society (HIAS), will I will begin offering mini-Shabbat celebra- lead such Shabbat celebrations a few years visit Ann Arbor, making a number of appear- tions every month at different assisted living ago. Druckman got involved because her own ances to talk about immigrant resettlement facilities in the Ann Arbor area. Volunteers are mother, Sylvia, was herself one of the residents issues and the Jewish community. Aronoff’s being sought from the local Jewish community in a number of local memory-care facilities be- visit is sponsored by the Social Action Com- to receive training, and then to sign up to lead fore passing away in 2008. Today, Druckman mittee of Beth Israel Congregation and Jewish anywhere from one to 12 of these celebrations wishes to continue her involvement in such Family Services. -
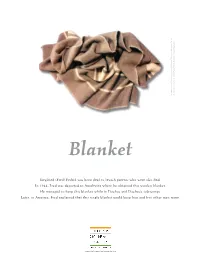
Everyday Objects from the Holocaust-PT 2
On display at the Washington State Holocaust Education Resource Center. State Holocaust Education Resource Center. Washington On display at the Harve Photo by of Siegfried Fedrid. On loan from the family Bergmann. Blanket Siegfried (Fred) Fedrid was born deaf to Jewish parents who were also deaf. In 1944, Fred was deported to Auschwitz where he obtained this woolen blanket. He managed to keep this blanket while in Dachau and Dachau’s sub-camps. Later, in America, Fred explained that this single blanket could keep him and five other men warm. www.HolocaustCenterSeattle.org A seven year-old Siegfried “Fred” Fedrid pictured with his mother, an aunt, and other cousins in Vienna, circa 1927. Fred was the only survivor. iegfried “Fred” Fedrid was born in April 1920 When Fred returned to Vienna to look for his friends in Vienna, Austria. Fred was born deaf to and relatives, he found no one. Further, he was told Jewish parents who were also deaf. In 1936 Fred that the Nazis had sold all of the possessions he and his Sgraduated from the School for the Deaf in Vienna. At parents had left behind. He had lost everything. 16 years old, he began an apprenticeship in a custom tailor shop. He trained there until 1938, when the Fred was hired at a Nazis forced the owner of the shop, a Jewish man, to “He wanted people to custom tailor shop, close his business. know that deaf people lived in a rented room, are capable, intelligent, and supported himself. In October of 1941, the Gestapo arrested Fred and his and able to support family. -

An Organizational Analysis of the Nazi Concentration Camps
Chaos, Coercion, and Organized Resistance; An Organizational Analysis of the Nazi Concentration Camps DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Thomas Vernon Maher Graduate Program in Sociology The Ohio State University 2013 Dissertation Committee: Dr. J. Craig Jenkins, Co-Advisor Dr. Vincent Roscigno, Co-Advisor Dr. Andrew W. Martin Copyright by Thomas V. Maher 2013 Abstract Research on organizations and bureaucracy has focused extensively on issues of efficiency and economic production, but has had surprisingly little to say about power and chaos (see Perrow 1985; Clegg, Courpasson, and Phillips 2006), particularly in regard to decoupling, bureaucracy, or organized resistance. This dissertation adds to our understanding of power and resistance in coercive organizations by conducting an analysis of the Nazi concentration camp system and nineteen concentration camps within it. The concentration camps were highly repressive organizations, but, the fact that they behaved in familiar bureaucratic ways (Bauman 1989; Hilberg 2001) raises several questions; what were the bureaucratic rules and regulations of the camps, and why did they descend into chaos? How did power and coercion vary across camps? Finally, how did varying organizational, cultural and demographic factors link together to enable or deter resistance in the camps? In order address these questions, I draw on data collected from several sources including the Nuremberg trials, published and unpublished prisoner diaries, memoirs, and testimonies, as well as secondary material on the structure of the camp system, individual camp histories, and the resistance organizations within them. My primary sources of data are 249 Holocaust testimonies collected from three archives and content coded based on eight broad categories [arrival, labor, structure, guards, rules, abuse, culture, and resistance]. -

Heterotopia, Utopia, and the Extermination Camps of Operation Reinhard
ABSTRACT Title of Dissertation: DARK MIRROR: HETEROTOPIA, UTOPIA, AND THE EXTERMINATION CAMPS OF OPERATION REINHARD Sarah Wanenchak, Doctor of Philosophy, 2019 Dissertation directed by: Professor Roberto P. Korzeniewicz, Chair, Department of Sociology, University of Maryland In Michel Foucault's body of work, the notion of heterotopia stands out as both particularly intriguing and particularly underdeveloped. Introduced in the introduction of The Order of Things (first published 1966) and further described in the lecture “Of Other Spaces” (1967), heterotopia has been used by scholars in a variety of fields, from social theory to architecture. Of special interest is the way Foucault describes the relationship between heterotopia and utopia, one defined by its liminal nature and the other by its unreality. This work seeks to shed new light on that relationship, by focusing on heterotopias as threshold spaces between the real social world and the perfected but unreal world to come. I approach the concept of utopia with an eye toward its eliminationist implications, and use three extermination camps established as part of the Nazi regime’s Operation Reinhard as cases through which to explore significant features of a heterotopia, how those features manifest in these cases, and what connects these spaces to the world that can be glimpsed in the mirror they create. Although I primarily use historical cases as a way to expand existing theory, I aim to build upon that expansion by pointing the way toward the development of new theoretical tools for historical-comparative analysis of spaces of both extermination and detention. Finally, I suggest that work might be done focusing on embodied identities as themselves forms of heterotopia, which introduces possibilities for additional analysis of the roles of bodies and identity in cases of certain kinds of mass violence and death.