Boraginaceae
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
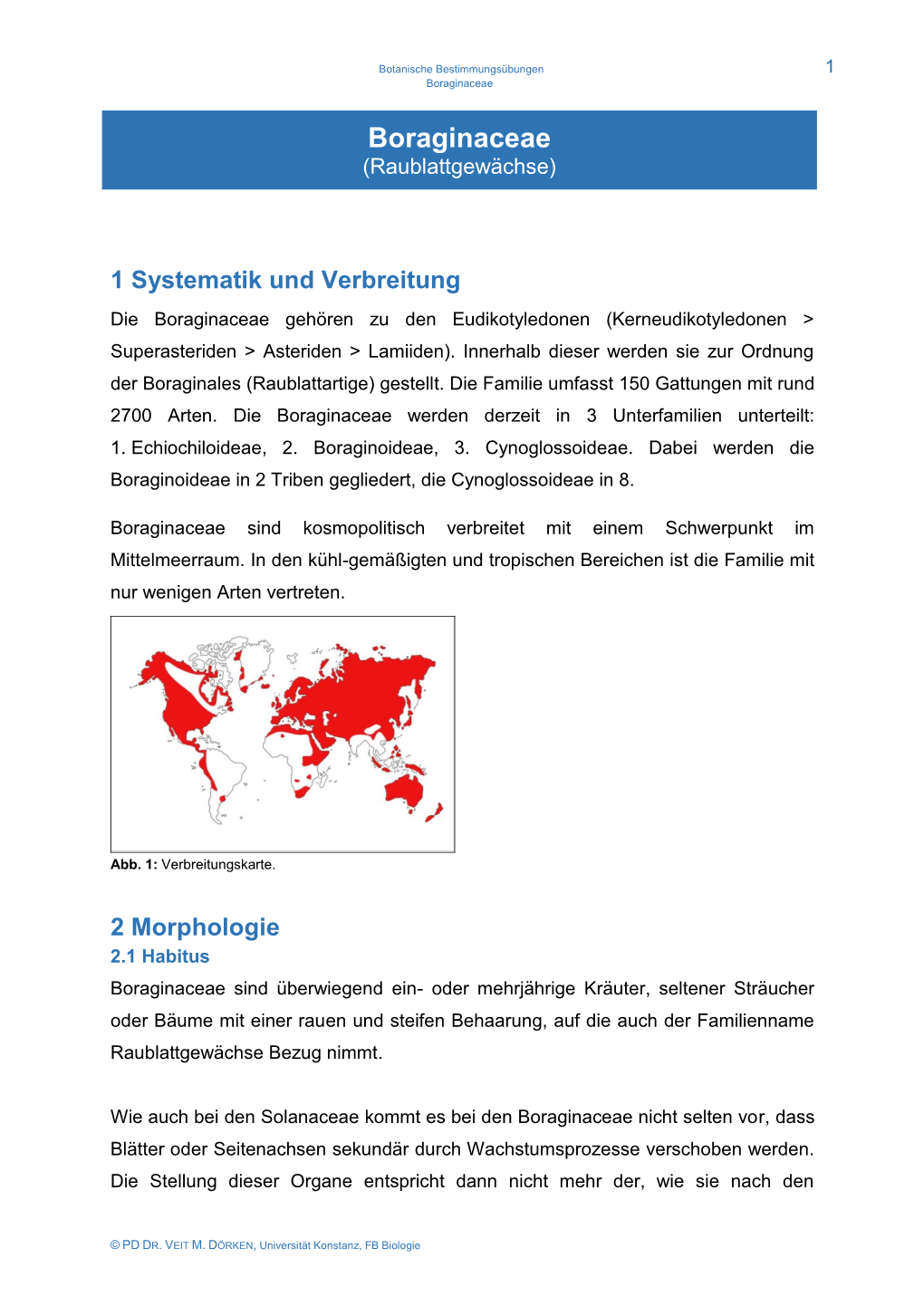
Load more
Recommended publications
-

The Maiwa Guide to NATURAL DYES W H at T H Ey a R E a N D H Ow to U S E T H E M
the maiwa guide to NATURAL DYES WHAT THEY ARE AND HOW TO USE THEM WA L NUT NATURA L I ND IG O MADDER TARA SYM PL O C OS SUMA C SE Q UO I A MAR IG O L D SA FFL OWER B U CK THORN LIVI N G B L UE MYRO B A L AN K AMA L A L A C I ND IG O HENNA H I MA L AYAN RHU B AR B G A LL NUT WE L D P OME G RANATE L O G WOOD EASTERN B RA ZIL WOOD C UT C H C HAMOM IL E ( SA PP ANWOOD ) A LK ANET ON I ON S KI NS OSA G E C HESTNUT C O C H I NEA L Q UE B RA C HO EU P ATOR I UM $1.00 603216 NATURAL DYES WHAT THEY ARE AND HOW TO USE THEM Artisans have added colour to cloth for thousands of years. It is only recently (the first artificial dye was invented in 1857) that the textile industry has turned to synthetic dyes. Today, many craftspeople are rediscovering the joy of achieving colour through the use of renewable, non-toxic, natural sources. Natural dyes are inviting and satisfying to use. Most are familiar substances that will spark creative ideas and widen your view of the world. Try experimenting. Colour can be coaxed from many different sources. Once the cloth or fibre is prepared for dyeing it will soak up the colour, yielding a range of results from deep jew- el-like tones to dusky heathers and pastels. -

Cynoglossum L.: a Review on Phytochemistry and Received: 02-05-2016 Accepted: 03-06-2016 Chemotherapeutic Potential
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2016; 5(4): 32-39 E-ISSN: 2278-4136 P-ISSN: 2349-8234 JPP 2016; 5(4): 32-39 Cynoglossum L.: A review on phytochemistry and Received: 02-05-2016 Accepted: 03-06-2016 chemotherapeutic potential Kalpana Joshi Devsthali Vidyapeeth College of Kalpana Joshi pharmacy, Rudrapur-263148, Uttarakhand, India. Abstract The genus Cynoglossum L. contains about 75 species found in hot and temperate regions of Asia, Africa Deepti Mehra Devsthali Vidyapeeth College of and Europe especially in Taiwan, Turkey, India, Kenya and China etc. The plants are mainly perennial pharmacy, Rudrapur-263148, with wide uniformity in external morphology which makes it most difficult taxonomical genus to study. Uttarakhand, India. The plants contains mainly pyrrolizidine alkaloids of many types and used as traditional medicines by tribals and vaids for cough, burns, wounds, ear infection, antibacterial and sometimes as veterinary Neeraj Kumar medicines. Some plants of this genus are scientifically validated for antioxidant, antihyperlipidaemic, Devsthali Vidyapeeth College of antidiabetic, antifertility, antitumor, anti-inflammatory, diuretic, analgesic and hepatoprotective activity. pharmacy, Rudrapur-263148, Uttarakhand, India. Keywords: Cynoglossum, pyrrozolidine, heliosupine, viridiflorine, heliotridine, echinatine Manoj Bisht Devsthali Vidyapeeth College of 1. Introduction pharmacy, Rudrapur-263148, The genus Cynoglossum L. represents about 75 known species distributed in Asia, Africa and Uttarakhand, India. Europe, 12 species in China [1] about 50 to 60 species in distributed widely in warmer and [2] [3] D. K. Sharma temperate regions of both hemispheres, 3 species in Taiwan , 8 species in Turkey but Devsthali Vidyapeeth College of recently revision in the plant list have increased the number of accepted species in this genus pharmacy, Rudrapur-263148, to over 86 species. -

Brozura Alkana Anglicka Zlom.Indd
Text: Ing. Marta Mútňanová Ing. Libor Ulrych, PhD. Translati on: RNDr. Radoslav Považan, Mgr. Mária Gréčová Graphic: Ing. Viktória Ihringová Photographs by (see pictures): Ing. Marta Mútňanová (No. 1 – the plant, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 17) Ing. Libor Ulrych, PhD. (No. 1 – detail of infl orescence, 5, 6, 7, 8, 11) RNDr. Alžbeta Szabóová (No. 10, 16) Published by the State Nature Conservancy of the Slovak Republic 2010 introduction In 2009 the State Nature Conservancy of the Slovak Republic applied for a non-re- fundable subsidy from the Ministry of Environment of the Slovak Republic within the Operati onal Programme Environment, priority axis 5. Protecti on and Regenerati on of Natural Environment and Landscape, in order to ensure implementati on of program- mes to preserve alkanet. Operati onal Programme Environment aims at use of fi nancial resources from the Euro- pean Regional Development Fund and the Cohesion Fund in the environment protecti - on in the period 2007 – 2013. Its objecti ve is to improve environmental status as well as the rati onal use of natural resources. The project enti tled Implementati on of programmes to preserve criti cally endange- red plant species was approved in September 2009. It focused on preservati on of two criti cally endangered plant species: alkanet – Alkanna ti nctoria and autumn crocus – Colchicum arenarium. The State Nature Conservancy of the Slovak Republic elabora- ted conservati on programmes for both species. On February 25, 2009 the programmes were approved by the Ministry of Environment at an operati ve session of the Minister of Environment in Decree No. -
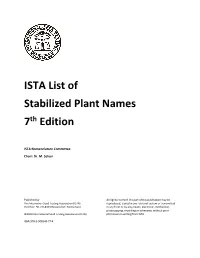
ISTA List of Stabilized Plant Names 7Th Edition
ISTA List of Stabilized Plant Names th 7 Edition ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. M. Schori Published by All rights reserved. No part of this publication may be The Internation Seed Testing Association (ISTA) reproduced, stored in any retrieval system or transmitted Zürichstr. 50, CH-8303 Bassersdorf, Switzerland in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior ©2020 International Seed Testing Association (ISTA) permission in writing from ISTA. ISBN 978-3-906549-77-4 ISTA List of Stabilized Plant Names 1st Edition 1966 ISTA Nomenclature Committee Chair: Prof P. A. Linehan 2nd Edition 1983 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. H. Pirson 3rd Edition 1988 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. W. A. Brandenburg 4th Edition 2001 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. J. H. Wiersema 5th Edition 2007 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. J. H. Wiersema 6th Edition 2013 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. J. H. Wiersema 7th Edition 2019 ISTA Nomenclature Committee Chair: Dr. M. Schori 2 7th Edition ISTA List of Stabilized Plant Names Content Preface .......................................................................................................................................................... 4 Acknowledgements ....................................................................................................................................... 6 Symbols and Abbreviations .......................................................................................................................... -

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Alkanna Tinctoria
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 9(1), 176-185, 2019. DOI: 10.31466/kfbd.566276 Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi KFBD The Black Sea Journal of Sciences ISSN (Online): 2564-7377 Araştırma Makalesi / Research Article Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of Alkanna Tinctoria (L.) Tausch Root Extracts Hatice Aysun MERCIMEK TAKCI1*, Filiz UCAN TURKMEN2, Fatma Ceren ANLAS3, Fulya USTUN ALKAN3, Pemra BAKIRHAN4, Cihan DEMIR4, Nazim SEKEROGLU2 1Arts and Sciences Faculty, Department of Molecular Biology and Genetics, Kilis 7 Aralık University, 79000, Kilis, Turkey. [email protected] 2Engineering and Architecture Faculty, Department of Food Engineering, Kilis 7 Aralık University, 79000, Kilis, Turkey. [email protected]/[email protected] 3Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology, Istanbul University, 34320, Avcilar, Istanbul, Turkey. [email protected], [email protected] 4The Institute for Graduate Studies in Sciences and Engineering, Kilis 7 Aralık University, Kilis, 79000, Turkey. [email protected] Received: 16.05.2019 *Corresponding Author: [email protected] Accepted: 03.06.2019 Abstract Alkanna tinctoria (L.) Tausch produced naphthoquinones known as DNA-topoisomerases inhibitors has been used as the traditional therapeutic agent, especially wound healing in Turkey. The antimicrobial activity against 9 clinical microorganisms and cytotoxicity on canine mammary carcinoma cell line (CMT-U27) of Alkanna tinctoria root extracts (methanol, ethanol and acetonitrile) were researched by using MTT analysis. Alkanet root extracts showed antimicrobial activity against 2 (Proteus spp. and S. haemolyticus) out of 9 microorganisms. In vitro study towards CMT-U27 cancer cells, acetonitrile root extract at 100 µg/mL concentration showed strong and significant anti- proliferative effect. Our results are manifested that the Alkanet acetonitrile root extract can be evaluated as potential therapeutic agent, immediately after identification of bio-active metabolits in extract. -

Pollen and Stamen Mimicry: the Alpine Flora As a Case Study
Arthropod-Plant Interactions DOI 10.1007/s11829-017-9525-5 ORIGINAL PAPER Pollen and stamen mimicry: the alpine flora as a case study 1 1 1 1 Klaus Lunau • Sabine Konzmann • Lena Winter • Vanessa Kamphausen • Zong-Xin Ren2 Received: 1 June 2016 / Accepted: 6 April 2017 Ó The Author(s) 2017. This article is an open access publication Abstract Many melittophilous flowers display yellow and Dichogamous and diclinous species display pollen- and UV-absorbing floral guides that resemble the most com- stamen-imitating structures more often than non-dichoga- mon colour of pollen and anthers. The yellow coloured mous and non-diclinous species, respectively. The visual anthers and pollen and the similarly coloured flower guides similarity between the androecium and other floral organs are described as key features of a pollen and stamen is attributed to mimicry, i.e. deception caused by the flower mimicry system. In this study, we investigated the entire visitor’s inability to discriminate between model and angiosperm flora of the Alps with regard to visually dis- mimic, sensory exploitation, and signal standardisation played pollen and floral guides. All species were checked among floral morphs, flowering phases, and co-flowering for the presence of pollen- and stamen-imitating structures species. We critically discuss deviant pollen and stamen using colour photographs. Most flowering plants of the mimicry concepts and evaluate the frequent evolution of Alps display yellow pollen and at least 28% of the species pollen-imitating structures in view of the conflicting use of display pollen- or stamen-imitating structures. The most pollen for pollination in flowering plants and provision of frequent types of pollen and stamen imitations were pollen for offspring in bees. -

HANDBOOK of Medicinal Herbs SECOND EDITION
HANDBOOK OF Medicinal Herbs SECOND EDITION 1284_frame_FM Page 2 Thursday, May 23, 2002 10:53 AM HANDBOOK OF Medicinal Herbs SECOND EDITION James A. Duke with Mary Jo Bogenschutz-Godwin Judi duCellier Peggy-Ann K. Duke CRC PRESS Boca Raton London New York Washington, D.C. Peggy-Ann K. Duke has the copyright to all black and white line and color illustrations. The author would like to express thanks to Nature’s Herbs for the color slides presented in the book. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Duke, James A., 1929- Handbook of medicinal herbs / James A. Duke, with Mary Jo Bogenschutz-Godwin, Judi duCellier, Peggy-Ann K. Duke.-- 2nd ed. p. cm. Previously published: CRC handbook of medicinal herbs. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8493-1284-1 (alk. paper) 1. Medicinal plants. 2. Herbs. 3. Herbals. 4. Traditional medicine. 5. Material medica, Vegetable. I. Duke, James A., 1929- CRC handbook of medicinal herbs. II. Title. [DNLM: 1. Medicine, Herbal. 2. Plants, Medicinal.] QK99.A1 D83 2002 615′.321--dc21 2002017548 This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and the publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use. Neither this book nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilming, and recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. -

Flowering Plants of South Norwood Country Park
Flowering Plants Of South Norwood Country Park Robert Spencer Introduction South Norwood Country Park relative to its size contains a wide range habitats and as a result a diverse range of plants can be found growing on site. Some of these plants are very conspicuous, growing in great abundance and filling the park with splashes of bright colour with a white period in early May largely as a result of the Cow Parsley, this is followed later in the year by a pink period consisting of mainly Willow herbs. Other plants to be observed are common easily recognisable flowers. However there are a great number of plants growing at South Norwood Country Park that are less well-known or harder to spot, and the casual observer would likely be surprised to learn that 363 species of flowering plants have so far been recorded growing in the park though this number includes invasive species and garden escapes. This report is an update of a report made in 2006, and though the site has changed in the intervening years the management and fundamental nature of the park remains the same. Some plants have diminished and some have flourished and the high level of diversity is still present. Many of these plants are important to other wildlife particularly in their relationship to invertebrate pollinators, and some of these important interactions are referenced in this report. With so many species on the plant list there is a restriction on how much information is given for each species, with some particularly rare or previously observed but now absent plants not included though they appear in the index at the back of the report including when they were last observed. -

Some Contributions to the Wall Flora of the French Coastland Between
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Braunschweiger Geobotanische Arbeiten Jahr/Year: 2020 Band/Volume: 14 Autor(en)/Author(s): Brandes Dietmar Artikel/Article: Some contributions to the wall flora of the French coastland between Antibes and Menton (Côte d’Azur) 1-10 Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 14: 1- 10 (April 2020) __________________________________________________________________________________ Some contributions to the wall flora of the French coastland between Antibes and Menton (Côte d’Azur) DIETMAR BRANDES Abstract 86 vascular plant species are observed on walls between Antibes and Menton. Most records are made on retaining walls and historical fortifications. 60,5 % of the plants are indigenous, 7,0 % are archaeophytes, 32,6 % are neophytes. Wooded species, at least 20 (23,3 %) play a more important role compared to Central Europe due to the climatically preferred area in the western Mediterranean. Some further species which may grow spontaneously in joints are pointed out, however clear evidence could not be found. Introduction During a guided excursion in early spring to important gardens at the Côte D’Azur it was possible to study the vascular plants flora of numerous walls. This cursory observation is not at all complete but they are helpful to close gaps in our research project on ‘Biodiversity of walls in Europe and neighbouring areas’. Nomenclature and floristic status follow as far as possible NOBLE et al. (2016). The family affiliation of the species complies with CHRISTENHUSZ, FAY & CHASE (2017). List of wall-dwelling species of the Côte d’Azur Adiantum capillus-veneris L. – [Pteridaceae] Indigenous. -

Vascular Plant Inventory and Ecological Community Classification for Cumberland Gap National Historical Park
VASCULAR PLANT INVENTORY AND ECOLOGICAL COMMUNITY CLASSIFICATION FOR CUMBERLAND GAP NATIONAL HISTORICAL PARK Report for the Vertebrate and Vascular Plant Inventories: Appalachian Highlands and Cumberland/Piedmont Networks Prepared by NatureServe for the National Park Service Southeast Regional Office March 2006 NatureServe is a non-profit organization providing the scientific knowledge that forms the basis for effective conservation action. Citation: Rickie D. White, Jr. 2006. Vascular Plant Inventory and Ecological Community Classification for Cumberland Gap National Historical Park. Durham, North Carolina: NatureServe. © 2006 NatureServe NatureServe 6114 Fayetteville Road, Suite 109 Durham, NC 27713 919-484-7857 International Headquarters 1101 Wilson Boulevard, 15th Floor Arlington, Virginia 22209 www.natureserve.org National Park Service Southeast Regional Office Atlanta Federal Center 1924 Building 100 Alabama Street, S.W. Atlanta, GA 30303 The view and conclusions contained in this document are those of the authors and should not be interpreted as representing the opinions or policies of the U.S. Government. Mention of trade names or commercial products does not constitute their endorsement by the U.S. Government. This report consists of the main report along with a series of appendices with information about the plants and plant (ecological) communities found at the site. Electronic files have been provided to the National Park Service in addition to hard copies. Current information on all communities described here can be found on NatureServe Explorer at www.natureserveexplorer.org. Cover photo: Red cedar snag above White Rocks at Cumberland Gap National Historical Park. Photo by Rickie White. ii Acknowledgments I wish to thank all park employees, co-workers, volunteers, and academics who helped with aspects of the preparation, field work, specimen identification, and report writing for this project. -
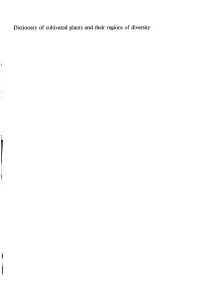
Dictionary of Cultivated Plants and Their Regions of Diversity Second Edition Revised Of: A.C
Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity Second edition revised of: A.C. Zeven and P.M. Zhukovsky, 1975, Dictionary of cultivated plants and their centres of diversity 'N -'\:K 1~ Li Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity Excluding most ornamentals, forest trees and lower plants A.C. Zeven andJ.M.J, de Wet K pudoc Centre for Agricultural Publishing and Documentation Wageningen - 1982 ~T—^/-/- /+<>?- •/ CIP-GEGEVENS Zeven, A.C. Dictionary ofcultivate d plants andthei rregion so f diversity: excluding mostornamentals ,fores t treesan d lowerplant s/ A.C .Zeve n andJ.M.J ,d eWet .- Wageninge n : Pudoc. -11 1 Herz,uitg . van:Dictionar y of cultivatedplant s andthei r centreso fdiversit y /A.C .Zeve n andP.M . Zhukovsky, 1975.- Me t index,lit .opg . ISBN 90-220-0785-5 SISO63 2UD C63 3 Trefw.:plantenteelt . ISBN 90-220-0785-5 ©Centre forAgricultura l Publishing and Documentation, Wageningen,1982 . Nopar t of thisboo k mayb e reproduced andpublishe d in any form,b y print, photoprint,microfil m or any othermean swithou t written permission from thepublisher . Contents Preface 7 History of thewor k 8 Origins of agriculture anddomesticatio n ofplant s Cradles of agriculture and regions of diversity 21 1 Chinese-Japanese Region 32 2 Indochinese-IndonesianRegio n 48 3 Australian Region 65 4 Hindustani Region 70 5 Central AsianRegio n 81 6 NearEaster n Region 87 7 Mediterranean Region 103 8 African Region 121 9 European-Siberian Region 148 10 South American Region 164 11 CentralAmerica n andMexica n Region 185 12 NorthAmerica n Region 199 Specieswithou t an identified region 207 References 209 Indexo fbotanica l names 228 Preface The aimo f thiswor k ist ogiv e thereade r quick reference toth e regionso f diversity ofcultivate d plants.Fo r important crops,region so fdiversit y of related wild species areals opresented .Wil d species areofte nusefu l sources of genes to improve thevalu eo fcrops . -

Appendix: Patierns of Specialization
APPENDIX: PATIERNS OF SPECIALIZATION Statistical rationale progress, a second variant of cluster analysis may be considered more appropriate here. In optimal (non-hierarchical) clustering, A variety of ways is available for exploring axes or groupings the analysis sorts the species into a variable number of internally within multivariate data sets. Principal components analysis, for homogeneous clusters. Group properties of the cluster then example, would identify any axes of specialization to which the become equally important as properties of their individual different attributes might variously contribute, both in kind and in members, and the analysis will not necessarily produce the same degree. However, the most suitable indication arises from the outcome as would an hierarchical analysis into the same number assumption that the values of certain attributes for a particular of clusters. group of species have evolved through simultaneous selection-a This is the approach which we, and Grime eta/. (1987), have composite response on the part of several attributes to a set of followed. They are both successive instances of a 'rolling external environmental pressures. Further, these sets of attributes synthesis', a research strategy which periodically draws together may well have evolved in such a way that coherent groupings of the current state of quantitative knowledge of native plant species species which possess them can now be identified, each with into a statistical and comparative overview. characteristic values, or ranges of values, for each of the attributes. This being so, a cluster analysis is indicated. Two variants of cluster analysis exist. The first employs a The current database hierarchical method in which each species belongs initially to its own separate class.